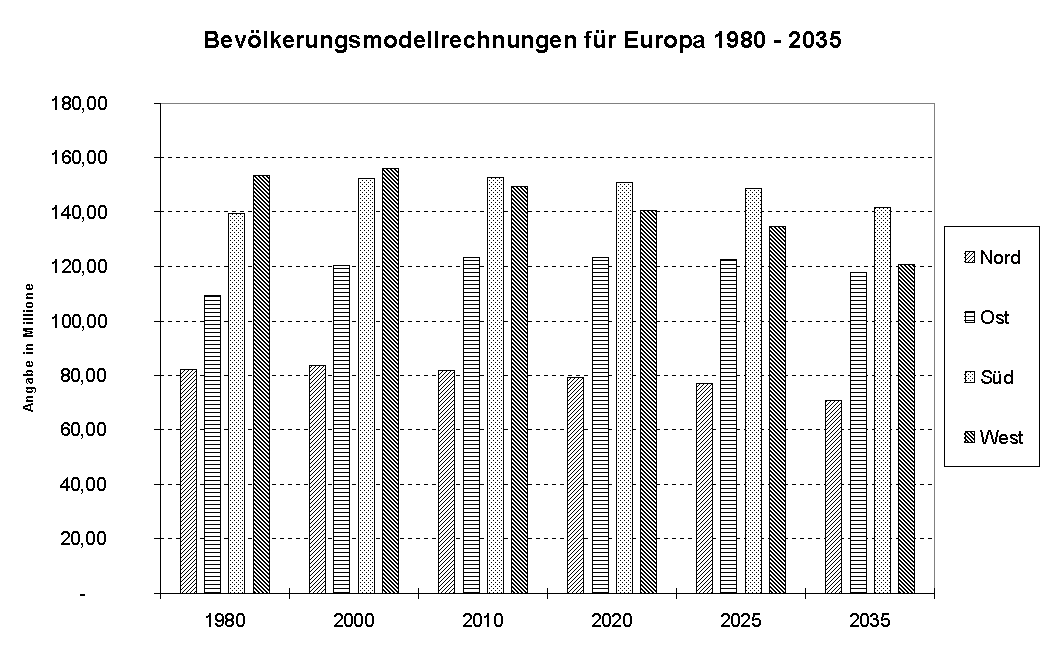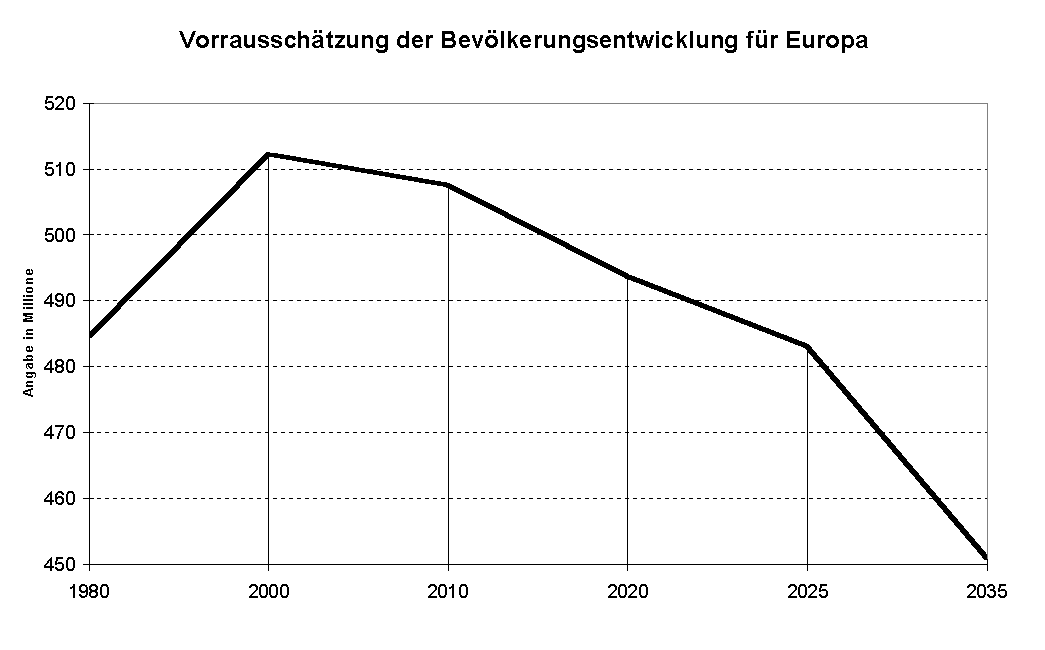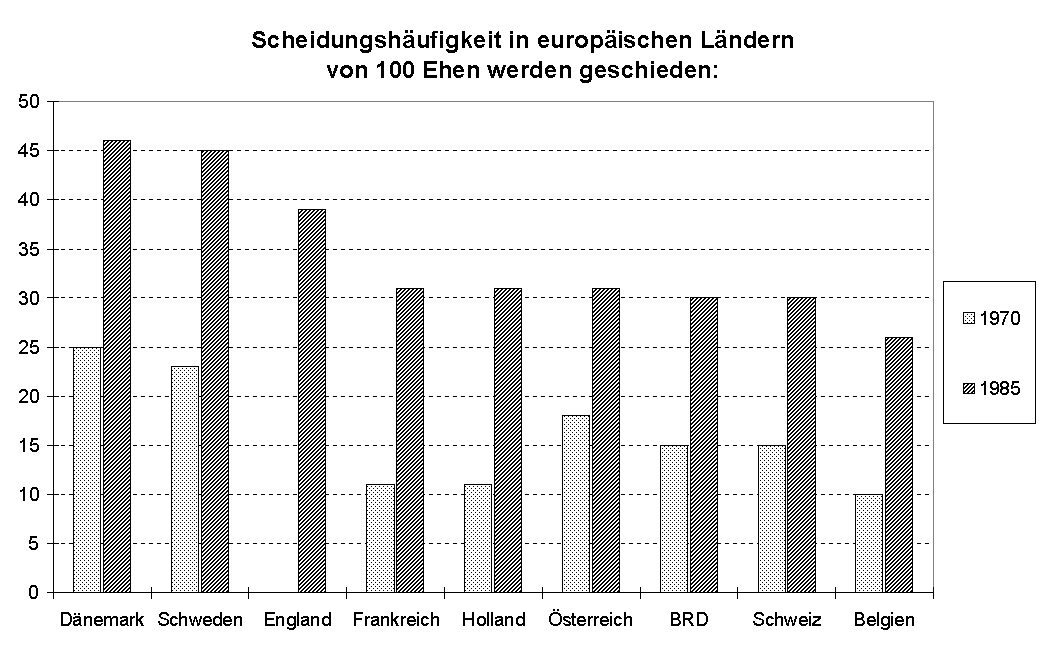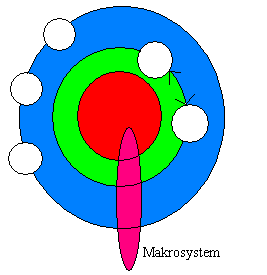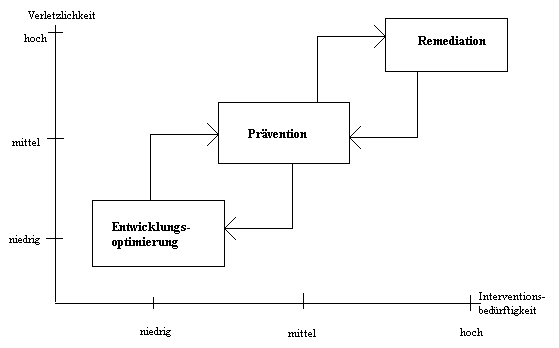Reader
zur Lehrveranstaltung
"Familienpsychologie I"
(604 532, anrechenbar als iD 2304)
Wintersemester 1997/98
(Blocklehrveranstaltung vom 27. 29. November 1997)
Lehrveranstaltungsleiter und Herausgeber
Univ.-Ass.
Mag. Dr. Harald WERNECK
Abteilung für Entwicklungspsychologie
und Pädagogische Psychologie des Instituts
für Psychologie der Universität
Wien
Wien, Februar 1998

vergleiche
auch: "Psychologie der Familie. Theorien, Konzepte, Anwendungen", herausgegeben
von Harald Werneck und Sonja Werneck-Rohrer, 2000, Wien: WUV|Universitätsverlag.
Vorwort
Der vorliegende Reader beinhaltet die gesammelten schriftlichen Berichte,
die von Studentinnen im Rahmen der Lehrveranstaltung "Familienpsychologie
I" (am Institut für Psychologie der Universität Wien) verfaßt
wurden.
Die Familienpsychologie
kann wohl mit einiger Berechtigung als zukunftsträchtiges Teilfach
der Psychologie betrachtet werden, was u. a. durch das Bestreben bzw. die
Initiative Prof.
Schneewinds (München) zum Ausdruck kommt, anläßlich
der 13. Tagung
Entwicklungspsychologie in Wien, 1997, eine eigene Fachgruppe "Familienpsychologie"
im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie (DGPs) zu gründen. Auch wenn dies bislang noch nicht
realisiert ist, so gibt es dennoch bereits einige erfolgreiche Beispiele
einer Institutionalisierung der Familienpsychologie, etwa in Form der Sektion
"Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie" im Berufsverband
Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) oder
der "Division 43
Familiy Psychology" der American Psychological
Association (APA).
Inhaltlich sprechen viele gute Argumente, wie z. B. die systematischere
und stärkere Einbeziehung familienorientierter Aspekte in einschlägige
Forschungsarbeiten, für die Etablierung einer eigenen Subdisziplin
"Familienpsychologie" und für eine Ablösung aus den diversen
traditionellen Grundlagen- und Anwendungsfächern innerhalb der Psychologie,
wie etwa der Entwicklungspsychologie, der Klinischen, der Pädagogischen,
der Sozial- oder der Persönlichkeitspsychologie. Andererseits soll
auch an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daß ebenso gute
Argumente gegen eine weitere Aufsplittung des Faches Psychologie
bzw. Ihrer Einrichtungen vorgebracht werden können und wurden.
Diese Lehrveranstaltung bzw. dieser Reader versteht sich jedenfalls
im Sinne einer "Promotion", einer Weiterentwicklung des Faches Familienpsychologie,
als Forum einer systematischen Sammlung bzw. Diskussion einschlägiger
Forschungsergebnisse unter dem gemeinsamen Aspekt familienorientierter
Zugangs- und Betrachtungsweisen.
Die einzelnen Berichte bzw. Kapitel wurden relativ unverändert
(von den jeweiligen Diskettenversionen) übernommen abgesehen von
Veränderungen im Layout bzw. geringfügigen Korrekturen (v. a.
betreffend die Rechtschreibung).
Auf eine inhaltliche Überarbeitung bzw. eine komplette Vereinheitlichung
des Layouts oder auch der Literaturverzeichnisse mußte aus Zeitgründen
verzichtet werden.
Die inhaltliche Verantwortung bleibt dementsprechend bei den einzelnen
Autorinnen.
Dieser Reader soll in erster Linie als Service für die Teilnehmenden
an der ihm zugrundeliegenden Lehrveranstaltung dienen, aber auch als Basisinformation
bzw. Anregung für (aus verschiedenen Gründen) am Thema Interessierte.
Wien, Februar 1998 / Univ.-Ass. Mag. Dr. Harald Werneck

INHALTSVERZEICHNIS
1) Gegenstand und Begriffsdefinitionen (Sophie Chabert)
2) Familie im historischen Wandel (Corinna Klein)
3) Aktuelle Trends der Institution Familie (Martina
Gustavik)
4) Familienpsychologische Theorien (Tanja Kremser)
5) Familiäre Sozialisation (Astrid Sander)
6) Familiendiagnostik (Alexandra Wiener)
7) Familiendiagnostisches Testsystem (Petra Steindl)
8) Familienberatung und Familientherapie (Doris
Wölbitsch)
9) Einstellungen zur Familie (Anita Wisberger)
10) Nichteheliche Lebensgemeinschaften (Petra
Stögerer)
11) Grundlagen der Bindungstheorie (Brigitta Wiesmüller)
12) Pubertät als Herausforderung für
die Familie (Sabine Nimmervoll und Irene Hanke)
13) Geschwisterforschung (Barbara Klaus)
14) Scheidung und ihre Folgen für die betroffenen
Kinder (Carina Kreuzinger)
15) Psychologie der Großelternschaft (Barbara
Martl)
16) Beziehungen zwischen den Generationen (Barbara
Izay)
17) Familie und Arbeitswelt (Barbara Reithofer)
18) Beruf Familie Freizeit / Zeitbudgeterhebungen
(Karin Mayer)
19) Familienpolitik (Melanie Peham)

 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1) Gegenstand und Begriffsdefinitionen (Sophie
Chabert)
Einleitung
Diese Seminararbeit soll einen kurzen Überblick über die Gegenstands-
und Begriffsdefinitionen von Familienpsychologie bieten. Im ersten Teil
werden einige allgemeine Aspekte der Familienpsychologie (Ausbildungsmöglichkeiten
in diesem Bereich, Überlegungen zu ihrer theoretischen Fundierung,
Gedanken zur familiären Intervention und zur Familiendiagnostik) kurz
angeschnitten.
Der zweite Teil der Arbeit befaßt sich mit der Familie selbst.
Einleitend erfolgen Erklärungen und Gedanken zur Begriffsgeschichte
des Wortes. Anschließend werden die unzähligen Definitionsansätze
zum Begriff der Familie geschildert und die dabei auftretenden Probleme
näher dargestellt und erläutert.
Einteilungsmöglichkeiten und verschiedene Versuche Familie zu klassifizieren
werden als abschließender Punkt in der Arbeit behandelt.
Teil I: Begriffsdefinition
Unter Familienpsychologie versteht man einen Zweig der Psychologie
der als Wissenschaft und als Profession die Beziehung zwischen dem Individuum
und seiner Familie behandelt.
Der Fokus der Familienpsychologie ist das Verhalten und Erleben von Personen
in Beziehung zu ihrer Familie. Der Gegenstand der Familienpsychologie ist
die Familie.
Für das Programm der Familienpsychologie werden folgende Punkte
als bedeutsam angesehen:
I.) Die Probleme der theoretischen Fundierung der Familienpsychologie.
II.) Überlegungen zur Familienentwicklungspsychologie.
III.) Gedanken zur familiären Diagnostik
IV.) Gedanken zur familiären Intervention.
-
Die Ausbildung in der Familienpsychologie.
I.) Theoretische Fundierung der Familienpsychologie:
Das Problem bei der theoretischen Fundierung der Familienpsychologie
besteht darin, daß es nicht möglich ist, eine Familientheorie
oder gar "die" Familientheorie zu präsentieren.
Die bisherigen Angebote an expliziten Familientheorien genügen
den Anforderungen dieses Theoriebegriffes kaum. Es ist daher wesentlich
angemessener, von theoretischen Modellen oder Metaphern zu sprechen. Auch
diese können sehr gut als Ordnungsraster für die Familienpsychologie
verwendet werden.
Die systemische Familientheorie, Michums normatives Theoriemodell oder
das familieninterne spezifische Erfahrungsmodell sind nur einige Beispiele
für solche theoretischen Modelle.
II.) Überlegungen zur Familienentwicklungspsychologie:
Unter Familienentwicklung versteht man den im Kontext der Familie in
wechselseitiger Bezogenheit verlaufenden Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung.
Familienentwicklung kann auch als Koevolution oder Koindividuation bezeichnet
werden. Die Verläufe der Familienentwicklung werden beispielsweise
von der Familien - Streß - Theorie untersucht.
Die Theorie geht dabei von der Wirkung aktueller normativer und
nicht normativer Stressoren auf das Familiensystem aus. Während sich
die normativen Stressoren auf erwartbare Übergänge im Familiensystem
beziehen (z. B. Übergang von Partnerschaft zur Elternschaft, Übergang
vom Familienleben zum "leeren Nest",.....), beziehen sich die nicht normativen
Stressoren auf außerhalb des Erwartungshorizontes der Familie liegende
Ereignisse (z. B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod, ...).
Es geht somit um eine realzeitliche Analyse von Familienentwicklungsprozessen,
wobei zum einen die familienhistorisch - individualbiographische Perspektive
berücksichtigt wird und zum anderen die aktuelle Lebenslage der Familie.
III.) Gedanken zur familiären Diagnostik:
Die Familien - Diagnostik beschäftigt sich mit:
-
der Außenbeobachtung von Familieninteraktionen,
-
dem Beziehungserleben der am Interaktionsprozeß beteiligten Personen,
-
der Rekonstruktion erlebter und gemeinsam geschaffener Geschichte im Familienkontext,
-
der Erfassung der objektiven materiellen und sozialen Lebenslage von Familien
und ihrer subjektiven Bedeutung für die einzelnen Familienmitglieder.
Bei der familiären Diagnostik ist es wichtig die familiären Beziehungsaspekte
auf unterschiedlichen Systemebenen zu untersuchen (z. B.: Eltern - Kindsystem,
Partnersystem, ...). Zur Erfassung erlebter familiärer Beziehungssysteme
dient das FDTS (= familiendiagnostisches Testsystem).
Ein Vorschlag zur Klassifikation familiendiagnostischer Verfahren stammt
von Cromwell, Olson und Fournier. Sie unterscheiden die diagnostischen
Verfahren hinsichtlich der Datenquelle (Insider beziehungsweise Outsider
Perspektive) und hinsichtlich der Datenart (subjektive erlebnisbezogene,
beziehungsweise objektive verhaltensbezogene Informationen).
Die traditionellen Ansätze der Familiendiagnostik werden von Garahl,
Rau -Ferguson und L´Abote in den folgenden Bereichen heftig kritisiert:
-
Überbetonung intrapsychischer Phänomene - Diese Überbetonung
hat zu einer Vernachlässigung der Beziehungen zwischen den Individuen
geführt.
-
Favorisierung einer linearen Epistemologie. - Diese ist einer Berücksichtigung
von Entwicklungskontexten im Weg gestanden.
-
Außerachtlassung des Systemprinzipes der Nicht-Summativität
sie war für die direkte Beobachtung interagierender Familienmitglieder
hinderlich.
IV.) Familiäre Intervention:
Die familiäre Intervention berücksichtigt vier Aspekte:
Als erstes den Aspekt der familiären Prävention. Hierbei geht
es um eine Wissens- und Handlungsvermittlung mit dem Ziel die Eigenständigkeit
und die Selbstregulationsfähigkeit in der Familie zu stärken.
Ein familien - entwicklungsorientierter Ansatz bietet sich insbesonders
für eine präventive Familienberatung an, um das Bewältigungspotential
von Familien bei Krisen im Familienleben zu stärken.
Ein zweiter Aspekt berücksichtigt die formellen und informellen
Unterstützungssysteme und zwar sowohl auf kommunaler als auch auf
Quartierebene.
Der dritte Aspekt betrifft die Einflußnahme der Familienpsychologie
auf politischer Ebene vor allem, wenn es um Fragen der materiellen und
sozialen Rahmenbedingungen familiärer Lebensgestaltung geht (z. B.
Gutachten für familiäre Fragen).
Der vierte Aspekt schließlich betrifft die Familientherapie selbst.
Eine solide wissenschaftliche Fundierung der familientherapeutischen Praxis
gibt es leider nicht und die Therapieprozeßforschung im Rahmen der
Familientherapie ist unterentwickelt.
Die zentrale Frage der Familientherapie betrifft die bestmögliche
Wirkung einer Therapie bei wem, wann sie von wem in welcher Situation,
für welchen Typ von Problemen, angewandt wird.
V.) Ausbildung im Bereich der Familienpsychologie:
Zur Ausbildung im Bereich der Familienpsychologie gibt es leider nur
wenig Positives zu sagen. Eine Befragung ergab, daß nur fünf
von 148 befragten Institutionen ein familienorientiertes Ausbildungskonzept
vorzuweisen haben. - Das erklärt das so eklatant gewordene Mißverhältnis
zwischen den im Berufsfeld von Psychologen geforderten Kompetenzen und
der Vermittlung dieser Kompetenzen durch akademische Ausbildungsprogramme.
Teil II: Gegenstandsdefinition
I.) Zur Begriffsgeschichte des Wortes Familie:
Das Wort Familie stammt vom lateinischen Wort "familia" ab, es verweist
auf famulus (= Diener) und famuli (= das im Haus lebende Gesinde). Das
Wort "Familie" wird erst Ende des 17. - Anfang des 18. Jahrhunderts in
die deutsche Sprache eingeführt.
Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Begriff jedoch noch synonym
für "das ganze Haus" verwendet und entsprach dem damaligen Verständnis
von Familie. Familienfähigkeit wurde nur jenem zuerkannt, der auch
ein eigenes Haus besaß.
Erst im Zeitalter der Industrialisierung (Trennung von Erwerb und Zusammenleben
wird wichtig) wird die Familie als Ort der privaten Beziehungen betrachtet.
Im 19. Jahrhundert kam es schließlich zur Entwicklung von Familienidealen,
die die Vorläufer der bürgerlichen Kernfamilie darstellen.
Kennzeichen der bürgerlichen Kernfamilie sind:
-
die räumliche Trennung von Öffentlichkeit und Familienleben,
von Erwerbs- und Hausarbeit
-
die geschlechtsspezifische Aufgabenzuweisung
-
die Emationalisierung des Verhaltens von Eltern und Kindern
-
Intensivierung der Kindererziehung.
II.) Zur Definition des Wortes Familie:
Es besteht bis heute keine einheitliche Auffassung dessen, was unter
Familie zu
verstehen ist.
Einige der unzähligen Definitionsansätze sollen an dieser
Stelle als Beispiel
angeführt werden:
-
Susan Sonntag (Schriftstellerin):
"Familie ist ein psychologisches und moralisches Desaster, ein Gefängnis
der sexuellen Repression, ein Tummelplatz der inkonsequenten moralischen
Unklarheiten, ein Museum des Besitzdenkens, eine Brutstätte der Schuldgefühle,
eine Schule der Selbstsucht".
-
Rita Süssmuth (Ehemalige Familienministerin):
"Familie kann in einem sehr weiten Verständnis, die Gruppe von
Menschen bezeichnen, die miteinander verwandt oder verschwägert sind,
gleichgültig, ob sie zusammen oder getrennt leben. Im engeren Sinn
wird Familie übereinstimmend als biologisch - soziale Gruppe von Eltern
mit ihren ledigen, leiblichen oder adoptierten Kindern verstanden".
-
Der Vorteil bei dieser Definition ist die Berücksichtigung verschiedener
familiärer Formen. Laut dieser Definition gab es 1988 8,6 Millionen
Familien in Deutschland.
-
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie
Diese Definition trägt dem institutionellen Aspekt von Familie
Rechnung. "Familie ist das verbindliche Zusammenleben von verschiedenen
Generationen in spezifischen als solche gesellschaftlich anerkannten Beziehungsformen,
wobei jeweils eine für die andere persönliche Verantwortung trägt".
-
Niederösterreichische Landesregierung:
Familien sind eheliche Lebensgemeinschaften, sowie Lebensgemeinschaften
oder Alleinerzieher mit ihren Kindern".
-
Brockhaus - Enzyklopädie:
"Familie ist das Elternpaar mit den unselbständigen Kindern als
Einheit des Haushaltes".
Die unterschiedlichen Definitionsansätze machen deutlich, daß
der Familien Begriff eigentlich gar nicht selbständig definiert wird,
sondern eher durch einen anderen ersetzt wird. Familien sind also:
1.) Ehen: (staatlich oder kirchlich geschlossen).
Die Reduktion der Familie auf die Ehe entspricht der konservativen Rechtsauffassung.
Ein wichtiger Vertreter dieser Position ist W. Rufner.
2.) Blutsverwandtschaftliche Verbindungen:
Diese Form der Definition von Familie stellt die Grundlage für
viele Entscheidungen dar. Kindergeld beispielsweise, wird nur für
leibliche Kinder gezahlt, egal wo sie wohnen. Die Verwandten werden ebenfalls
in die Berechnung mit einbezogen - auch wenn diese nicht im selben Haushalt
leben. Das gemeinsame Zusammenleben der Familienmitglieder ist hier nur
sekundär.
3.) Wirtschaftseinheiten von Privathaushalten mit Kindern:
In diesem Sinne bezeichnet man Familie als Elternpaare bzw. alleinstehende
Elternteile zusammen mit ihren im gleichen Haushalt lebenden ledigen Kindern.
Ob die Eltern miteinander verheiratet sind, eine intime Beziehung miteinander
haben, oder verwandt sind, interessiert bei dieser Definition nicht.
Die Art und Weise, wie man Familie definiert, bestimmt vor allem auch
welche Arten von Familien als abweichend oder normal betrachtet werden
und welche Rechte und Pflichten von rechtlichen und anderen sozialen Institutionen
anerkannt werden.
Warum jedoch ist es so schwierig "Familie" zu definieren?
Es gibt hier zwei Gründe als Antwort auf diese Frage:
1.) "Die Familie" gibt es nicht, nur verschiedene Ausprägungen
von Familien, und weiters sind die doch vorhandenen Definitionen abhängig
von gesellschaftlichen, ethnischen und strukturellen Bedingungen, von politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft, sowie
von der wirtschaftstheoretischen Ausrichtung.
2.) Jede Definition wird durch die Familie mitbestimmt und durch die
eigene Erfahrung geprägt. Familie kann somit folgendes bedeuten:
-
Zusammenhalt, Ehrlichkeit, Vertrauen, von anderen lernen (Schülerin,
16 Jahre);
-
Ein Platz an dem man immer wieder zurückkehren kann (Berufstätige,
17 Jahre);
-
Gemeinsam das Leben verbringen (Student, 20 Jahre);
-
Zwiespältig: einerseits Geborgenheit, miteinander reden, nach Hause
kommen können, kuscheln. Aber auch : Verantwortung tragen müssen,
Rücksicht nehmen, Konflikte mit Partner und Kindern, Chaos, Kampf
um Beziehung, Angst vorm Verlassen werden (Berufstätige, 23 Jahre);
Die eben genannten zwei Punkte sind also ausschlaggebend für die Definitionsprobleme.
Die Definitionen widersprechen sich, oder sind auf einen bestimmten Aspekt
reduziert. Auf diese Weise werden sehr viele quasi-familiale Lebensformen
wie Ein-Eltern-Familie, wilde Ehe, Wohngemeinschaft, Kommune, SOS-Kinderdorffamilie,
Pflegefamilie, Onkelehe, usw. ausgegrenzt.
Schließlich lassen sich jedoch doch noch Kennzeichen für
Familien finden, gleichgültig welcher Kultur sie angehören. Eine
Familie ist gekennzeichnet durch die biologisch - soziale Doppelnatur,
hat also eine biologische Reproduktions- und Sozialisationsfunktion. Außerdem
zeichnen sich Familien durch ein besonderes Kooperations- und Solidaritätsverhältnis
aus und durch ganz spezifische Interaktionsbeziehungen. Schließlich
wird noch das Vorhandensein von wenigstens zwei Generationen als letztes
Kriterium für Familien gefordert.
III.) Klassifikationsversuche und Einteilungsmöglichkeiten
für Familien:
1.) Allgemein gilt es zu differenzieren zwischen Familie als
Institution und Familie als gelebte Alltagswirklichkeit (= als konkreter
Familienalltag, als gelebte Beziehungen). Nach Wingen ist Familie als Alltagswirklichkeit
ein sehr dynamischer Prozeß. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen
dahingehend, welche konkreten in der Alltagswirklichkeit existierenden
Lebensformen zur Familie zu zählen sind. Bezüglich der Familie
als primäre Institution besteht dagegen weitgehende Einigung und sie
ist unter anderem durch Formen der gesellschaftlichen Anerkennung gekennzeichnet.
2.) Einteilung von Hoffman-Riem:
Hoffman-Riem unterscheidet Familien nach den vier Konstruktionstypen:
Kernfamilie, Adoptivfamilie, heterologe Insemination und Stieffamilie.
-
Die Kernfamilie besteht in der gemeinsamen biologisch - sozialen Elternschaft
und ist durch eine symmetrische Eltern - Kind - Beziehung charakterisiert.
Die Fünf Hauptfunktionen der Kernfamilie sind:
-
die Reproduktionsfunktion, daß heißt die Zeugung von Nachkommen.
Die Reproduktionsfunktion führt auf individueller Ebene zur Befriedigung
und auf gesellschaftlicher zur Sicherung des Personenstandes;
II.) die Existenzsicherung und Produktionsfunktion als Voraussetzung
für die Verfügbarkeit der Person im Produktionsprozeß (z.
B. Ernährung, Schutz, Gesundheit,...);
III.) die Regenerationsfunktion, die einerseits zu einer Krafterneuerung
und Selbstverwirklichung führt, andererseits dient sie der Wiederherstellung
der Produktionskraft;
IV.) die Sozialisation und Erziehungsfunktion und
V.) die Platzierungsfunktion, wobei es um die Verwirklichung von Bildungs-
und
Berufsinteressen geht, aber auch um die Erhaltung eines konkurrenzfähigen
Bestandes an
Arbeitskräften.
-
In einer Adoptivfamilie ist die Elternschaft getrennt. Die biologische
Elternschaft wird aufgegeben, die Soziale beginnt abrupt. Die Beziehung
der Eltern den Kindern gegenüber ist auch in einer Adoptionsfamilie
symmetrisch.
-
Bei heterologer Insemination ist die Elternschaft des Vaters abgegrenzt,
trotzdem wachsen beide Eltern gemeinsam in die Elternschaft hinein. Die
Eltern - Kind Beziehung könnte hier jedoch eventuell eine asymmetrische
Form annehmen.
-
In Stieffamilien liegt eine Verdoppelung der sozialen Elternschaft vor,
die für einen der beiden Elternteile sehr abrupt beginnt. Dies wiederum
bedingt eventuell eine asymmetrische Eltern-Kind-Beziehung.
Der Nachteil dieses Klassifikationsversuches besteht in einer zu engen
Systematik. Die Systematik erschöpft sich in den zwei Kategorien der
Elternschaft und impliziert dabei, daß Familie ohne Elternschaft
nicht vorstellbar ist. Zusätzlich werden wichtige Variablen des Erleben
wie Intensität oder Intimität der Beziehungen hier nicht berücksichtigt.
3.) Einteilung von Karpel und Strauß:
Karpel und Strauß unterscheiden verschiedene Bedeutungsvarianten
von Familien. Sie differenzieren zwischen der funktionalen Familie, der
rechtlichen Familie, der biologischen Familie, der Familie wie sie von
ihren Mitgliedern gesehen wird und schließlich der Familie mit längerfristigen
Verpflichtungen.
Die funktionale Familie wird durch die Art und Weise charakterisiert,
wie sie im täglichen Zusammenleben die praktischen Anforderungen des
Lebens, wie zum Beispiel die Haushaltsführung, die Kindererziehung,
oder die Freizeitgestaltung regelt.
Bei einer rechtlichen Familie werden die Bindungen vor allem von außen,
durch die Normen des Rechtssystems definiert.
Die Familie, wie sie von ihren Mitgliedern gesehen wird, bezieht sich
auf die subjektive Wahrnehmung der Familienmitglieder, wer als Familie
zugehörig erachtet wird und wer nicht.
Das Kennzeichen der Familie mit längerfristigen Verpflichtungen,
ist die Dauerhaftigkeit und Stabilität der wechselseitigen Bindungen.
Diese längerfristige Verpflichtung kommt auch sehr deutlich im Eheversprechen
"bis daß der Tod Euch scheidet" zum Ausdruck.
Die biologische Familie schließlich bezieht ihre Bindungen aus
der Tatsache der Blutsverwandtschaft.
Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Familie
ein sehr mehrdeutiger Begriff ist. Wie Familie definiert wird, hängt
von gesellschaftlichen, politischen, sowie kulturellen Bedingungen ab und
von der persönlichen Erfahrung innerhalb der eigenen Familie.
Eine Familie ist durch die biologisch - soziale Doppelnatur gekennzeichnet.
Sie zeichnet sich außerdem durch ein besonderes Solidaritäts-
und Kooperationsverhältnis aus, sowie durch ganz spezifische Interaktionsbeziehungen.
Das Vorhandensein von mindestens zwei Generationen wird als weiteres Kriterium
für Familien gefordert.
Die ursprüngliche Bedeutung von "Familie" war Diener beziehungsweise
das im Haus lebende Gesinde.
Die Familie ist der Gegenstand der Familienpsychologie. Diese behandelt
die Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Familie. Es geht ihr darum,
das Verhalten und Erleben von Personen in Beziehung zu ihrer Familie zu
erfassen.
Die familiäre Diagnostik und Intervention sind ganz besonders bedeutsame
Punkte innerhalb ihres Programmes.
Literaturverzeichnis
Beham, M. & Schramm, B. (1995). Familie und Arbeit - zwei eindeutig
mehrdeutige Begriffe?. In Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten (Hrsg.), Familie und Arbeitswelt, Wien:
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.
Petzold, M. (1992). Familienentwicklungspsychologie. Einführung
und Überblick, München: Quintessenz.
Schneewind, K. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
2) Familie im historischen Wandel (Corinna
Klein)
1. Einleitung
Früher hat sich die historische Familienforschung mit der Frage
von Entwicklungstrends beschäftigt und damit versucht, Abfolgen oder
Phasen in der Entwicklung der Familie zu finden. Heute ist man von den
Vorstellungen, daß es eine generelle Entwicklung gibt, abgekommen.
Das heißt aber auch, daß es unrichtig wäre allgemeine
Aussagen über die Lebensart der Familie in einer bestimmten
Epoche anzustellen.
Insofern kann man beim Aufdecken verschiedener Familiensysteme eigentlich
nur von Situationsbeschreibungen sprechen.
Genau in diesem Sinne möchte ich im folgenden einen Überblick
darüber geben, wie einzelne Familiensysteme ausgesehen haben können,
jedoch ohne den Anspruch zu erheben, daß gerade diese Form der Familienbeziehung
zu dieser Zeit die einzig mögliche war.
Trotz alledem ist aber das Wissen um die Bedingungen der Veränderung
von Familienformen aus vergangener Zeit, für die gegenwärtige
Familienforschung, eben für das Verständnis heutiger Handlungsformen,
von großer Relevanz.
2. Familienveränderungen unter verschiedenen Gesichtspunkten
2.1 Das Bild des Kindes im Wandel der Zeit
Man kann wohl behaupten, daß die Familie in dem Maße einem
tiefgreifenden Wandel unterliegt, als sich ihre innere Beziehung zum Kind
verändert.
Aus diesem Grund möchte ich gerne mit einem Überblick über
das Bild des Kindes im Wandel der Zeit beginnen. Nicht zuletzt deswegen,
weil man in diesem Zusammenhang Rückschlüsse auf das Familienleben
ziehen kann.
Ein italienischer Text gibt uns eine Vorstellung von der mittelalterlichen
Familie. Der Autor schreibt darin über die zu der damaligen Zeit herzlosen
Engländer. Es war damals in England üblich, Knaben und Mädchen
ab dem siebenten bis neunten Lebensjahr, in die Häuser anderer Leute
zu geben. Dort blieben sie dann bis zu ihrem 15. oder 16. Lebensjahr, zur
Verrichtung sämtlicher Hausarbeiten. Und wirklich es gab damals nur
wenige, die dieses Verfahren umgangen sind. Denn jeder, wie groß
sein Vermögen auch gewesen sein mag, schickte seine Kinder weg, um
selber andere bei sich aufzunehmen.
Während der Italiener diese Methode als grausam beschreibt, erklärten
die Engländer den Zweck mit dem Erlernen guter Manieren. Philippe
Aries meint, daß dieser Modus aber wahrscheinlich im gesamten mittelalterlichen
Westen üblich war.
Spätere Zeiten geben sogar, aufgrund zahlreicher, schriftlich vereinbarten
Verträge, Aufschluß über das Ausleihen von Kindern an Lehrherren.
Das heißt, das Kind damals lernte durch seine Erfahrungen, die sowohl
im Haushalt, im privaten Bereich als auch im Berufsleben gemacht wurden.
Dabei ist es wichtig anzumerken, daß es damals keine Trennung von
Privatem und Beruflichen im heutigen Sinne gegeben hat.
In jedem Fall wurde das Kind unter diesen Bedingungen sehr früh
aus der elterlichen Obhut entlassen. Man kann daher fast annehmen, daß
die historische Familie wohl kein Nährboden für eine tiefe Verbundenheit
zwischen Eltern und Kinder war. Die Wichtigkeit bestand eher im Hinblick
auf ein gemeinsames Schaffen und in der Absicherung der Familie.
Seit dem 15. Jhdt. begannen sich die Realitäten und die Empfindungen
gegenüber der Familie zu wandeln, nicht zuletzt auch durch die Ausdehnung
der Schulbildung. Was die Kindererziehung im Mittelalter durch Lehrherrn
war, übernimmt jetzt mehr und mehr die Schule. Diese Wende entspricht
damit auch dem neuen Bedürfnis nach Sittenstrenge seitens der Erzieher,
quasi um die Jugendlichen von der verderbten Welt der Erwachsenen fern
zu halten. Doch zugleich entsprach diese Entwicklung dem Bestreben der
Eltern ihre Kinder näher bei sich zu haben.
Doch hat sich diese Verschulung keineswegs auf die gesamte Bevölkerung
ausgedehnt. So wurden z. B. immer noch alle Mädchen nach wie vor gemäß
den alten praktischen Lehrverhältnissen erzogen, doch war das nicht
mehr unbedingt mit dem Eintritt in eine andere Familie verknüpft.
Was die Knaben betrifft, so ergriff die Schulbildung zunächst nur
der mittlere Teil der Standeshierachie. Der Hochadel und die Handwerksstände
blieben der alten Lehrzeit treu: die einen dienten weiter als Pagen, und
die anderen weiter als Lehrlinge.
Es ist die Rückkehr der Kinder in den Schoß der Eltern, das
dem 17. Jhdt. den wesentlichen Charakter verleiht. Das Kind wird zu einem
wichtigen Bestandteil des Alltaglebens, man beschäftigt sich vermehrt
mit seiner Erziehung, seiner Unterbringung und seiner Zukunft.
Diese Familie ist dennoch nicht zur modernen Familie zu zählen.
Sie unterscheidet sich durch das enorme Ausmaß an Sozialität.
So stellt die Familie in den großen Häusern ein Zentrum hierarchisch
organisierter gesellschaftlicher Beziehungen dar, an deren Spitze das Familienoberhaupt
steht. Ganz im Gegensatz zur modernen Familie, welche sich von der Welt
abkehrt und in der heutigen Gesellschaft eine kleine zurückgezogene
Gruppe von Eltern und Kinder darstellt. Auch besteht heute das Bemühen
um das Fortkommen jedes einzelnen Kindes. In diesem Sinne geht es oft mehr
um die Kinder, als um die Familie.
1762 veröffentlicht Jean-Jaques-Rousseau sein Traktat: "Emilie
oder Über die Erziehung". Er fordert darin eine neue Erziehung, eine
die den Menschen in seinem natürlichen Zustand als Menschen bewahrt.
Die Erziehung soll allein dazu dienen, die Anlagen der Kinder zu entwickeln,
sie endet auch nicht mit der Kindheit, sondern schließt die Jugend
bis zum Erwachsenenalter mit ein. Rousseau entdeckt die Kinder als eigenständige
Wesen, entdeckte ihre Gefühle und Bedürfnisse, und er forderte
Zuneigung und Liebe zu ihnen. (Rousseaus Werk ist später von Mallet
ziemlich kritisiert worden.)
Sieht man sich die Prozesse des Wandels in Eltern-Kind-Beziehungen im
Verlauf der europäischen Neuzeit an, differenziert man am besten nach
den Altersstufen der Kinder. Von den Trends der Familienzusammensetzung
kann man für die Kleinkindphase sagen, daß es vermehrt zu einer
Konzentration auf nur zwei Bezugspersonen gekommen ist. Denn es waren früher
vor allem Dienstpersonen oder auch ältere Geschwister, die zur Kindererziehung
herangezogen wurden und damit oft eine wichtige Figur neben oder anstatt
der Mutter darstellen. Der Vater hingegen war in der Vergangenheit in den
ersten Jahren von geringerer Bedeutung. Der engere Kontakt ergab sich oft
erst aus der Zusammenarbeit in der gemeinsamen Arbeitswelt aber auch da
betrifft er vor allem nur die Söhne. Demgegenüber ist es heute
zu einer Aufwertung der Vaterrolle im Kleinkindalter gekommen. Da die Anteilnahme
von Vätern an den Kleinkindern noch realtiv jung ist spricht Mitterauer
von einer "neuen Väterlichkeit".
Wie schon erwähnt war die klassische Kindererziehung durch das
Erlernen von Fähigkeiten vor allem durch das Mitleben und Mitarbeiten
geprägt. Damit orientierten sich natürlich auch die Erziehungsmethoden
an den selbst gerlernten. Es gab damals keine Alternativen. Neuentwicklungen
dieser Konzepte entstanden vor allem seit dem Zeitalter der Aufklärung.
Mit der Entwicklung der modernen Lohnempfängergesellschaft, damit
auch mit der Trennung von Familien- und Arbeitsleben hat sich die Erziehung
verändert. Doch so sehr die Vielfalt pädagogischer Erziehungsstile
individuellen Freiraum verschafft, so sehr kann es auch Verunsicherungen
und Orientierungslosigkeit zur Folge haben. Die Entwicklung der Schulbildung
stellt zweifelsfrei einen großen Fortschritt dar, bringt aber auch
Probleme mit sich, denn aufgrund der allgemeinen Schulpflicht findet ein
Eingriff in die elterliche Erziehung statt. Wobei Konformität dort
besteht, wo die Schule sichert, was das Elternhaus nicht bieten kann, wie
den sozialen Aufstieg durch Bildung, doch wird sie auch oft zum Belastungsfaktor
der Eltern-Kind-Beziehung. Es sind aber nicht nur die schulischen Leistungen
sondern auch die Wahl des Schultyps, der Druck, dem Kind die bestmöglichen
Chancen für eine berufliche Zukunft zukommen zu lassen, die immer
wieder ein Konfliktpotential darstellen.
In der alteuropäischen Zeit waren solche Probleme unbekannt.
Es hat sich aber auch im Bereich der Autonomie der Kinder gegenüber
den Eltern vieles geändert. Denn die Wahl des Freundeskreises, der
Freizeitgestaltung als auch der Partner wird heute fast ausschließlich
durch Selbstbestimmung getroffen. Die Konflikte, die sich daraus ergeben,
gehen dann meist in die Richtung eines Ablösungsprozesses der Kinder
von den Eltern.
Ein großer Unterschied liegt wohl in den genauen Grenzen, die
früher zwischen jugendlicher Abhängigkeit und erwachsender Selbstständigkeit
gezogen wurden, welche heute mehr und mehr an Schärfe verlieren. Aber
auch die Entwicklung hin zu individuellen Komunikationsmöglichkeiten
und Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung eines Weltbildes,
hat die Eltern-Kind-Beziehung zu einer besonderen Herausforderung herangewachsen
lassen.
2.2 Veränderungen der Rollenmuster
Wenn man äußerlich die Struktur der Familie im neuzeitlichen
Europa betrachtet, so läßt sich die Tendenz zur Reduktion familialer
Rollen feststellen. In der modernen Familie leben Vater, Mütter und
deren zumeist leibliche Kinder zusammen zum Unterschied zu der alteuropäischen
Gesellschaft, wo die Rollenvielfalt innerhalb einer Familie größer
war. Denn es lebten abgesehen vom Familienkern auch noch Eltern bzw. verwitwete
Elternteile (damit Großeltern), Geschwister, sonstige Verwandte,
Ziehkinder vor allem aber Gesinde in der Hausgemeinschaft.
Nicht richtig ist allerdings die Vorstellung, damit die Entwicklung
von der "Großfamilie" zur "Kleinfamilie" darzustellen. Familienforscher
halten die Annahme, im alteuropäischen Raum wäre das Zusammenleben
von zumindest drei Generationen bestimmt gewesen, nicht mehr aufrecht.
Denn wenn man die durchschnittlich mittlere Lebenserwartung bedenkt, muß
man zum Schluß kommen, daß viele Enkelkinder ihre Großeltern
nicht mehr gekannt haben. Wenngleich die historische Familie im Durchschnitt
mehr Personen umfaßten als heute, so war das nicht durch die Generationentiefe
bedingt.
Sicher aber ist, daß die Haushaltsgrößen im Verlauf
des 20.Jhdt. zurückgegangen sind.
Um diese gesamte Tendenz besser erfassen zu können, ist es sinnvoll
kurz auf die in ihrer Bedeutung zurückgetretenen Familienrollen einzugehen.
Seit dem Mittelalter in Europa hat sich zwar die Mehrzahl der jungen
Leute neolokal angesiedelt, die patrilokale Ansiedelungsform läßt
sich generell in zwei Grundtypen unterteilen.
Charakteristisch für den einen Typ ist, daß einer oder mehrere
Söhne früh heirateten und mit ihrer Gattin im elterlichen Haus
blieben, ohne daß der Vater seine Autoritätsposition übergab.
Der zweite Typus findet sich vor allem in der bäuerlichen Bevölkerung
in Mittel-, Nord- und Westeuropa. Dort darf nur ein im Haus bleibender
Sohn (nur in Ausnahmefällen eine Tochter) heiraten. Wobei hier die
Heirat dann im allgemeinen ziemlich spät erfolgt und mit einer Haus-
und Autoritätsübergabe im Zusammenhang steht. Das heißt
für die Eltern ins Ausgedinge zu ziehen und für eventuelle Geschwister
im Haushalt als Mägde oder Knechte zu dienen. Sie dürfen aber
nicht heiraten. Diese Formen der Familienführung basieren auf einer
Wirtschaftsform, die eben eine große Anzahl erwachsener Arbeitskräfte
erfordert. Durch die aufstrebende Lohnarbeit lösten sich dann solche
Familienformen vermehrt auf, weil dadurch Sondervermögen (nicht ererbtes)
zustande kam.
Die Trends neuer Haushaltsformen lassen sich sicher auch mit einer zunehmenden
Altersvorsorge und Individualisierung und damit mit einer zunehmenden Eigenständigkeit
der Generationen beschreiben.
Als Kontrast zwischen alteuropäischer und heutiger Familienzusammensetzung,
kommt dem damaligen Gesindewesen eine markante Bedeutung zu. Das Gesinde
lebt bei der Familie und läßt sich grundsätzlich in Produktionsgesinde
(Knechte, Lehrlinge,..) und Haushaltsgesinde unterteilen. Der Gesindestatus
ist im allgemeinen aber nur eine Durchgangsphase, die mit der Heirat abgeschlossen
wird.
2.3 Veränderungen in den Gattenbeziehungen:
Ein interessanter Blickpunkt stellt etwa die Alterskonstellation zwischen
den Eheleuten im Verlauf der Zeit dar. Bis ins 18. Jhdt. begegnet man sowohl
im städtischen wie auch im ländlichen Raum sehr häufig altersungleichen
Paaren. Der Grund dafür dürfte in den häufigen Wiederverehelichungen
liegen, welcher durch Verwitwung zustande kam. Man darf in diesem Zusammenhang
zweierlei nicht vergessen, nämlich daß Krankheiten, wie etwa
das Kindbettfieber den Verlust eines Familienmitgliedes schon in jungen
Jahren nach sich zog und, daß das Eheleben eine wirtschaftliche Notwendigkeit
darstellte, vor allem in den bäuerlichen Bevölkerungsgruppen.
Allgemein aber starben Frauen und Männer vor der Überwindung
der europäischen Seuchenwelle häufig schon in den mittleren Lebensjahren.
Seit dem 19. Jhdt. geht nicht nur die Zahl der Verwitwungen sondern
auch der Zwang nach Wiedervehelichung zurück.
Weiters war im alteuropäischen Raum auch die Möglichkeit einer
Scheidung nicht denkbar. Selbst dort wo es kirchenrechtlich möglich
gewesen wäre, kamen Scheidungen aus ökonomischen Zwängen
heraus, so gut wie nicht vor.
Es ist aber nicht verwunderlich, daß die später zunehmenden
Scheidungsraten gerade im städtischen Milieu ihren Anfang nahmen.
Dies mag einerseits an der Loslösung christlicher Vorstellungen, andererseits
an der Fortschreitung individueller Prozesse innerhalb der Familie liegen.
Ein weiterer Wandel innerhalb der Partnerbeziehung betrifft Veränderungungen
der Partnerwahl. In der historischen Familienforschung wird die Frage der
Entstehung der "Liebesheirat" stark diskutiert. So gibt es Historiker,
die das Aufkommen der romantischen Liebe, welcher allerdings keine genaue
Definition zukommt, mit der modernen Familie in Zusammenhang bringen. Dieser
Entwicklung geht sicher ein sehr langer Prozeß voraus. Denn man muß
nicht grundsätzlich annehmen, daß Ehen, die zu Beginn der Neuzeit
geschlossen wurden, unbedingt von den Eltern arrangiert wurden. Selbst
im Mittelalter wird es selbstbestimmte Ehen gegeben haben. Denn ausgehend
davon, daß die Lebenserwartung relativ niedrig, das Heiratsalter
aber relativ hoch war, lebten vielfach die Eltern bei der Eheschließung
ihrer Kinder nicht mehr. Abgesehen davon führte das Gesindewesen viele
Jugendliche weit weg von Zuhause, was die Mitsprache wohl auch sehr schwierig
gestaltet hätte. Mit starker Einflußnahme ist überall dort
zu rechnen, wo familienwirtschaftliche Strukturen vorherrschten, nicht
zuletzt gerechtfertigt dadurch, daß die ganze Familie davon betroffen
war.
Die "Liebesheirat" hat allerdings nicht nur mit der freien Partnerwahl
zu tun, sondern auch mit den Kriterien nach denen sie erfolgt. Denn auch
ein selbstgewählter Partner mußte nicht unbedingt die große
Liebe bedeuten, wie auch umgekehrt das elterliche Mitspracherecht nicht
unbedingt emotionale Beziehungen ausschloß. Aber natürlich haben
Faktoren wie Arbeitsfähigkeit, Besitz und Gesundheit eine entscheidende
Rolle gespielt.
Die "Liebesheirat" war damals eigentlich eine vom Bürgertum ausgehende,
sich dem Adel gegenüber emanzipierende, Vorstellung (wurde aber auch
dort weitgehend nicht realisiert). Es läßt sich aber die allgemeine
Entwicklungstendenz festhalten, daß die Rahmenbedingungen für
das Eingehen einer Ehe mehr und mehr emotional bestimmt waren.
Die heutige Vorstellung, daß die Ehe partnerschaftlich gestaltet
sein soll, ist eine neue Sichtweise, die sich parallel zu den Vorstellungen
der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen entwickelt hat.
In historischen Formen der Ehebeziehung war ein starkes Machtgefälle
zwischen Frau und Mann üblich. Aufgrund des Systems der Familienwirtschaft
kam dem Mann die Rolle der funktionalen Autorität zu. Dieser patriarchalisch
geführte Lebensstil hat mit der Ausbreitung der Lohnarbeit seine Notwendigkeit,
zumindest auf wirtschaftlicher Ebene, verloren. Aber auch die Kinderbetreuung
obliegt der heutigen Mutter nicht mehr im gleichen Maß wie den Frauen
früher.
Das heißt, die heutige Gesellschaft hätte im Vergleich zu
früher eher die Möglichkeit eine Gleichheit im Haushalt sowie
im Arbeitsleben anzustreben.
Es sind allerdings oft die übernommenen Rollenbilder von Mann und
Frau, die dieser Realisierung im Wege stehen. Sie sind damit zwar noch
immer gesellschaftlich bedingt, doch die Wurzeln stammen eigentlich aus
längst vergangen Zeiten.
3. Einige demographische Trends in Europa:
Charlotte Höhn zeigt im Handbuch der Familien- und Jugendforschung
Trends der Bevölkerungsentwicklung in Europa nach dem 2. Weltkrieg
auf.
Ausgehend vom deutschen Bundesgebiet schreibt sie über die interessante
Entwicklung der Bevölkerungszahlen, der Heirats-, Geburtenhäufigkeit
und schließlich auch über die Beobachtung der Sterblichkeit
in ganz Europa.
3.1. Bevölkerungszahlen:
Zwischen 1939 und 1950 gab es im deutschen Bundesgebiet einen Bevölkerungszuwachs
von rund 7 Millionen Menschen und das, obwohl im Krieg fast zwei Millionen
Menschen gestorben sind. Begründet wird dieser Zuwachs mit enormen
Wanderungsströmen in Europa.
Der österreichische Bevölkerungszuwachs hat sich in den Jahren
von 1950 bis 1985, von 6,9 auf 7,5 Millionen erhöht.
Macura und Malacic (1987) haben interessante Vorrausschätzungen
über Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2035 vorgelegt:
Anhand dieser Annahme erreicht die europäische Bevölkerung
im Jahr 2000 mit 512,3 Millionen ihren Maximalwert und sinkt danach bis
zum Jahr 2035 auf 450,9 Millionen ab.
3.2. Heiratshäufigkeiten:
Eine weitere wichtige demographische Veränderung ist der Rückgang
der Heiratshäufigkeit in den vergangenen 15 Jahren. Während man
bis 1960 davon ausgehen konnte, daß die meisten Menschen den Wunsch
hatten zu heiraten, konnte man kurz nach 1970 die ersten Einbrüche
feststellen.
Man könnte laut Statistik annehmen, daß im Europa der Zukunft
vielleicht mehr als 20% der Frauen und 25% der Männer unverheiratet
bleiben.
3.3. Scheidungsraten:
Die Anzahl der Scheidungen in Europa haben sich seit 1970 verdoppelt
bis verdreifacht.
In Österreich wurden um 1970 18% der Ehen 1985 dagegen schon 31%
der Ehen geschieden. Wir liegen mit diesen Raten im Mittelfeld der gesamteuropäischen
Scheidungen.
(Auch die heute so oft gelebte Probeehe schützt offensichtlich
nicht vor Scheidungen.
Interessant ist auch, daß die Scheidungshäufigkeit in solchen
Ländern, z. B. in Schweden, besonders hoch ist, wo es auch die meisten
nichtehelichen Lebensgemeinschaften gibt.)
3.4. Geburtenhäufigkeit:
Der Entwicklung der Geburtenhäufigkeit ab 1950 geht ein langfristiger
Prozeß voraus. Zum Beispiel kann man in Deutschland in der zweiten
Hälfte des 19. Jhdt. pro Ehe zirka 5 Kinder annehmen. Um 1900 sind
es dann 4 ab 1910 nur noch 3 Kinder und zwischen 1920 und 1950 schließlich
nur noch knapp mehr als 2 Kinder im Durchschnitt.
In Österreich haben sich die Geburtenziffern in den Jahren 1960
bis 1985 von 2,7 auf 1,5 Kinder pro Frau reduziert.
Es handelt sich hier um eine Entwicklung, die heute mehr oder weniger
in allen Industrieländern zu beobachten ist. Eine europäische
Ausnahme bildet Irland, welche 1985 immer noch eine Nettoreproduktionsziffer
von 1,19 aufweisen kann.
4. Persönliche Stellungnahme
Beenden möchte ich die Arbeit mit einem persönlichen kurzen
Gedankengang:
Es ist für mich keine Frage, daß ich lieber in der heutigen
Zeit lebe, als im Mittelalter. Doch ich schätze, daß wir uns
heute kaum eine Vorstellung darüber machen können, wie die Menschen
damals gefühlsmäßig gelebt haben. Ich meine damit im konkreten,
daß wir heute unser Hauptaugenmerk auf zwischenmenschliche Beziehungen
legen. Wir zeichnen uns heute durch ein ständiges Beobachten und damit
durch ein ständiges Bemühen nach Ausgleich unserer inneren Gefühlswelt
aus. Ich bezweifle aber, daß sich Menschen im Mittelalter solchen
Gedankenweisen hingeben konnten. Von der Annahme ausgehend, daß sich
auch damals die Menschen nicht absichtlich und selbstlos Schmerz zugefügt
haben, z. B. die Erziehung betreffend, liegt für mich der Schluß
nahe, daß es aus überlebensstrategischen Gründen, aus wirtschafltichen
Sicht, einfach nicht möglich war, ihr diesen, nach heutiger Sicht,
hohen Stellenwert zukommen zu lassen. Es scheint mir daher kein Leichtes,
die Geschichte der zwischenmenschlichen Interaktionen wirklich nachzuvollziehen.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Ariés, P. (1975). Geschichte der Kindheit. München:Carl
Hanser Verlag.
Mitterauer, M. (1989). Entwicklungstrends der Familie in der europäischen
Neuzeit. In R. Nave-Herz & M. Markefka (Hrsg.), Handbuch der Familien-
und Jugendforschung, Familienforschung (Bd. 1) (S. 179-209). Neuwied:
Luchterhand.
Petzold, M. (1992). Familienentwicklungspsychologie. Einführung
und Überblick (S. 11-17). München: Quintessenz.
Sekundärliterratur:
Mallet, C. H. (1987). Untertan Kind. Ismaning bei München:
Hueber.
Tabellen:
Bevölkerungsentwicklung:
| |
1980
|
2000
|
2010
|
2020
|
2025
|
2035
|
|
Europa
|
484,50
|
512,30
|
507,50
|
493,70
|
483,00
|
450,90
|
| Ost |
109,30
|
120,30
|
123,5
|
123,4
|
122,4
|
117,7
|
| Nord |
82,10
|
83,70
|
81,90
|
79,1
|
76,9
|
70,7
|
| Süd |
139,50
|
152,30
|
152,90
|
150,7
|
148,8
|
141,7
|
| West |
153,50
|
156,00
|
149,2
|
140,5
|
134,9
|
120,8
|
Heiratshäufigkeiten: von 1000 heiraten mindestens einmal
(Frauen, Männer):
| |
1965
|
1970
|
1975
|
1980
|
1985
|
| Männer |
923
|
854
|
731
|
690
|
637
|
| Frauen |
994
|
913
|
751
|
675
|
613
|
Ehescheidungen je 1000 Ehen:
|
1890
|
1904
|
1920
|
1930
|
1960
|
1970
|
1980
|
1985
|
|
0,7
|
1,1
|
3,2
|
3
|
3,6
|
5,1
|
6,1
|
8,6
|
Scheidungshäufigkeit in europäischen Ländern
von 100 Ehen werden geschieden:
| |
Dänem.
|
Schwed.
|
Engl.
|
Frankr.
|
Holland
|
Österr.
|
BRD
|
Schweiz
|
Belg.
|
|
1970
|
25
|
23
|
|
11
|
11
|
18
|
15
|
15
|
10
|
|
1985
|
46
|
45
|
39
|
31
|
31
|
31
|
30
|
30
|
26
|
Lebenserwartung in Westeuropa:
| |
Männlich
|
Weiblich
|
| |
1950
|
1970
|
1984
|
1950
|
1970
|
1984
|
| Österreich |
61,9
|
66,6
|
70,1
|
67,6
|
73,7
|
77,3
|
| Belgien |
65,2
|
67,8
|
70,0
|
70,3
|
74,2
|
76,8
|
| Frankreich |
63,6
|
68,3
|
71,3
|
69,3
|
75,8
|
79,4
|
| BRD |
64,6
|
67,4
|
70,5
|
68,5
|
73,8
|
77,1
|
| Holland |
70,6
|
70,8
|
73,0
|
72,9
|
76,8
|
79,7
|
| Schweiz |
66,4
|
70,2
|
73,1
|
70,9
|
76,2
|
79,7
|
Geburtenhäufigkeit im europäischen Vergleich:
|
Geburtenziffer
|
Nettoreproduktionsziffer
|
| |
1950
|
1960
|
1970
|
1985
|
1970
|
1985
|
| BRD |
2,1
|
2,4
|
2,0
|
1,3
|
0,95
|
0,60
|
| Belgien |
2,3
|
2,5
|
2,3
|
1,5
|
1,06
|
0,71
|
| Dänemark |
2,6
|
2,5
|
2,0
|
1,4
|
0,93
|
0,70
|
| Frankreich |
2,9
|
2,7
|
2,5
|
1,8
|
1,17
|
0,87
|
| Griechenland |
2,6
|
2,2
|
2,3
|
1,7
|
1,07
|
0,78
|
| Irland |
|
3,8
|
3,9
|
2,5
|
1,81
|
1,19
|
| Italien |
2,5
|
2,4
|
2,4
|
1,5
|
1,11
|
0,77
|
| Holland |
3,1
|
3,1
|
2,6
|
1,5
|
1,22
|
0,73
|
| Norwegen |
2,5
|
2,9
|
2,5
|
1,7
|
1,19
|
0,80
|
| Österreich |
|
2,7
|
2,3
|
1,5
|
1,07
|
0,70
|
| Portugal |
3,0
|
3,1
|
2,8
|
1,7
|
1,23
|
0,81
|
| Schweden |
2,3
|
2,2
|
1,9
|
1,7
|
0,92
|
0,83
|
| Schweiz |
2,4
|
2,4
|
2,1
|
1,5
|
1,00
|
0,72
|
| Spanien |
2,5
|
2,8
|
2,8
|
1,8
|
1,35
|
|
| Großbritannien |
2,2
|
2,7
|
2,4
|
1,8
|
1,15
|
0,86
|
EinwohnerInnen:
| |
1950
|
1970
|
1985
|
1950 bis 1970 (in %)
|
1970 bis 1985 (in %)
|
| BDR |
50,8
|
60,6
|
61,2
|
19
|
1
|
| DDR |
18,4
|
17,1
|
16,6
|
-7
|
-3
|
| Österreich |
6,9
|
7,4
|
7,5
|
7
|
1
|
| Schweiz |
4,7
|
6,3
|
6,3
|
34
|
0
|
| Frankreich |
41,7
|
50,7
|
54,6
|
22
|
8
|
| Belgien |
6,8
|
9,6
|
9,9
|
41
|
3
|
| Holland |
10,1
|
13
|
14,5
|
29
|
12
|
| Dänemark |
4,3
|
4,9
|
5,1
|
14
|
4
|
| Großbritannien |
50,6
|
55,5
|
55,6
|
10
|
0
|
| Schweden |
7
|
8
|
8,3
|
14
|
4
|
| Irland |
2,7
|
3
|
3,6
|
11
|
20
|
| Polen |
24,8
|
32,6
|
37,6
|
31
|
15
|
| Tschechoslowakei |
12,4
|
14,4
|
15,6
|
16
|
8
|
| Ungarn |
9,4
|
10,4
|
10,8
|
11
|
4
|
| Italien |
46,8
|
53,6
|
56,9
|
15
|
6
|
| Spanien |
27,9
|
33,8
|
39
|
21
|
15
|
| Portugal |
8,4
|
8,6
|
10,1
|
2
|
17
|
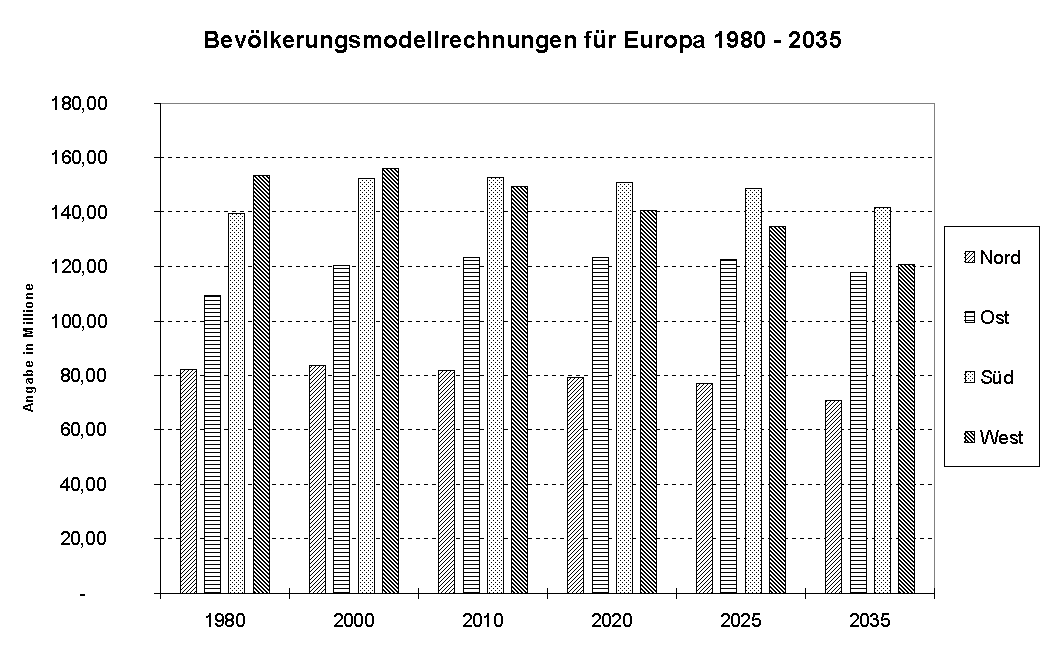
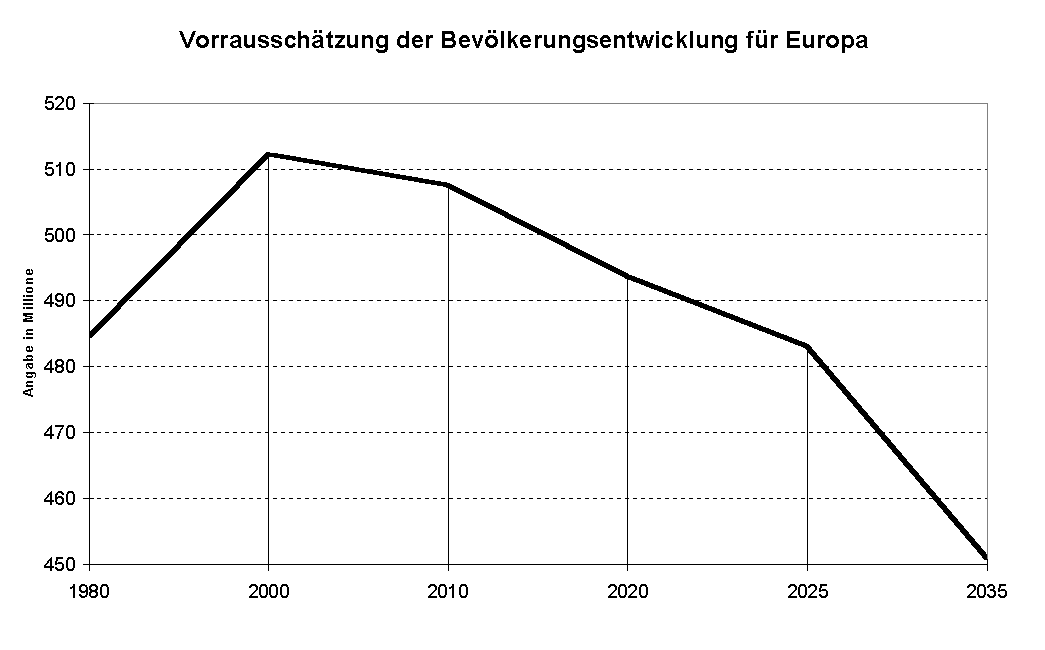

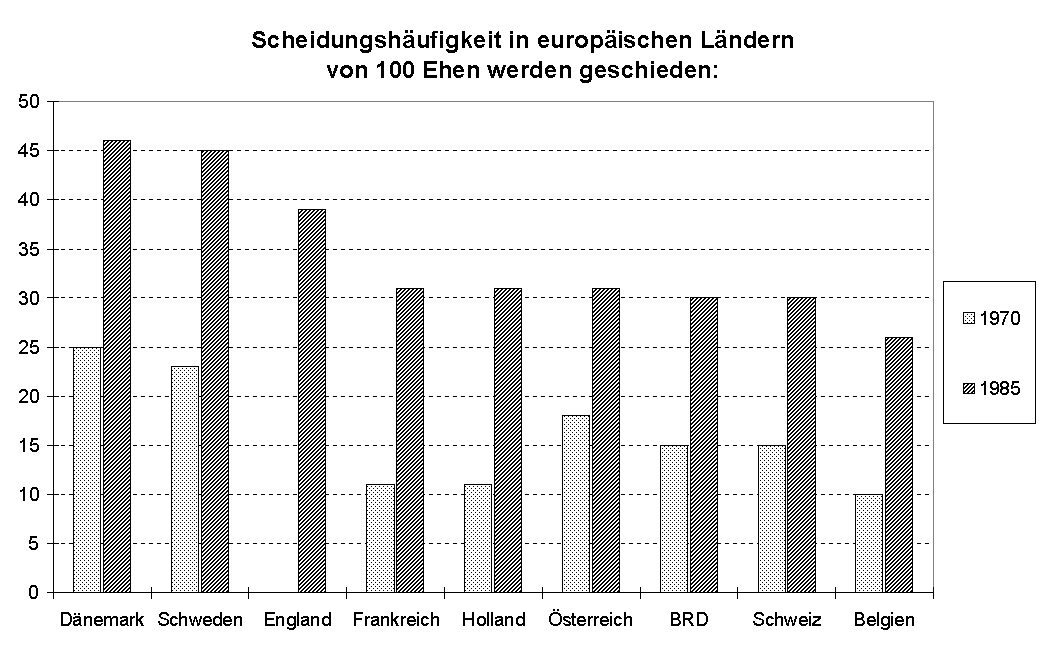
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
3) Aktuelle Trends der Institution Familie (Martina
Gustavik)
1. Einleitung
Wenn man die Institution Familie über die Jahrhunderte hinweg betrachtet,
dann stellt man fest, daß diese sich in ihrer Erscheinungsform gewandelt
hat und zwar hinsichtlich ihrer personalen Zusammensetzung, ihrer Entstehungsmodi,
ihres zeitlichen Ablaufs, der Funktionen, die sie erfüllt, sowie der
Art der Beziehungen, die zwischen ihren Mitgliedern herrscht. Diese Veränderungen
bzw. dieser Wandel fand statt aufgrund von unterschiedlich wirksamen gesellschaftlichen
Prozessen, wie zum Beispiel die Verstädterung, die auftretende Industrialisierung,
Säkularisierung, Demokratisierung etc.
2. Geschichtliche Entwicklung der Familie
Betrachtet man die Familie im 16. Jahrhundert, so findet man
viele unterschiedliche Familientypen, die sich an der beruflichen Zugehörigkeit
des Familienvorstandes orientieren. Die wesentlichen Merkmale dieser Familie
sind die große Anzahl der zu einer Familie gezählten Personen,
wobei dies auch nicht-verwandte Personen und das Hauspersonal bzw. Gesinde
miteinschließen kann; und eine hierarchisch innerfamiliale Struktur
an deren Spitze ein männliches Oberhaupt steht (Hausvater). Das Leben
der Frau beschränkt sich auf das Gebären von Kindern, deren Erziehung
und der Versorgung des Haushaltes. Der Wert des Kindes liegt vorwiegend
darin, zukünftiger Erbe, zukünftige Arbeitskraft oder Altersversorgung
der Eltern zu sein. Meist leben die Eltern bis zu ihrem Lebensende mit
zumindest einem ihrer Kinder zusammen.
In dieser Zeit gibt es kaum eine "Liebesheirat", da andere Faktoren,
wie zum Beispiel Besitz, Arbeitsfähigkeit und Gesundheit einen höheren
Stellenwert einnehmen.
Meist werden die Ehen schon von den Eltern arrangiert. Auch die eheliche
Sexualität dient nur der Zeugung von Nachkommen und nicht der emotionalen
Erfüllung der Partnerbeziehung. Weiters bestehen sehr oft große
Altersunterschiede zwischen den Eheleuten, nicht nur, daß der Mann
um einiges älter ist, sondern es kommt auch gelegentlich vor, daß
sich eine verwitwete ältere Frau einen jungen Mann zum Gatten nimmt.
Während dieser Zeit dominiert das Patriarchat, an dessen Spitze
der Mann als Hausvater der hierarchisch organisierten Familie steht und
die Frau sich mit der restlichen Familie diesem unterzuordnen hat. Es herrscht
auch eine streng geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die der gesellschaftlichen
Norm dieser Zeit entspricht.
Singelhaushalte gibt es nur selten.
Die Entwicklung der Familie in der Neuzeit ist gekennzeichnet
durch eine kleinere zur Familie gehörende Personengruppe, vor allem
durch den Wegfall des Gesindes, ein verändertes generatives Verhalten,
wie Geburten- und Familienplanung und geringere Kindersterblichkeit, durch
die Veränderungen der Beziehungen der Familienmitglieder zueinander,
durch selbstbestimmte Partnerwahl, tendenzieller Abbau patriarchalisch-hierarchischer
Beziehungen und veränderte Beziehung der Eltern zu ihren Kindern,
indem diesen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Besonders die Mutter als
Bezugsperson gewinnt an Bedeutung. Ein weiterer Punkt ist die Veränderung
der familialen Funktionen.
Diese Entwicklungen führen dazu, daß sich in der ersten Hälfte
unseres Jahrhunderts eine bestimmte Lebensform herauskristallisiert, und
zwar die "traditionell-bürgerliche" Kernfamilie, wo das exklusive
Zusammenleben der Eltern mit ihren Kindern vorherrscht. Dieses auch von
der Gesellschaft anerkannte und gelebte Modell findet seinen Höhepunkt
in den frühen 60er Jahren. Dies zeigt sich vor allem in einer
hohen Eheschließungszahl, einem niedrigen durchschnittlichen Heiratsalter,
einer hohen durchschnittlichen Kinderzahl pro Familie und einer niedrigen
Scheidungsrate. Es gilt als selbstverständlich zu heiraten und Kinder
in
die Welt zu setzen. Die Eltern versuchen einerseits eine auf eine romantische
Liebe aufbauende Partnerschaft zu führen und andererseits Verantwortung
für ihre leiblichen Kinder zu übernehmen und diese so gut als
möglich zu erziehen. Diese Familienform ist weiters gekennzeichnet
durch eine strikte geschlechtsspezifischen Rollen- und Aufgabentrennung.
Die Aufgabe des Mannes ist es, seine Familie zu erhalten und sie nach außen
hin zu repräsentieren. Parsons und Bales (1966, zitiert nach Wilk,
1995) bezeichnen ihn als den "instrumentellen" Führer, dem letztlich
die Verantwortung und Entscheidung über alle familialen Angelegenheiten
obliegt. Die Frau hingegen sehen sie als die "expressive" Führerin
an. Ihre Aufgabe ist es, die Kinder zu betreuen und zu erziehen und durch
die Pflege der innerfamilialen Beziehungen ein harmonisches Klima zu schaffen,
das heißt, ihre eigentliche Machtbefugnis beschränkt sich auf
Heim und Familie.
Auch die Erziehung der Kinder erfolgt geschlechtsspezifisch. Die Beziehung
zur Mutter ist eher gefühlsbetont, die zum Vater sehr respektvoll,
da er vorwiegend eine Autoritätsperson darstellt.
Die Basis der bürgerlichen Familie stellt also die Ehe dar, deren
Aufrechterhaltung dem Willen des Gatten unterworfen ist, wobei natürlich
auch die finanzielle Abhängigkeit der Frau das Auflösen der Ehe
erschwert und wenig wahrscheinlich macht.
Der Verlauf der Familie folgt meist dem "klassischen Familienzyklus:
Familiengründung durch Eheschließung, Erweiterung durch Geburt
mehrerer Kinder, Phase der Kinderaufzucht, Schrumpfung durch Auszug der
Kinder, leeres Nest, Auflösung der Familie durch Tod eines Ehepartners"
(Glick, 1947, zitiert nach Wilk 1995).
3. Gesellschaftliche Entwicklungstrends
Mit dem Beginn der 60er Jahre hat sich durch zahlreiche veränderte
gesellschaftliche Bedingungen sehr rasch das traditionell-bürgerliche
Bild der Familie gewandelt.
Insbesondere folgende Entwicklungstrends werden für Veränderungen
der Familie verantwortlich gemacht:
-
Individualisierungsprozeß
Es werden die traditionellen Geschlechterrollen in Frage gestellt.
Mann und Frau versuchen, sich ihr eigenes Leben aufzubauen und dieses zu
gestalten. Frauen erhalten mehr geistige und ökonomische Unabhängigkeit
durch erhöhte Bildungs- und Erwerbsbeteiligung und sie werden nicht
mehr nur auf ihre traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter reduziert.
-
medizinische Fortschritte
Diese erlauben eine Entkoppelung von Sexualität und Elternschaft,
indem man Schwangerschaften durch nahezu perfekte Kontrazeptionsmethoden
planen kann. Auch die erhöhte Lebenserwartung und niedrige Kindersterblichkeit
lassen sich auf eine bessere medizinische Versorgung zurückführen.
-
kulturelle Liberalisierung
Die Enttraditionalisierung führt zu einer Abnahme von allgemein
verbindlichen Normen und Werten und dadurch gleichzeitig zu erweiterten
Handlungsspielräumen und Freiheiten in nahezu allen Lebensbereichen,
auch im Bereich von Partnerschaft, Ehe und Familie. Traditionelle Bräuche
und Sitten verlieren ebenfalls an Gültigkeit. Natürlich kann
diese Loslösung von traditionellen Zwängen wiederum zu anderen
Krisen mit Bezug auf die Familie führen, die dadurch ständig
neuen Diskussionen und individuellen Dispositionen unterworfen ist.
-
zunehmende Optionserweiterung
Die fortschreitende Modernisierung, gekennzeichnet durch eine Pluralität
möglicher Handlungsorientierungen, hat dazu geführt, daß
für den einzelnen eine Vielzahl von Lebensentwürfen zur Wahl
steht und sich die Entscheidungen und Entscheidungszwänge in allen
gesellschaftlichen Bereichen vermehrt haben, wobei Entscheidungen meist
nur für einen zeitlich begrenzten Abschnitt Gültigkeit besitzen
und immer wieder neu getroffen werden müssen (Wilk, 1995, S.19).
Besondere Auswirkungen hat das auf die Gestaltung der Beziehung zwischen
den Geschlechtern, da nämlich die zunehmende Entscheidungsfreiheit
zwangsläufig zu einer Zunahme des Konfliktpotentials zwischen den
Partnern führt und es dadurch wiederum zu neuen Belastungen kommt.
-
extreme funktionale Differenzierung der Gesellschaft
Mit zunehmender Komplexität der Gesellschaft erfolgt die Zuweisung
einzelner Aufgaben an spezifische gesellschaftliche Bereiche. Familie hat
nicht mehr nur alleine große Bedeutung für das Individuum sondern
somit auch für die gesamte Gesellschaft. Von der Familie wird erwartet,
daß der ganze Mensch mit all seinen Wünschen, Fähigkeiten
und Schwächen Platz hat, daß nach dem Prinzip der Bedürftigkeit
und bedingungslosen Solidarität gehandelt wird und daß alle
emotionalen Bedürfnisse erfüllt werden.
4. Indikatoren familiären Wandels
4.1. Abnehmende Attraktivität der Ehe, Heiratsmüdigkeit,
steigendes Heiratsalter
Besonders in den letzten Jahrzehnten hat die Ehe an Attraktivität
verloren. Obwohl feste Partnerschaften als solche einen hohen Stellenwert
besitzen, spielt dagegen die Institution der Ehe zur Legitimierung der
Partnerschaft eine geringere Rolle. Gleichzeitig hat sich auch das Heiratsalter
erhöht, das heißt, daß die Ehe als Lebensform so lange
aufgeschoben wird wie möglich
Tabelle 1: Eheschließung und mittleres Heiratsalter in
den letzten 120 Jahren (nach Wilk, 1995, S.24)
|
Jahr
|
Eheschließungen auf 1000 Einwohner
|
Median Heiratsalter
männl., ledig
|
Median Heiratsalter
weibl., ledig
|
|
1871
|
8,9
|
-
|
-
|
|
1900
|
8,0
|
-
|
-
|
|
1920
|
13,3
|
27,5
|
25,2
|
|
1937
|
6,9
|
29,3
|
26,5
|
|
1951
|
9,1
|
26,8
|
24,4
|
|
1961
|
8,5
|
24,8
|
21,9
|
|
1971
|
6,4
|
24,4
|
21,7
|
|
1981
|
6,3
|
24,7
|
22,1
|
|
1986
|
6,1
|
25,7
|
23,3
|
|
1992
|
5,8
|
27,1
|
24,9
|
Anhand der Tabelle 1 sieht man, daß ab 1961 stetig das Heiratsalter
bei Männern und Frauen zunimmt, und gleichzeitig die Anzahl der Eheschließungen
abnimmt.
Einer der Gründe für diese Entwicklung ist sicher das kontinuierlich
anwachsende Ausbildungsniveau junger Frauen und die damit einhergehende
Erhöhung ihrer Erwerbsbeteiligung, die ihrerseits zu mehr finanzieller
Unabhängigkeit führt.
Die Heiratsmüdigkeit und das steigende Heiratsalter ist darauf
zurückzuführen, daß heute andere Partnerschaftsformen bevorzugt
werden.
Wenn heutzutage eine Eheschließung vollzogen oder geplant wird,
dann geschieht das meistens aus drei Gründen; erstens wegen einer
Schwangerschaft, zweitens aufgrund eines Wunsches nach Kindern und drittens
wegen des Vorhandenseins von Kindern (unter Umständen aus früheren
Partnerschaften).
4.2. Pluralität von Lebensformen
Die Lebensformen sind im Vergleich zur Situation um die Mitte dieses
Jahrhunderts wieder vielfältiger geworden. Die Wahl der Lebensform
beruht aber heute, im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen sie durch
soziale oder rechtliche Zwänge weitgehend vorbestimmt war, auf der
relativ freien Entscheidung des Individuums
Die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften haben an Bedeutung gewonnen.
Waren es früher hauptsächlich ältere Menschen oder geschiedene
Elternteile, die nicht-ehelich zusammenlebten, so sind es heute in der
großen Mehrheit jüngere Menschen. Die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft
hat sich deshalb von einer nachehelichen Beziehungsform zu einer vorehelichen
Lebensform gewandelt. Diese Ehe ohne Trauschein wird oft als "Ehe-auf-Probe"
oder als Vorform der Ehe angesehen, weil zumeist nach einigen Jahren doch
geheiratet wird, gerade dann, wenn man den Wunsch nach Kindern realisieren
möchte.
Eine andere häufige nicht-eheliche Beziehung stellt die "Rentnerehe"
dar, in welcher sich Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt bewußt
für eine gemeinsame Paarbeziehung entscheiden.
Daneben gibt es noch sogenannte Lebensabschnittspartnerschaften,
wonach jeder Mensch, egal ob alt oder jung, in verschiedenen Lebensphasen
andere intime Partner braucht.
Die Zahl der kinderlosen Lebensgemeinschaften hat in den letzten Jahren
zwar enorm zugenommen, so ist die Zahl jener Lebensgemeinschaften, in der
Kinder aufwachsen eher gering.
Es gibt noch eine Vielzahl von anderen Lebensformen.
Nach wie vor besteht die Familienform der traditionell-bürgerlichen
Kernfamilie. Diese stellt jedoch nicht mehr nur das einzig akzeptierte
Modell einer Kernfamilie dar.
Daneben gibt es das partnerschaftliche Modell, bei dem beide
Elternteile gleichberechtigt und gleichrangig sind. Im Idealfall gehen
beide Partner im gleichen Zeitausmaß einer Erwerbstätigkeit
nach und teilen die familiale Arbeit gerecht untereinander auf. Sowohl
Mann als auch Frau tragen beide zum Haushaltseinkommen bei und zu der Erziehung
und Betreuung der Kinder. Im Vordergrund steht dabei die partnerschaftliche
Beziehung zueinander und die intensive emotionale Beziehung zu den Kindern.
Die Familienform der Dreigenerationenfamilie findet man hauptsächlich
im ländlichen Raum. Diese ist auf die steigende Lebenserwartung durch
die ständigen medizinischen Fortschritte zurückzuführen.
Ein Vorteil ist, daß mehrere Bezugspersonen im familialen Haushalt
zur Verfügung stehen und sie sich bestimmte Aufgaben untereinander
aufteilen können. Andererseits kann es aufgrund der in einem Haushalt
lebenden unterschiedlichen Generationen zu Problemen kommen, wie zum Beispiel,
daß es schwer fällt, die zugeteilten Rollen zu akzeptieren.
Ein Großteil der Ein-Eltern-Familien sind Mutter-Kind-Familien,
nur ein geringer Teil sind Vater-Kind-Familien.
Familien mit nur einem Elternteil hat es als sogenanne "unvollständige
Familien" in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg viele gegeben.
Die Ursachen ihrer Entstehung haben sich allerdings verändert. Waren
es vor wenigen Jahrzehnten vorwiegend ledige Mutterschaft und Verwitwung,
so ist es heute in einem größeren Ausmaß neben lediger
Mutterschaft Scheidung und Trennung der Eltern. Natürlich ist die
ökonomische Situation von Ein-Eltern-Familien im Durchschnitt bedeutend
schlechter als jene in Zwei-Eltern-Familien.
Noch vor einigen Jahren wurde die Alleinerziehung von den meisten Menschen
abgelehnt, so besteht heute vor allem in Großstädten eine größere
Toleranz für Ein-Eltern-Familien. Die traditionelle Norm der Mutter-Vater-Kind-Familie
wird damit mehr und mehr in Frage gestellt.
Eine weitere Familienform stellen Stief- bzw. Fortsetzungsfamilien
dar. Entstanden früher Stieffamilien ausschließlich nach Verwitwung,
so entstehen diese Fortsetzungsfamilien heute dadurch, daß in eine
neugegründete Familie Teilfamilien aus einer wegen Scheidung oder
Tod eines bzw. einzelner Familienmitglieder zerbrochenen Familie eingebracht
werden. "Das klassische Beispiel ist die zweite Ehefrau eines Mannes, die
in ihre zweite Ehe noch eines oder mehrere eigene Kinder mitbringt" (Petzold,
1992, S. 36). Durch die Zunahme der Zahl der verwandtschaftlichen Bindungen
wird die Fortsetzungsfamilie zu einem äußerst komplexen System,
für das es meist keine klaren Abgrenzungen nach außen und keine
eindeutig vorgegebenen Rollen gibt, was wiederum zu einigen Problemen bei
der Gestaltung des familialen Lebens führen kann.
"Living-apart-together" ist eine Familienform, wo die Lebenspartner
nicht zusammenleben. Sie bezeichnen sich zwar als festes Paar mit intimen
Beziehungen, leben dennoch nicht zusammen in einer Wohnung. Die Gründe
für dieses "living-apart-together" können entweder bewußt
gewollt oder zum Beispiel zwangsweise beruflich bedingt (Arbeitsplätze
der Partner sind weit entfernt) sein. Auch Kinder können zu dieser
Art von Lebensform gehören.
Selten findet man auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern.
Es gibt durchaus einige homosexuelle Paare, die nach Beendigung einer bürgerlichen
Ehe mit ihren Kindern in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben.
Adoptivfamilien unterscheiden sich, abgesehen davon, daß
es sich nicht um die leiblichen Kinder handelt, nicht von einer Kernfamilie.
Pflegefamilien hingegen stellen rechtlich gesehen eine andere
Familienform dar, da sie als eine Familie auf Zeit bzw. Ersatz- oder Zweitfamilie
angesehen werden.
Wohngemeinschaften mehrerer Erwachsener mit Kindern findet man
eher selten.
Tabelle 2: Familientypen (nach Wilk, 1995, S.21)
|
Familientyp
|
1961
|
1971
|
1981
|
1993
|
| Familie mit Kindern |
1,283.754
|
1,312.215
|
1,369.012
|
1,454.500
|
| beide Eltern vorhanden |
1,024.538
|
1,087.756
|
1,111.736
|
1,163.800
|
| nur ein Elternteil vorhanden |
259.216
|
224.459
|
257.276
|
290.700
|
| Vater |
-
|
24.033
|
30.830
|
47.900
|
| Mutter |
-
|
200.426
|
226.446
|
242.800
|
| nichtledige Mutter (verw., gesch.) |
-
|
158.737
|
177.951
|
177.900
|
| ledige Mutter |
-
|
41.689
|
48.495
|
64.900
|
| Ehepaar ohne Kinder |
575.501
|
617.449
|
617.329
|
739.300
|
| Familie insgesamt |
1,859.255
|
1,929.664
|
1,986.341
|
2,193.800
|
Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, daß die Zahl der Familien insgesamt
in den letzten drei Jahrzehnten deutlich gestiegen ist. Auch die Zahl der
Paare ohne Kinder hat sich vor allem im letzten Jahrzehnt deutlich erhöht,
nämlich von 617.329 (1981) auf 739.300 (1993).
Es ist sehr interessant zu sehen, daß es 1993 fast doppelt so
viele Vater-Kind-Familien gab als 1971. Auch die Zahl der alleinstehenden
ledigen Mütter hat in diesem Zeitraum um 60% zugenommen.
4.3. Zeitlich begrenzte Dauer des Verweilens in einer Lebensform
(Zunahme der Scheidungshäufigkeit)
Familiale Lebensformen werden zunehmend nur über einen beschränkten
Zeitraum aufrechterhalten. Personen wechseln mehrfach in ihrem Leben von
einer Form zur anderen und durchlaufen dabei unterschiedliche familiale
und nicht familiale Lebensformen.
Ein Beispiel hiefür wäre eine Person, die,
nachdem sie ihre Herkunftsfamilie verlassen hat, einige Jahre als Single
lebt, dann für einige Zeit in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft,
der, nach der Geburt eines Kindes die Eheschließung folgt. Nach einigen
Jahren kommt es zur Scheidung und dem Leben in einer Ein-Eltern-Familie,
gefolgt von einer zweiten Eheschließung und der Bildung einer Fortsetzungsfamilie.
(Wilk, 1995, S. 24)
Dieser oftmalige Wechsel von Lebensformen führt zu einer Zunahme der
Scheidungs-häufigkeit und auch der Wiederverheiratung.
Tabelle 3: Entwicklung der Ehescheidungen (nach Wilk, 1995, S.25)
| Jahr |
Ehesch. auf 1000
EW |
Gesamtscheidungsrate |
|
|
1951
|
1,5
|
17,7
|
|
1961
|
1,1
|
13,8
|
|
1971
|
1,3
|
17,8
|
|
1981
|
1,8
|
26,5
|
|
1986
|
1,9
|
29,5
|
|
1992
|
2,1
|
33,7
|
Die Zahl der Scheidungen hat seit 1961 kontinuierlich zugenommen, wie aus
Tabelle 3 ersichtlich ist. So betrug die Gesamtscheidungsrate in Österreich
1961 13.8%, 1992 hingegen 33,7%. Das bedeutet, daß eine von drei
heute eingegangenen Ehen in einer Scheidung enden wird. Die meisten Scheidungen
erfolgen nicht nach jahrzehntelanger Ehedauer, sondern schon in den ersten
10 Ehejahren (Der Durchschnitt liegt bei 5 Jahren). Die Ehescheidungen
häufen sich bei Paaren ohne Kinder (ca. ein Drittel der geschiedenen
Ehen ist kinderlos).
Die Folgen von Ehescheidungen sind besonders für minderjährige
Kinder sehr gravierend und krisenbehaftet.
4.4. Geburtenrückgang
In Österreich, wie auch in allen anderen industrialisierten Ländern,
ist der Trend zu verzeichnen, daß weniger Kinder geboren werden.
Tabelle 4: Geburtenrate (nach Wilk, 1995, S. 26)
|
Jahr
|
Lebendgeborene auf 100 EW
|
|
1900
|
31,3
|
|
1920
|
22,7
|
|
1937
|
12,8
|
|
1951
|
14,8
|
|
1961
|
18,6
|
|
1963
|
18,8
|
|
1971
|
14,5
|
|
1981
|
12,4
|
|
1986
|
11,5
|
|
1992
|
12,1
|
Aus Tabelle 4 ist ablesbar, daß die Geburtenrate in den letzten drei
Jahrzehnten stark abgenommen hat; der leichte Aufwärtstrend, der seit
1986 zu verzeichnen ist, ist fast ausschließlich auf die hohe Zahl
der Geburten von Zuwanderern zurückzuführen.
Die Geburtenhäufigkeiten bleiben deutlich unter den Vorstellungen
einer idealen Kinderzahl. Ca. 60% der Österreicher sehen zwei und
33,5% drei oder mehr Kinder als die ideale Kinderzahl an. Die durchschnittliche
Kinderzahl bezogen auf alle Familien beträgt in Österreich zur
Zeit ca. 0,86, jene bezogen auf alle Familien mit Kindern 1,75. 1971 lag
letztere noch bei 2,0.
Mögliche Gründe für den Geburtenrückgang könnten
sein: eine stark verringerte eheliche Fruchtbarkeit, eine abnehmende Zahl
junger verheirateter Paare infolge einer geringeren Eheschließungshäufigkeit,
anwachsende Scheidungszahlen, Trend erst später im Leben eine Familie
zu gründen, finanzielle Belastung und die bewußte Entscheidung
kinderlos zu bleiben.
Meist liegt es an der Frau sich für Beruf oder Kinder zu entscheiden.
Viele Frauen versuchen dabei Kompromisse einzugehen und haben im Prinzip
drei Möglichkeiten. Sie können (1) die Doppelbelastung in Kauf
nehmen, (2) die Entscheidung ein Kind zu bekommen aufschieben (Deswegen
steigt zum Beispiel auch das durchschnittliche Alter der Erstgebärenden
an.) und (3) nach der Geburt des Kindes schneller in den Beruf zurückkehren.
Besonders die letzten beiden Möglichkeiten haben zum Geburtenrückgang
beigetragen.
Die sinkende Geburtenrate hat gesamtgesellschaftlich dazu geführt,
daß sich die Altersverteilung in Zukunft noch stärker verändern
wird und daß sich gleichzeitig auf längere Sicht gesehen die
Anzahl der Bevölkerung verringern wird. Immer weniger Kinder stehen
einem größeren Anteil älterer und alter Menschen gegenüber,
das heißt, immer weniger junge Leute müssen für die Altersversorgung
von immer mehr alten Menschen aufkommen. Auch bedeutet die geringere Anzahl
von Kindern in einer Familie für die Kinder selbst eine Einschränkung
vor allem der gleichrangigen Interaktionsmöglichkeiten (Kind-Kind),
aber gleichzeitig erhält das Einzelkind mehr Aufmerksamkeit, Zeit
und Zuneigung von seinen Eltern.
4.5. Verändertes Selbstverständnis der Frauen bzw. neue
Lebensperspektiven von Frauen
Die Lebensperspektive von Frauen hat sich entscheidend verändert.
Frauen haben heute aufgrund der steigenden Bildung und besseren Ausbildungsmöglichkeiten
wesentlich bessere Chancen im Beruf als früher, das heißt, sie
beteiligen sich vermehrt am Erwerbsleben und sind dadurch auch unabhängiger.
Leider kann man gerade im Berufsleben noch nicht von realer Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau sprechen, da es noch immer zur Diskriminierung der
Frau kommt (Bsp. weniger Geld für gleiche Arbeit etc.).
Einerseits wollen Frauen ihre stärkere Bildungsbeteiligung und
ihre erhöhte Berufsqualifikation auch in einem tatsächlich ausgeübten
Beruf umsetzen, aber andererseits wollen sie nicht auf die Elternschaft
verzichten. Somit ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales
Anliegen für viele Frauen. Der Wiedereinstieg in das Berufsleben nach
dem Heranwachsen der Kinder, das heißt, wir nehmen an, eine Frau
würde 15 Jahre ihres Lebens nur der Kindererziehung widmen, ist so
gut wie unmöglich und aussichtslos. Dadurch wird auch vermehrt die
Doppelbelastung in Kauf genommen.
In Österreich sind mehr als die Hälfte der Mütter von
Familien mit Kindern außerhäuslich erwerbstätig. Trotz
ihrer Erwerbstätigkeit wird die Familien- und Hausarbeit kaum partnerschaftlich
aufgeteilt. Die Hauptbelastung trägt nach wie vor die Frau, der Mann
beteiligt sich daran nur am Rande.
4.6. Ökonomische Benachteiligung von Familien mit Kindern
Die relative ökonomische Benachteiligung von Familien mit Kindern
hat sich über die Zeit hinweg wenig geändert. Es ist diesen Familien
mit Kindern zwar möglich gewesen an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung
teilzunehmen, der relative Abstand der Einkommenssituation von Ehepaaren
mit Kindern im Vergleich zu Ehepaaren ohne Kinder hat sich jedoch kaum
verringert. Das Großziehen von Kindern bedeutet eine enorme finanzielle
Investition oder im Vergleich zu kinderlosen Paaren eine massive Wohlstandseinbuße.
Desto mehr Kinder zu versorgen sind, desto weniger finanziellen Spielraum
haben die Familien. Der Augsburger Wirtschaftswissenschaftler Lampert (1989,
zitiert nach Schneewind & Rosenstiel 1992, S. 19) beziffert für
ein Ein-Verdiener-Ehepaar, das 1979 sein erstes und 1981 sein zweites Kind
bekommen hat, den Einkommensverzicht dieser Familie bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem die Kinder 18 Jahre alt sind, auf rund DM 712.000,- (Das sind ca.
ÖS 5,000.000,-).
4.7. Eltern-Kind-Beziehung
Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten in Richtung einer partnerschaftlichen
Beziehung entwickelt. Das Kind wird von den Eltern zunehmend als eine eigenständige
Persönlichkeit anerkannt. Gerade die hohe Emotionalität ist kennzeichnend
für diese neue Eltern-Kind-Beziehung. Besonders Väter wollen
nicht mehr nur als Autoritätsperson angesehen werden, sondern lieber
als Freund und Partner ihrer Kinder. Deshalb versuchen Väter sich
mehr mit ihren Kindern zu beschäftigen und gemeinsam mit diesen ihre
Freizeit zu gestalten. Die meiste Alltagsarbeit bleibt aber immer noch
an den Müttern haften. Eltern versuchen also vermehrt ihre Kinder
ganz bewußt in die Lebensgestaltung miteinzubeziehen. Dieser neue
partnerschaftlich orientierte Umgang mit den Kindern scheint von dem Bildungsgrad
der Eltern und von der Region, in der sie wohnen abhängig zu sein.
Auch haben Kinder eine ganz zentrale Bedeutung für ihre Eltern, nämlich
emotionale, erfahrungsbereichernde und sinnstiftende Bedeutung. Kinder
vermitteln Eltern das Gefühl, gebraucht zu werden und tragen mitunter
zur Selbstverwirklichung der Eltern bei. Immerhin ist es für ca. 42%
aller Österreicher die größte Freude im Leben mitanzusehen,
wie Kinder heranwachsen.
5. Zusammenfassung
Die Familie hat sich seit dem letzten Jahrhundert einigen Veränderungen
unterwerfen müssen, woraus sich schließlich aufgrund zahlreicher
sozialer Wandlungsprozesse ein als Ideal geltendes Modell herauskristallisierte,
nämlich das der "traditionell-bürgerlichen" Kernfamilie.
Doch seit den 60er Jahren zeichnete sich erneut ein Wandel der Familie
ab. Es entwickelten sich viele unterschiedliche und neue Familienformen,
zum Beispiel nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, das Modell des "living-apart-together",
Fortsetzungsfamilien etc.
Heute macht sich der Trend bemerkbar, daß familiale Lebensformen
zunehmend nur mehr zeitlich begrenzt aufrecht erhalten werden. Das ist
besonders deutlich anhand der steigenden Scheidungszahlen und dem vermehrten
Wechsel von einer Lebensform in die andere.
Auch in der Beziehung zwischen den Eltern zueinander und zu den Kindern
macht sich ein Wandel bemerkbar. Die Beziehung ist vorwiegend partnerschaftlich
orientiert und geprägt von starker Emotionalität. Nach einer
Umfrage stellen Familien heute für viele Österreicher den wichtigsten
Lebensinhalt dar.
Die Familie ist nach wie vor eine fundamentale Erfahrung. Besonders
hoch wird ihre Erziehungs- und Sozialisationsleistung gewertet, aber auch
ihr Beitrag zur Identitätsbildung, zur Begründung von Sozialität,
zur Konstituierung von Kultur, zu emotionaler Fundierung, Stabilisierung
und Motivation. (Kaufmann, 1988 bzw. Lüscher, 1988, zitiert nach Schneewind
& Rosenstiel, 1992, S. 60)
6. Persönliche Stellungnahme
Für mich spielt die Familie eine ganz wesentliche Rolle. Gerade
in unserer leistungsorientierten Welt ist es wichtig, einen Ort zu haben,
an den man sich zurückziehen kann, um sich zu erholen und sich geborgen
zu fühlen. Eine Familie gibt einem sehr viel Sicherheit und Halt und
bringt sehr viel Verständnis auf. Man wird darin als ein eigenständiges
Individuum angesehen und wird von ihr trotz möglicher Fehler und Probleme
aufgenommen.
Doch leider kommt es allzu oft vor, daß man vor der Entscheidung
steht, entweder eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu
setzen oder Karriere zu machen. Diese Entscheidung sollte einem eigentlich
erspart bleiben. Auch sollte der Staat die Gründung von Familien und
deren Fortbestehen fördern, doch er erreicht durch ständige Kürzungen
der Familienunterstützungen (Bsp. niedrigere Kinderbeihilfe, Geburtengeld,
etc.) genau das Gegenteil. Das könnte in einigen Jahren noch zu gravierenden
Problemen führen, da dann wahrscheinlich nicht mehr genügend
junge Leute vorhanden sind, um das Bevölkerungswachstum aufrecht und
die vielen älteren Menschen zu erhalten.
Ich glaube, es ist nötig, daß hier ein Umdenken stattfindet
und daß den Familien das Leben "erleichtert" wird (zum Beispiel durch
mehr Betreuungsstätten für Kinder, mehr Teilzeitarbeit für
Mütter und Väter etc.).
Literaturverzeichnis
Petzold, M. (1992). Familienentwicklungspsychologie. Einführung
und Überblick. München: Quintessenz.
Schneewind, K. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Schneewind, K. & Rosenstiel, L. v. (Hrsg.). (1992). Wandel der
Familie. Göttingen: Hogrefe.
Wilk, L. (1995). Familie in Österreich - gestern und heute. In
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (Hrsg.),
Familie
und Arbeitswelt. (S. 13-34). Wien: Bundesministerium für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
4) Familienpsychologische Theorien (Tanja
Kremser)
Einleitung
Die Familienpsycholgie beschäftigt sich einerseits mit der Entwicklung
der Familie als eine Gruppe von Personen besonderer Art und andererseits
mit der Entwicklung in der Familie. Der psychologische Familienbegriff
definiert die Familie als intime Bezugssysteme, die im Laufe der Zeit Veränderungen
unterworfen sind. Mit Ursachen, Bewältigung und Folgen solcher Veränderung
beschäftigen sich familienpsychologische Theorien. Die meisten Autoren
- wie z. B. Schneewind (1991) und Petzold (1992) - meinen, daß es
die
Familientheorie schlechthin nicht gibt, sondern vielmehr mehrere Forschungsansätze
nebeneinander existieren. Über diese Modelle möchte ich einen
Überblick geben. Es sind dies a) die Familiensystemtheorie, b) die
Familienentwicklungstheorie, c) die Familienstreßtheorie und d) das
integrative Modell der Familienentwicklung, das versucht die obengenannten
Theorien miteinzubeziehen.
Theorien
Die Familiensystemtheorie
Die Familiensystemtheorie leitet sich aus der allgemeinen Systemtheorie
ab, die ein System als "einen Komplex interagierender Elemente" (Bertalanffy,1968,
zitiert nach Schneewind,1991) definiert. Ein Familiensystem wird als eine
besondere Gruppe von Personen betrachtet, zwischen denen Beziehungen bestehen.
Die Familienmitglieder etablieren und halten diese Beziehungen durch Kommunikation
aufrecht.
Im folgenden werden wichtige Punkte der Familiensystemtheorie genannt,
die auch für die Familientherapie bedeutsam sind.
Die Familie ist eine Einheit, deren Mitglieder durch Kommunikation miteinander
vernetzt sind (Ganzheitlichkeit). Die Familie als Ganzes wird mehr
betrachtet als die Summe ihrer aus Personen bestehenden Teile. Bestimmte
Probleme werden nicht als individuelle, sondern als systemisches Probleme
betrachtet.
Ziele geben dem Leben Sinn und Kontinuität. Je nach Lebens- bzw.
Familienphase unterscheiden sich diese Ziele (Zielorientierung).
Bestimmte Regelhaftigkeiten sind bei den Beziehungen zwischen
den Familienmitgliedern erkennbar. Darunter fallen Familienrituale, die
bewußt gepflegt werden, aber auch solche, die unausgesprochen das
Verhalten einzelner Familienmitglieder beeinflussen. Das Interaktionsgeschehen
in der Familie weist eine sogenannte zirkuläre Kausalität
auf. Darunter versteht man den wechselseitigen Beeinflussungsprozess mehrerer
Personen über eine gewisse Zeitspanne hindurch. Rückkoppelung
wird durch regelabweichendes Verhalten eines bestimmten Familienmitgliedes
ausgelöst und ruft Effekte bei den restlichen Familienmitgliedern
hervor, die wiederum das Verhalten jenes einen Mitgliedes beeinflussen.
Positive Rückkoppelung ist veränderungsorientiert; negative ist
stabilitätsorientiert und versucht die Ausgangslage wiederherzustellen.
Unter Homöostase wird die Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichtes
in der Familie genannt, die durch negative Rückkoppelung erreicht
wird. Die Familie orientiert sich an etablierten Zielen, Regeln und Handlungsabläufen.
Familien mit starren Regeln versuchen auch unter veränderten Bedingungen
ihre bisherige Lebensform beizubehalten. Den jeweiligen Gegebenheiten können
sich Familien mit flexiblen Regeln anpassen, indem sie neue Regeln festsetzen.
Solche Familien gelangen leichter von einem relativ stabilen Zustand wieder
in einen stabilen. Speer führte 1970 dafür den Begriff der Morphogenese
ein, mit dem die Entwicklung neuer Strukturen innerhalb eines Familiensystems
gemeint ist. Welche Art von Veränderung eine Familie durchläuft,
hat die Unterscheidung in Wandel erster und zweiter Ordnung zur
Folge. Veränderungen von einem internen Zustand zu einem anderen
innerhalb eines invariant bleibenden Systems sind Wandel erster Ordnung.
Wandel zweiter Ordnung ändern das System selbst.
Die Familie als System grenzt sich anderen Systemen gegenüber
unterschiedlich ab. Die Familiensystemtheorie unterscheidet einerseits
Suprasysteme, in denen die Familie eingegliedert ist, andererseits kann
die Familie in Subsysteme unterteilt werden. Die Grenzen zwischen diesen
Systemen sind unterschiedlich stark ausgeprägt: starr, diffus oder
und klar.
Starre Grenzen finden sich in der Realität kaum, da es zu keinem
Austausch mit anderen Systemen kommt. Am ehesten sind damit Familien gemeint,
die nichts von sich preisgeben und sich anderen gegenüber verschließen.
Bei diffusen Grenzen kann jeder zu jeder Zeit mit anderen in Kontakt treten.
Es wird kaum zwischen den Systemen unterschieden. Allerdings leidet die
Privatheit des einzelnen darunter. Klare Grenzen gestatten ein gewisses
Maß an Durchlässigkeit, wehren Einmischung von außen aber
gleichzeitig ab.
Das interne Erfahrungsmodell meint die subjektiven Repräsentationen,
die sich eine Person von sich, den Familienmitgleidern und den Beziehungen
untereinander macht.
Der systemische Ansatz bezieht sich nicht nur auf die Familiensystemtheorie,
sondern findet sich auch in anderen Modellen wieder.
Die Familienentwicklungstheorie
entstand im anglo-amerikanischen Sprachraum. Vertreter sind vor allem
Familiensoziologen, wobei der Familienzyklus in den Mittelpunkt ihrer Theorie
steht. Duvall (1977) versteht unter Familienzyklus eine Abfolge von charakteristischen
Stufen, die mit der Familienbildung beginnen und sich über die Lebensspanne
der Familie bis zu ihrer Auflösung fortsetzen.
Die Veränderung der Zahl der Familienmitglieder, der Entwicklungsstand
des älteren Kindes und das Ausscheiden der Haupterwerbsperson aus
dem Berufsleben sind Kriterien für die Familienstufenbildung. Die
Familienentwicklungstheorie betrachtet die Familie als ein System von Rollenträgern.
Die Familienmitglieder nehmen bestimmte Positionen im Familiensystem ein,
denen bestimmte Rollen zugeordnet sind. Mehrere Rollen ergeben ein Rollenmuster,
woran wiederum Erwartungshaltungen geknüpft sind. Mit dem Durchlaufen
des Familienzyklus kommt es zu Veränderungen in der Zusammensetzung
verschiedener Rollen (positionelle Karriere) und zu Änderungen des
Rollenkomplexes (Familienkarriere). Neben den Familienstufen und -rollen
gibt es auch Familienentwicklungsaufgaben, normative Erwartungen an die
Familieneinheit, die für den einzelnen oder die Gesellschaft erfüllt
werden müssen. Die Formulierungen der Aufgaben erfolgt mit Einbeziehung
der Familienstufen. Der Übergang von einer Familienstufe zur nächsten
ist mit einer Änderung der Familienentwicklungsaufgaben verbunden:
alte werden abgelegt, neue kommen hinzu. Diese Veränderung ist vergleichbar
mit dem Wandel zweiter Ordnung in der Familiensystemtheorie. Manche Familien
haben Probleme, die nächste Stufe im Familienentwicklungsprozeß
zu erreichen und benötigen Hilfe, z. B. bei Abnabelungsprozessen der
Kinder. Sowohl die Eltern-Kind-Beziehung als auch die Beziehung der Eltern
zueinander muss neu definiert werden.
Kritik an der Familienentwicklungstheorie:
Das Modell von Duvall war zwar sehr wichtig für die weitere Familienforschung
- die Familie wird nicht als etwas Statisches betrachtet, sondern als sich
verändernd.
Allerdings beschreibt Duvall die normative Familie, die Kernfamilie.
Nicht-normative Lebensereignisse wie Tod, Scheidung oder chronische Krankheiten
bleiben unberücksichtigt. An dieser Stelle sei aber McGoldrick und
Carter (1988) erwähnt, die Entwicklungsaufgaben für alleinerziehende,
alleinlebende und wiederverheiratete Elternteile definiert haben.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, daß die Familienentwicklungstheorie
eigentlich keine richtige Theorie ist, sondern nur Phasen beschreibt.
Weiters gibt es über die Anzahl der Familienentwicklungsstufen
Uneinigkeit. So geht Duvall von 8 Stufen aus, McGoldrick und Carter dagegen
von 6 Einheiten der Familienentwicklung.
Ebenso unklar ist man sich über jene Ereignisse, die zu Veränderungen
in der Familie führen. Einige Autoren gehen davon aus, daß es
die Familienentwicklungsaufgaben sind, die zu Veränderungen führen,
andere Autoren nennen Krisen als positive Chance zur Weiterentwicklung.
Die Familienstreßtheorie
enstand ebenfalls im anglo-amerikanischen Sprachraum und beschäftigt
sich mit der Frage, wie die Familie mit Streß, Krisen oder Belastungen
umgeht.
Hill (1949) untersuchte sowohl die Folgen der Weltwirtschaftskrise als
auch die der Trennung und Wiedervereinigung der Familien um den 2. Weltkrieg
und entwickelte ein Familienkrisenmodell:
ABCX-Modell: Das Stressorereignis A - Stressoren sind streßauslösende
Ereignisse, die zu Veränderungen in der Familie führen (können)
- steht in Interaktion mit B - den Krisenbewältigungsressourcen der
Familie, in Interaktion mit C - Definition der Familie vor dem Ereignis
- und erzeugt die Krise X (Hill, 1958).
Wie die Familie damit umgeht, zeigt sein Phasenmodell zur Bewältigung
von Familienstreß. Der krisenauslösende Stressor führt
zuerst zu einer Phase der Desorganisation, dann zu einer Erholungsphase.
Je nachdem wie gut die Familie die Krise bewältigt hat, erreicht sie
ein neues Organisationsniveau.
Doppeltes ABCX-Modell: McCubbin und Patterson (1983a) haben das
Modell von Hill zu einem doppelten ABCX-Modell erweitert, da sie davon
ausgingen, daß eine Krise eine Anhäufung von Stressoren zur
Folge haben kann.
Bei diesen beiden Modellen wird angenommen, daß belastende Umstände
immer in eine Krise münden müssen.
Integratives Familienstreßmodell: zeigt, daß belastende
Umstände nicht immer eine Krise zur Folge haben müssen. Ausgangslage
des Modells ist der Zustand, in dem sich die Familie momentan befindet.
Auf sie wirken jetzt Stressoren ein. Familienstressoren sind zunächst
objektiv; erst wenn sie subjektiv wahrgenommen werden, wirken sie streßauslösend.
Erwartbare Ereignisse sind normative Familienstressoren, akute hingegen
nicht-normative, die oft Familienkatastrophen sind. Bei Familienkatastrophen
wird das Leben als plötzlich bedroht erlebt. Die Betroffenen erleben
ein Gefühl der Unkontrollierbarkeit und der Hilflosigkeit. Normative
Stressoren hingegen werden nicht so krisenhaft und bedrohlich erlebt wie
angenommen.
Menaghan (1982) erhob bei über 1000 Erwachsenen deren subjektive
Beurteilung von normativen Stressoren im Familienlebenszyklus. Für
10 kindbezogene Übergänge wurde erfragt, inwieweit sich dadurch
das Leben änderte, inwieweit sich die Gefühle über sich
selbst änderten und inwieweit sich die Betroffenen beeinträchtigt
fühlten.
78% der Befragten gaben an, daß sich durch die Geburt des ersten
Kindes das Leben stark änderte, bei 53% änderten sich die Gefühle
über sich selbst, aber nur 30% fühlten sich beeinträchtigt.
Die Geburt des ersten Kindes wird zwar als etwas Einschneidendes erlebt,
die Beeinträchtigung ist aber gering. Spätere kindbezogene Übergänge
wie die Geburt des zweiten Kindes oder Schulbeginn hatten noch geringeren
Einfluß. Folgen normativer Stressoren sind also relativ gering im
Vergleich zu jenen nicht-normativer. Dies konnte die oben genannte Autorin
1983 in einer Untersuchung beweisen, die keinen Unterschied in Partnerbeziehungen
von Familien, die sich in Übergangsphasen befanden, und Familien in
einem stabilen Zustand feststellen konnte.
Laut Olson und McCobbin (1983) gab es mehr Streß bei Übergang
ins Jugendalter und wenn normative Stressoren die Aneignung neuer Rollen
erfordert.
"Systemischer Streß" betrifft das gesamte Familiensystem. Das
Ausmaß hängt sowohl vom Stressor ab als auch von den Bewältigungsmöglichkeiten.
Die Art und Weise, wie die Familie einen Stressor definiert, weist darauf
hin, ob er als Herausforderung oder Belastung empfunden wird. Oft wird
durch die Art der Definition des Stressors eine effektive Bewältigung
verhindert. Daher ist die subjektive Definition des Familienstressors bedeutend
in der professionellen Hilfe.
Weiters ist die Frage wichtig, welche Ressourcen eine Familie zur Streßbewältigung
zur Verfügung hat. Es gibt persönliche Ressourcen einzelner
Familienmitglieder (Bildungsniveau, Wohlstand, Wohlbefinden, Persönlichkeit,
...), interne Ressourcen des Familiensystems und außerfamiliäre
Unterstützungssysteme (sozial, instrumentell, aktiv und materiell).
Dysfunktionale Bewältigungsformen können die Situation in
der Familie noch verschlimmern. Es kommt zu einer Anhäufung von Familienstressoren.
Ist die Bewältigbarkeit von Stressoren und Bewältigungsmotivation
gegeben, entsteht Bewältigungsstreß.
Ziel der Bewältigung ist entweder das Erreichen der Ausgangslage
(negative Rückkoppelung oder Wandel 1. Ordnung) Þ
Aktive Streßassimilation, die gelingen oder mißlingen kann
oder die Veränderung des Systems (= positive Rückkoppelung oder
Wandel 2. Ordnung) Þ Streßakkomodation.
Gelungene Akkomodation führt zur Neuanpassung.
Sind Stressoren nicht bewältigbar, besteht keine Motivation dazu
oder mißlingt die aktive Streßassimilation, stellt sich die
Frage nach der Erträglichkeit der Stressoren: Ist diese gegeben, wird
Streß ertragen (Duldungsstreß) Þ
Passive Streßassimilation.
Wenn die Stressoren nicht ertragen werden können oder die Bewältigungsmöglichkeiten
erschöpft sind, entsteht Krisenstreß und führt zu einer
Akkumulation von Stressoren. Eigene Bewältigungsstrategien reichen
nicht mehr aus - erweiterte Bewältigungsmöglichkeiten müssen
in Anspruch genommen werden.
Das integrative Modell der Familienentwicklung
Das integrative Modell zur Familienentwicklung versucht all diese Theorien
miteinzubeziehen. Der Familienentwicklungsprozess wird als eine Folge von
entwicklungsbezogenen Stressoren und Ressourcen gesehen. Ausgangspunkt
des Modells ist der Zeitpunkt, zu dem sich zwei unabhängige Personen
treffen und ihre eigene Beziehungsgeschichte schaffen. Sie sind in ihr
eigenes Paar- oder Familiensystem eingebunden, aber auch in das Mehrgenerationensystem
ihrer eigenen Familien und in extrafamiliäre Systeme. Frühere
Erfahrungen in der Lebensbewältigung verdichten sich in der Gegenwart
zu vertikalen Stressoren und Ressourcen. Herausforderungen, denen sich
das Paar stellen muß, sind horizontale Stressoren und Ressourcen
wie normative, nicht-normative Ereignisse, dauerhafte Lebensumstände
und alltägliche Unannehmlichkeiten. Beide Dimensionen zusammen entscheiden,
wie ein Paar mit Herausforderungen umgeht.
Zusammenfassung
Die Familientheorie gibt es nicht - es existieren mehrere Ansätze
nebeneinander, die an verschiedenen Perspektiven ansetzen.
Die Familiensystemtheorie betrachtet die Familie als eine Gruppe besonderer
Menschen, die Beziehungen mittels Kommunikation aufrechterhalten und mit
anderen Systemen in Kontakt stehen.
Die Familienentwicklungstheorie stellt den Familienzyklus mit den Familienentwicklungsstufen
in den Mittelpunkt, die die Familie durchlaufen muß und an die Familienrollen
und -entwicklungsaufgaben gebunden sind. Der Übergang von einer Stufe
zur nächsten kann mit Belastungen verbunden sein und zu Veränderungen
in der Familie führen.
Die Familienstresßtheorie beschäftigt sich mit der Frage,
wie die Familie - unabhängig von der Definition der Familie - mit
Belastungen und Streß umgeht. Veränderungen in der Familie finden
nicht durch Übergänge von einer Entwicklungsstufe zur nächsten
statt, sondern sind von der Streßbewältigung der Familie abhängig.
All diese Theorien werden im integrativen Modell zur Familienentwicklung
berücksichtigt, das den Familienentwicklungsprozeß als eine
Folge von entwicklungsbezogenen Stressoren und Ressourcen betrachtet.
Persönliche Stellungnahme
Jede Theorie für sich ist nicht uninteressant, kann gut nachvollzogen
werden und klingt plausibel. Trotzdem sollten die einzelnen Ansätze
nicht als nebeneinander existierend betrachtet werden, sondern eher als
Teile einer Theorie, die alle Theorien berücksichtigt.
Da das integrative Modell zur Familienentwicklung genau das versucht,
erscheint mir diese Theorie als die modernste und wichtigste.
Literaturverzeichnis
Petzold, M. (1992). Familienentwicklungspsychologie. Einführung
und Überblick. München: Quintessenz.
Schneewind, K. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Schneewind, K. (1995). Familienentwicklung: In R. Oerter &
L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (3., vollständig
überarbeitete Auflage) (S. 128-166). Weinheim: Beltz.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
5) Familiäre Sozialisation (Astrid
Sander)
1. Begriffsdefinition - Familiale Sozialisation
Unter Sozialisation versteht man das Hineinwachsen eines Individuums,
vor allem eines Kindes, in eine Kultur, sofern es durch spezifisch zwischenmenschliche
Interaktionen vermittelt wird (vgl. Dreesmann, 1987, S. 461). In diesem
Zusammenhang wird auch der Begriff Enkulturation gebraucht, worunter man
die Internalisierung traditioneller Normen und Werte versteht.
Um zu verstehen, was der Begriff Sozialisation meint, stelle man sich
vor, was ein Mensch aus einer fremden Kultur lernen müßte, um
in unserer Kultur zu leben: die Sprache, den Sinn von Symbolen (z.
B. Schrift), die Regeln des sozialen Umgangs, die Funktion von Werkzeugen
und Kulturgütern, die Differenzierung sozialer Positionen mit ihren
Rechten und Pflichten, die Funktionen gesellschaftlicher Institutionen
(z. B. Parteien, Verbände, Kirchen), Kenntnisse und Fertigkeiten eines
Berufes, Werte- und Glaubenssysteme usw.
Die Familie wird demnach als primäre Sozialisationsinstanz
betrachtet, da hier die ersten Erfahrungen mit der umgebenden Kultur gemacht,
bzw. deren Werte, Regeln und Techniken vermittelt werden. Sozialisation
erfolgt z. B. durch Anleitung und Aufforderung, Information und Belehrung,
durch Beobachtung und Nachahmung von Vorbildern, durch Strafe und Belohnungen.
Weitere, sekundäre Sozialisationsinstanzen sind z. B. der
Kindergarten, die Schule, Jugendorganisationen, die berufliche Umgebung,
Parteien (Montada, 1995, S. 57 ff).
2. Soziologische und psychologische Betrachtung der
Familie
Die Familie als soziale Institution war seit langem ein Gegenstand der
Soziologie.
Hier konzentrierte man sich vor allem auf die Rollen, die den einzelnen
Familienmitgliedern zukommen und analysierte deren Funktion. Die Sozialisation
in der Familie wird im Rahmen der Rollentheorie (Parsons, 1956)
als eine Rollenübernahme verstanden (Geschlechtsrolle, postionsspezifische
Rolle wie z. B. Vater, Mutter, erstgeborenes Kind, Spätankömmling
etc.).
In der Psychologie konzentrierte man sich dagegen auf das Individuum
in der Familie. Dabei untersuchte man zunächst die Bedeutung mütterlichen
Verhaltens auf die Entwicklung des Kindes. Erst allmählich geriet
der Vater ins Blickfeld des Forschungsinteresses. Während man in der
Erziehungsstilforschung die Wirkung der Eltern auf die Entwicklung des
Kindes betrachtete, gewann in den letzten 15 Jahren immer stärker
die Ansicht an Bedeutung, daß auch das Kind selbst in gewissem Umfang
seine eigene Entwicklung steuert. Ebenso wurde die Untersuchung der Beziehung
zwischen Eltern und Kindern auf alle Interaktionspartner in der Familie
ausgeweitet, die Familie also als ein System betrachtet.
Die Sozialisation in der Familie wird schließlich in der neueren
psychologischen Forschung sowohl in einen soziokulturellen und epochalen
Kontext gestellt als auch unter der Perspektive einer lebenslangen Entwicklung
gesehen (vgl. Kreppner, 1989; Schneewind, 1991, S. 139 ff.).
Diese Veränderungen und Ausweitungen in der psychologischen Sichtweise
der Familie sollen im folgenden näher dargestellt werden:
3. Mütterliches Erziehverhalten Erziehungsstilforschung
Übereinstimmend wurde in allen Untersuchungen zum mütterlichen
Erziehverhalten festgestellt, daß folgendes Erziehverhalten sich
günstig auf die Entwicklung eines Kindes auswirkt: Es erfährt
in hohem Maße mütterliche (elterliche) Unterstützung und
Wärme, und es wird ihm ein dem Entwicklungsstand angemessener Freiraum
gewährt. Wichtig ist auch, daß das Kind in konsistenter (statt
inkonsequenter) Weise kontrolliert und diszipliniert wird. (Es wird ihm
nicht einmal etwas erlaubt und das nächste Mal nicht.) Bei der Disziplinierung
werden die Gründe für Verbote und Gebote erklärt.
An der Erziehungsstilforschung wird kritisiert, daß sie nur die
Auswirkungen von der Elternperson auf das Kind beachtet und damit das Kind
als einen mehr oder minder passiven Empfänger mütterlicher (elterlicher)
Sozialisationsbemühungen betrachte (vgl. Schneewind, 1991, S. 139).
4. Der Beitrag des Kindes zur Sozialisation
In neuerer Zeit setzte sich vor allem unter dem Einfluß von Forschern,
die den Austausch zwischen Mutter und Säugling untersuchten, die Auffassung
durch, daß auch kleine Kinder einen hohen Grad an Eigenaktivität
entwickeln und sie dadurch einen beträchtlichen Anteil ihrer Beziehung
zu den Eltern mitgestalten (vgl. Kreppner, 1989, S. 292 f.).
Zwei Konzepte seien beispielhaft für diese Sichtweise näher
dargestellt:
4.1 Das Bindungskonzept - Ausbildung von Erwartungsmustern für
soziale Beziehungen (intern working models)
Das Bindungskonzept wird in der Entwicklungspsychologie mit dem Namen
John Bowlby (1994) verbunden. Er geht davon aus, daß jeder Mensch
mit Verhaltenssystemen ausgestattet ist, die das Überleben der Art
sichern. Zu diesem gehört beim Kind das System des Bindungsverhaltens
(attachment) und beim Erwachsenen, dazu komplementär, das Fürsorgeverhalten
(maternal behavior, bonding). Das Bindungsverhalten des Kindes zielt darauf
(z. B. durch Schreien, Hinterherlaufen), daß die Hauptpflegeperson
in der Nähe bleibt und dem hilflosen Kind Schutz gewährt.
Die personspezifische Bindung entwickelt sich in mehreren Etappen. Die
letzte Phase ist erst mit etwa drei Jahren erreicht. Hier versucht das
Kind, je nach situativen Gegebenheiten, das Verhalten der Bezugsperson
zu beeinflussen (vgl. Rauh, 1995). Bowlby (1994) nimmt an, daß
das Kind bereits innere Erwartungsmuster sozialer Beziehungen aufgebaut
hat.
4.2 Das Konzept der "ungeteilten familialen Umwelt" (nonshared environment)
Dieses Konzept stammt aus der Zwillings- und Adoptionsforschung. Es
besagt, daß das Kind in seiner Entwicklung nicht nur durch seine
genetische Ausstattung, sondern auch durch seine familiäre Umwelt
maßgeblich beeinflußt wird. Allerdings - und das ist das Neue
an der Konzeption - ist nicht die "objektiv" gegebene Umwelt entscheidend,
sondern die Art, wie das Kind diese subjektiv erlebt. Weiters wird angenommen,
daß das subjektive Erleben der Umwelt, in diesem Fall der Familie
einzigartig ist, also von keinem anderen Familienmitglied geteilt wird
(vgl. Kreppner, 1989, S. 401 f.).
5. Die Bedeutung des Vaters
Seit den 70er Jahren wandte sich das Interesse der Forschung auch dem
Vater zu. Im Vordergrund standen dabei Fragen, ob Väter zur Erziehung
von Kindern geeignet sind, wie sie mit diesen umgehen (Interaktion), und
welche Beziehungen sie aufbauen. Faßt man die Befunde zu diesen Fragestellungen
zusammen, so kann festgestellt werden, daß sich Väter genauso
zur Pflege ihres Neugeborenen eignen wie Mütter und sich auch genauso
stark engagieren, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gibt; daß es
weit mehr Ähnlichkeiten im Verhalten von Vätern und Müttern
gibt als Unterschiede, daß die Auswirkungen des väterlichen
Einflusses durch die Familienkonstellation sowie die Einstellungen und
Verhaltensweisen der Familienmitglieder beeinflußt werden. Wenn Väter
in Untersuchungen zum Bindungsverhalten einbezogen wurden, zeigten sich
bei den Kindern die gleichen Bindungstypen wie bei Müttern. Ein Kind
kann allerdings zu Vater bzw. Mutter Bindungen unterschiedlicher Qualität
aufbauen (vgl. Fthenakis, 1985). Insgesamt machte die Vaterforschung deutlich,
daß Mütter nicht von "Natur aus" fähiger sind, mit kleinen
Kindern umzugehen, und daß mütterliche Verhaltensweisen für
die Kinder nicht förderlicher sind, sondern daß Mütter
und Väter sich ergänzen. Über ihre Geschlechtszugehörigkeit
und ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale repräsentieren
sie verschiedene Verhaltensmodelle. So kann das Kind lernen, daß
Verhaltensmuster verschieden und doch gleichwertig sein können. Die
Möglichkeit unterschiedliche Interaktionsstile (Verhaltensstile) beobachten
zu können, wirkt sich günstig auf die kognitive und soziale Entwicklung
von Kindern aus (Schütze, 1989).
6. Die Familie als System
Im folgenden wurden in der Forschung Untersuchungen auf die Interaktion
aller
Familienmitglieder ausgedehnt. Die Familie wird unter diesem Aspekt als
System aufgefaßt.
7. Die Familie im soziokulturellen und epochalen Kontext
Die Sozialisation der Kinder in einer Familie sollte aber nie unabhängig
von der gegebenen historischen Epoche sowie der Kultur und den sozioökonomischen
Rahmenbedingungen, in die Familie eingebettet ist, gesehen werden:
Die Familie wird als Mikrosystem verstanden, das sich
aus verschiedenen Subsystemen zusammensetzt, die sich wechselseitig beeinflussen.
Das Individuum (z. B. das Kind) wird ebenfalls als ein System dargestellt,
das aus sich gegenseitig beeinflussenden System besteht (z. B. kognitives
intrapsychisches System und organisches System). Das Kind (Individuum)
wird durch die Subsysteme in seiner Familie in seiner Entwicklung beeinflußt
und beeinflußt selbst diese Beziehungssysteme.
Von außen wird ebenfalls von sogenannten Exosystemen auf
die Familie Einfluß genommen. Darunter versteht man Gemeindeorgarnisationen,
wie z. B. Sportvereine, Jugendamt oder Schule. Umgekehrt nimmt auch die
Familie mit ihren Subsystemen Einfluß auf diese Exosysteme. Den Mikrosystemen
übergeordnet sind Mesosysteme wie die Beziehungssysteme Nachbarschaft,
Freundeskreis, Verwandtschaft (soziales Netz). Auch hier wird eine wechselseitige
Einflußnahme angenommen.
Allen genannten Systemen übergeordnet ist das Makrosystem,
das die aktuelle kulturelle, politische, rechtliche oder wirtschaftliche
Orientierung einer Gesellschaft umfaßt.
Betrachtet man z. B. die Gesellschaft von Österreich und der
Türkei, so wirken sich die jeweils verschiedenen Einstellungen zum
Staat auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in den verschiedenen
Mesosystemen,
aber auch auf die Beziehungen innerhalb der Familie unterschiedlich aus.
Das gleiche gilt auch für gesellschaftliche Einstellungen in unterschiedlichen
geschichtlichen Epochen. So hatte z. B. eine Ehescheidung im 19. Jahrhundert
noch deutlich massivere Einschnitte in die Familienbeziehungen zur Folge,
so durfte eine schuldige geschiedene Frau ihre Kinder überhaupt nicht
mehr sehen, als heute, wo gegenüber Ehescheidung eine liberalere Einstellung
herrscht. (von Schlippe, 1984, S.28)
8. Sozialisation als lebenslanger Prozeß
Die Familie hat im Laufe des Lebenszyklus typische Aufgaben zu bewältigen,
die mit dem Neuerlernen und Verändern von Normen zu tun haben. Neben
den Aufgaben, die fast alle Familien zu bewältigen haben, gibt es
auch Probleme, die nur einzelne Familien zu lösen haben, z. B. der
Tod eines Elternteils bei noch nicht erwachsenen Kindern, Arbeitslosigkeit
des/der Hauptverdieners/in, etc.
Zusammenfassung
Unter Sozialisation versteht man das Hineinwachsen eines Individuums
in die umgebende Kultur, wobei die Familie als primäre Sozialisationsinstanz
betrachtet wird. Während sich die Soziologie mit der Familie als soziale
Institution beschäftigt, konzentriert sich die Psychologie auf das
Individuum in der Familie. Dabei untersuchte man zunächst die Bedeutung
mütterlichen Verhaltens auf die Entwicklung des Kindes. Erst allmählich
geriet der Vater ins Blickfeld wissenschaftlichen Interesses. Während
man sich in der Erziehungsstilforschung alleine auf die Wirkung der Eltern
auf das Kind konzentrierte, gewann in den letzten 15 Jahren immer stärker
die Ansicht an Bedeutung, daß auch das Kind selbst einen gewissen
Teil zu seiner eigenen Sozialisation beisteuert. Ebenso werden in neuerer
Zeit nicht nur Zweierbeziehungen (Mutter-Kind/Vater-Kind) untersucht, sondern
die Untersuchungen werden auf die Interaktion aller Familienmitglieder
ausgedehnt. Die Familie wird unter diesem Aspekt als System aufgefaßt.
Die Sozialisation des Kindes wird heute auch eingebettet in den jeweiligen
soziokulturellen und epochalen Kontext gesehen, sowie unter der Perspektive
einer lebenslangen Entwicklung.
Stellungnahme
Die Beschäftigung mit dem Seminarthema hat mir einige neue Einsichten
vermittelt. Besonders interessant fand ich die heute vorherrschende Perspektive
einer lebenslangen Entwicklung. Das heißt, daß sich nicht nur
Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene ihr Leben lang immer wieder
neuen Gegebenheiten anpassen und neue Werte und Normen akzeptieren müssen.
Gerade durch diese Sichtweise ist mir klar geworden, wieso sich der Generationenkonflikt
so schwierig gestaltet. Es ist sehr schwer, einmal gelernte Normen und
Werte zu verändern, weil sie das Leben vereinfachen und Sicherheit
geben. Aus diesem Grund legen viele Menschen in der Gesellschaft darauf
Wert, daß Normen beibehalten werden.
Ein anderer Gedanke, den ich auch besonders interessant finde, ist folgender:
Eltern machen sich oft Vorwürfe, daß ihr Kind sich in eine nicht
gewünschte Richtung entwickelt und fühlen sich selbst schuldig.
Für die Beratung finde ich es sehr wichtig, Eltern diese Schuldgefühle
zu nehmen und ihnen klar zu machen, daß das Kind eine eigenständige
Person und nicht völlig durch den Erziehungseinfluß determiniert
ist.
Entwicklungspsychologische Forschung hat demnach auch für die Praxis
hohe Relevanz.
Literaturverzeichnis
Bowlby, J. (1984). Bindung. Frankfurt: Fischer.
Bronfenbrenner, U. (1981). Die Ökologie der menschlichen Entwicklung.
Stuttgart: Klett Cotta.
Dreesmann, H. (1987). Zur Psychologie der Lernumwelt. In B. Weidenmann
& A. Krapp u. a. (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S.
447 - 492). München/Weinheim: Urban & Schwarzenberg/PVU.
Fthenakis, W.E. (1985). Väter (Bd.1 u. 2). München:
Urban & Schwarzenberg.
Kreppner, K. (1989). Familiale Sozialisation. In R. Nave-Herz &
M. Markefka (Hrsg.), Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Familienforschung
(Band 1) (S. 289 - 309). Neuwied: Luchterhand.
Montada, L. (1995). Fragen, Konzepte, Perspektiven. In R. Oerter &
L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 1 - 83). Weinheim:
Beltz, PVU.
Parsons, T. (1956). Family structure and socialization in the child.
In T. Parsons & R.F. Bales (Eds.), Family, socialization and interaction
process (pp. 35 - 131). London: Routledge & Kegan.
Rauh, H. (1995). Frühe Kindheit. In R. Oerter & L. Montada
(Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 167 - 248). Weinheim: Beltz,
PVU.
Schlippe, A.v. (1984). Familientherapie im Überblick. Paderborn:
Jungfermann.
Schneewind, K.A. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Schneewind, K.A. (1995). Familienentwicklung. In R. Oerter & L.
Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (S. 128 - 166). Weinheim:
Beltz.
Schütze, Y. (1989). Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung
des Kindes. In B. Paetzold & L. Fried (Hrsg.), Einführung in
die Familienpädagogik. Weinheim: Beltz.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
6) Familiendiagnostik (Alexandra
Wiener)
Einleitung
Zu Beginn meiner Arbeit werde ich kurz auf den Begriff "Familie" eingehen,
dem dann eine Begriffsdefinition der "Familiendiagnostik" folgt.
Den Rahmen meines Hauptteils bilden dann die 9 Grunddimensionen der
Familiendiagnostik (nach Schneewind 1991), wobei ich aber nur einige mir
wichtig erscheinende Dimensionen besonders genau erläutern werde.
Abschließend folgt eine kurze Zusammenfassung zu dieser Thematik,
die eine kurze persönliche Stellungnahme inkludiert.
2.1. Begriffsdefinition
a.) Familie:
Jede Person hat in ihrem Leben ganz persönliche Erfahrungen mit
ihrer Familie gemacht, und daher hat jeder von uns sein persönliches
Familienbild und dieses subjektive Bild von Familie, das wir in uns tragen,
wird uns wiederum bei der Gründung unserer eigenen Familie leiten.
Eine Definition des sozialen Gebildes ist alles andere als einfach. Der
Begriff "Familie" stellt nämlich für jede wissenschaftliche Disziplin
etwas anderes dar.
(Die soziologische Definition unterscheidet sich von der Juristischen
und diese wiederum von der psychotherapeutischen Definition.)
Da eine genaue Unterscheidung den Rahmen sprengen würde, gehe ich
nun näher auf den Begriff Familiendiagnostik ein.
b.) Familiendiagnostik:
Cierpka (1987, zitiert nach Cierpka, 1996) definiert Familiendiagnostik
wie folgt:
Die Familiendiagnostik untersucht und beschreibt Interaktionen und
ihre Veränderungen zwischen den Familienmitgliedern, den Subsystemen
und analysiert die Dynamik der Familie als systemisch Ganzes. Sie untersucht
die unbewußten Phantasien, Wünsche und Ängste der Familie
auf den Hintergrund der Familiengeschichte und der Lebensentwürfe
für die Zukunft, um zu einem Verständnis für die bedeutsamen
Interaktionssequenzen und deren Funktionalität zu kommen. (S.2)
Familiendiagnostik kann als Prozeß der Informationssammlung gesehen
werden, wobei sich die Informationssammlung hauptsächlich auf die
Struktur und die Prozesse von intimen Beziehungssystemen bezieht.
Es geht also um die Erfassung interpersoneller Prozesse, d.h. um Beobachtung
und Interpretation von Verhaltensweisen "im Austausch" zwischen zwei oder
mehreren Personen, was aber keinesfalls den Ausschluß intrapsychischer
Prozesse aus der Diagnostik bedeutet.
Familiendiagnostik sollte "überindividuell" sein, in dem Sinne,
daß sowohl interpersonelle als auch intrapersonelle Vorgänge
beachtet und vereint werden.
Die Informationssammlung in der Familiendiagnostik verlangt daher nach
einer Anwendung bestimmter Verfahren und Techniken. Einige dieser Verfahren
werden dann im Rahmen der 9 Grunddimensionen, wie sie in den verschieden
Anwendungsfeldern der Familiendiagnostik zum Einsatz kommen, erwähnt.
Diese 9 Grunddimensionen umfassen eine Reihe von Kriterien von Gegensätzlichkeiten,
die für die Familiendiagnostik besonders wichtig erscheinen.
2.2. Grunddimensionen der Familiendiagnostik: (Schneewind 1991)
1. Erkenntnistheoretische Annahmen: linear versus zirkulär
2. Begriffliche Orientierung: theoretisch versus nicht-theoretisch
3. Anwendungsschwerpunkt: Forschung versus klinische Praxis
4. Schwerpunkt der Analyse: strukturell versus prozeßorientiert
5. Ebene der Diagnostik: individuell versus systembezogen
6. Repräsentationsmodus: verbal versus bildhaft-methaphorisch
7. Zeitperspektive: Vergangenheit versus Gegenwart versus Zukunft
8. Datenquelle: Insider versus Outsider
9. Datenart: subjektiv versus objektiv
2.2.1. Erkenntnistheoretische Annahmen linear versus zirkulär
Diese Dimension gibt Aufschluß darüber, wie sich ein Familiendiagnostiker
mit dem System Familie auseinandersetzt. Ist seine Denkweise dem linear-reduktionistischenAnsatz
zuzuordnen,
dann beruhen seine Aussagen auf kausalen oder konditionalen Beziehungen
(z. B. "wenn-dann", "A führt zu B" oder "Ursache-Folgen"). Als Beispiel
kann hier der Ehemann gesehen werden, der seine Frau aufgrund ihrer Depressionen
nunmehr vermehrt umsorgt. Beim rekursiven oder zirkulären Ansatz
kommt klar zum Ausdruck, daß Ursache-Wirkung-Beziehungen nur zum
Teil Informationen liefern. Bei der zirkulären Technik hingegen ist
die Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkung nicht mehr sinnvoll, da
beides sich gegenseitig beeinflußt, (Bsp. Was war früher da?
Die Henne oder das Ei?) und dasselbe Ereignis kann das ein Mal "Ursache"
sein und das andere Mal "Folge", je nachdem wo man mit dem Interaktionskreis
beginnt. Daß, um auf das vorherige Bsp. zurückzukommen, der
Ehemann seine depressive Frau nun mehr umsorgt kann einerseits als Folge
ihrer Depressivität gesehen werden, andererseits aber auch als Ursache
dafür, daß es der Frau wieder besser geht, was dazu führen
kann, daß sich der Ehemann wieder anderen Dingen zuwendet. Dies kann
wiederum dazu führen, daß die Frau wieder depressiv wird. Trotz
der Zirkularität des Verhaltenssaustausches beider Partner ist es
notwendig, einen umfassenderen und tiefgehenderen Einblick in ihr Beziehungsgefüge
zu bekommen. Denn warum die Frau mehr Nähe und Unterstützung
des Mannes wünscht und warum er ein Bedürfnis nach Distanz hat,
bleibt allein durch das zirkuläre Fragen ungeklärt. Hier wäre
eine gründliche Analyse der Entwicklungsgeschichte beider Partner
aufschlußreich.
In der systemisch orientierten Familientherapie hat die Technik des
zirkulären Fragens einen sehr wichtigen Stellenwert bekommen. Sie
wurde zum Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Reihe weiterführender
Interview- und Befragungsmethoden, bei denen noch vor dem diagnostischen
Ziel der Informationsgewinnung das therapeutische Ziel der Intervention
und Veränderung des Familiensystems ganz in den Mittelpunkt rückt.
Zirkuläre Ansätze und lineare Ansätze können einander
ergänzen. Linear orientierende Fragen werden mit einer "investigatorischen
Absicht" gefragt und können vom Therapeuten dann gestellt werden,
wenn er etwas nachforschen möchte bzw. die Besonderheit eines präsentierten
Problems herausfinden möchte.
Lineare Fragen wären um auf das Bsp. der depressiven Frau zurückzukommen
z. B. über die subjektiv empfundenen Begleiterscheinungen, oder subjektive
Erklärungen ihrer Depression. Die Fragen wären nach wie vor linear
gerichtet, würde man sie Umformulieren und den Ehemann z. B. über
die depressive Verstimmung seiner Frau fragen.
Zirkulär gestellte Fragen zielen besonders auf den Beziehungskontext
ab.
Die Annahme besteht darin, daß ein symptomatisches Verhalten keine
isolierte Einheit darstellt, sondern es wird als Ereignis gesehen, auf
das jene Personen die mit dem "Symptomträger" in irgendeiner Weise
verbunden sind, unterschiedlich reagieren.
Zirkuläre Fragen werden mit einer "exploratorischen Absicht" gefragt.
Der Therapeut versucht dadurch die Muster von wiederkehrenden Erreignissen
aufzudecken, die mit dem präsentierten Problem einhergehen.
Zur Illustration folgt nun ein kleiner Ausschnitt aus einem Erstgespräch
einer Familie mit einem anorektischen Sohn und dessen Schwester.
Therapeut: Wenn deine Mutter versucht, Marcello zum Essen zu
bewegen, und er die Nahrung verweigert, was tut dann dein Vater?
Ornella: Eine Zeitlang hält er sich zurück, aber dann
wird er langsam wütend und beginnt zu schreien.
Therapeut: Wen schreit er an?
Ornella: Marcello.
Therapeut: Und wenn er Marcello anschreit, was tut dann deine
Mutter?
Ornella: Sie wird über Papa wütend. Sie sagt er ruiniere
alles, er habe keine Geduld und er mache alles nur noch schlimmer.
(Selvini-Palazzoli et al.; 1981, S.135f., zitiert nach Cierpka, 1996)
Zusammenfassend kann man sagen, daß sowohl lineare Fragen als auch
zirkuläre Fragen im Bereich der Familiendiagnostik ihre Berechtigung
haben. Es kann nur von Vorteil sein, wenn man beide Fragetypen in flexibler
Weise bei einem Familiengespräch einsetzt.
2.2.2. Begriffliche Orientierung: theoretisch versus nicht
theoretisch:
Aufgrund der verschiedenen theoretischen Ansätze, der verschiedenen
Schulen usw. stellt sich nun die Frage, ob bei der Familiendiagnostik die
Bindung an eine bestimmte Theorie notwendig ist oder nicht. Es gibt nahezu
1000 Verfahren zur Erfassung von Familienvariablen und es hängt natürlich
zuallererst von der theoretischen Grundhaltung des Diagnostikers ab für
welches Verfahren er sich entscheidet. Ein psychoanalytischer Familientherapeut
wird z. B. mit seinem Schwerpunkt auf unbewußten Prozessen, der Übertragung
und Gegenübertragung ganz andere Verfahren zur Diagnose und Beurteilung
von Familien verwenden als ein verhaltenstheoretisch orietierter Familientherapeut,
der sich mit dem offen beobachtbaren Verhalten der einzelnen Familienmitglieder
beschäftigen wird. In beiden Fällen wären hier die entsprechenden
Ansätze von theoretischen Überlegungen geleitet.
Im Vergleich dazu gibt es auch Ansätze die "nicht-theoretisch"
sind, (wobei es eigentlich keine ganz "theoriefreie" Diagnostik gibt),
und als Beispiel dient hier die Methode der "klinischen Listen"
nach Fisher (1976). Die Listen beziehen sich auf eine Anzahl von Dimensionen,
die aus klinischer Erfahrung abgeleitet wurden und hilfreich für die
klinische Diagnose von Familien sind.
Ein Bsp. für ein theoriegeleitetes familiendiagnostisches Instrument
ist das Family Assessment Measure (FAM III) das von Skinner,
Steinhauer und Santa-Barbara (1983) entwickelt und von Cierpka als Familien-Einschätzungsbogen(FEB)
für den deutschen Sprachraum adaptiert wurde. Es werden sieben theoretisch
abgeleitete Konstrukte erfaßt: Aufgabenerfüllung, Rollenausübung,
Kommunikation, Affektausdruck, Involviertheit, Kontrolle und Werte und
Normen. Das FAM III besteht aus drei Skalen zur Erfassung von Stärken
und Schwächen von Familien auf drei Systemebenen. (1. Ebene: Gesamtfamilie,
2. Ebene: Dyaden innerhalb der Familie, 3. Ebene: Individuelle Familienmitglieder).
Dieselben theoretischen Konstrukte werden auf allen drei Systemebenen erfaßt,
was somit einen Vergleich über die verschieden Systemebenen hinweg
erlaubt. Laut Autoren kann das FAM III sowohl als Verfahren zur Analyse
von Familienprozessen in Forschungsstudien verwendet werden als auch zur
Erfassung des Therapieprozesses und des Therapieerfolges.
2.2.3. Anwendungsschwerpunkt: Forschung versus klinische Praxis
"Das Interesse des Familienforschers besteht in der Entwicklung
von diagnostischen Verfahren für sein Erkenntnisobjekt, die Familie,
die als reliable und valide Indikatoren von theoretisch definierten Konstrukten
dienen und als solche die wiederholte Erfassung von Phänomenen ermöglichen."
(Carlson, 1989, S. 172). Die Familiendiagnostik im klinischen Bereich
hingegen verfolgt, im Gegensatz zur Theorieprüfung der Familienforschung,
sehr unterschiedliche Ziele. Carlson (1989) unterscheidet in der Familiendiagnostik
folgende 5 Stufen der Familienbehandlung:
A.) Abklärung familiärer Dysfunktionen:
Eine angemessene Methode für eine Breitband-Familiendiagnostik
sollte auf der ersten Stufe eingesetzt werden.
Ein einfaches Instrument stellt der Familien-APGAR (Smilkstein,
1978) dar, der die folgenden Funktionssaspekte der Familie erfassen soll:
(1)
Anpassung oder Problemlösefähigkeit in der Familie, (2) Partnerschaftlichkeit
oder Teilen von Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung, (3) Wachstum,
(4) Zuneigung, (5) Entscheidungsfähigkeit oder die Bereitschaft, mit
anderen Familienmitgliedern Zeit, Raum und materielle Güter zu teilen.
Die Nützlichkeit dieses Instruments wurde trotz Einfachheit nachgewiesen.
Die "telefonische Beziehungskarte" von (Blasio, Fischer
& Prata, 1986) ist ebenfalls ein geeignetes Verfahren zur Erfassung
von Familieninformationen in der Sondierungsphase. Es handelt sich dabei
um ein kurzes Telefoninterview, wobei die Daten nach einem vorgegebenen
Raster erfragt werden, was wiederum dem Therapeuten die Entscheidung für
das anzuwendende Verfahren in der ersten Familiensitzung erleichtern wird.
B.) Klinische Familiendiagnose:
In dieser Phase geht es um die Spezifizierung und Bestätigung der
Hypothesen über die Funktionsweise der Familie. Die Verfahren, die
man auf dieser Stufe anwendet, sollten valide Unterscheidungen zwischen
einzelnen Familien ermöglichen und sie hinsichtlich des Typs und des
Schweregrads einer Dysfunktion richtig klassifizieren.
Im folgenden werden einige Verfahren in aufsteigender Reihenfolge bezüglich
Aufwand an Training, Auswertung und Datenanalyse dargestellt.
1. Selbstbeurteilungsverfahren:
Als Beispiel wäre hier das von Snyder (1981) entwickelte Marital
Satisfaction Inventory (MSI) zu erwähnen. Hier werden 9 spezifische
Bereiche der Partnerindikation erfaßt: (1) Affektive Kommunikation,
(2) Problemösungsorientierte Kommunikation, (3) Gemeinsam verbrachte
Zeit, (4) Unstimmigkeiten in bezug auf Geldangelegenheiten, (5) Unzufriedenheit
mit der Sexualität, (6) Rollenorientierung, (7) familiengeschichtlicher
Hintergrund von Belastungen, (8) Unzufriedenheit mit Kindern, (9) Konflikte
in der Kindererziehung.
2. Quasi-Beobachtungsverfahren:
Hier ist die Spouse Observation Checklist (SOC) von Weiss
und Perry (1979) zu nennen. Diese ist ein Beispiel für die teilnehmende
Beobachtung in der Familiendiagnostik und verlangt von den Partnern, daß
sie täglich die Auftretenshäufigkeit von angenehmen und unangenehmen
Verhaltensweisen des Partners anhand von 12 Kategorien erfassen.
3. Beobachtungsorientierte Schätzskalen:
Methodisch abgesicherte Verfahren gibt es in diesem Bereich nur sehr
wenig. Eine davon ist die Marital Communication Rating Scale (MCRaS)
von Borkin, Thomas und Walters (1980), das ein Verfahren zur Einschätzung
des Kommunikationsverhaltens von Paaren ist. Es wird dabei von trainierten
Ratern gefordert, daß sie die Interaktionen eines Paares beobachten
und anschließend jeden Partner anhand von 37 Beobachtungskategorien
beurteilen.
4. Beobachtungsorientierte Kodierungssysteme:
Als Beispiel für die in dieser Kategorie sehr aufwenigen Verfahren
ist das Marital Interaction Coding System (MICS) von Weiss
und Summers zu nennen, das in den vergangenen Jahren dreimal revidiert
wurde und nun als MICS III verfügbar ist. Auch hier wird die Paar-Interaktion
beobachtet oder videographiert und anschließend anhand von 32 Verhaltenskategorien
kodiert. Die Kodierungen des MICS beziehen sich auf positives verbales
und nonverbales Verhalten, auf negatives verbales und nonverbales Verhalten,
auf Problemlösungsverhalten sowie auf das Zuhörerverhalten.
Dieses Instrument wird zur Messung des Erfolges von ehetherapeutischen
Interventionen verwendet und differenziert Paare mit und ohne Eheprobleme.
C.) Diagnostisch gestützte Behandlungsplanung:
Nicht nur die valide Information über die Funktionsweise der Familie
ist für den Familienpsychologen von Bedeutung, ebenso wichtig ist
das Auswählen angemessener Behandlungsziele, den Verlauf der Behandlungseinheiten
zu spezifizieren und schließlich auch Kriterien für den Behandlungserfolg
zu bestimmen.
D.) Diagnostische Begleitung des Behandlungsablaufs:
Diese Phase der Behandlung erfordert familienpsychologische Verfahren,
die Informationen über die Wirksamkeit der Intervention und über
die Veränderung bestimmter Interaktionsmuster liefern. Diese Verfahren
müssen einerseits sehr veränderungssensitiv sein, andererseits
aber auch resistent sein gegenüber Methodenartefakten wie z. B. Anfälligkeit
für Antwortstile, Testwiederholungseffekte.
Die vorhin genannte Spouse Observation Checklist (SOC)
könnte z. B. dem Paar als Hausaufgabe mitgegeben werden mit dem Ziel,
daß das Paar Veränderungen auf dem Weg der teilnehmenden Beobachtung
erfaßt.
E.) Evaluation nach Abschluß der Behandlung:
Eine Evaluation nach Behandlungsende kann Informationen über die
Dauerhaftigkeit der Veränderungen liefern. Man kann z. B. erfahren,
ob das veränderte Kommunikationsverhalten eines Paares über die
Zeit stabil geblieben ist, oder ob es sich auf andere dyadische Familienbeziehungen
auswirkt. Die Evaluation kann so durchgeführt werden, indem zumindest
einige der Verfahren nocheinmal angewendet werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sowohl die Forschung als
auch die klinische Praxis als eine sich gemeinsam entwickelnde Erkenntnisquelle,
die sich gegenseitig ergänzen und befruchten, verstanden werden kann.
2.2.4. Schwerpunkt der Analyse strukturell versus prozeßorientiert
Bei der Auswahl der Erhebungsmethoden soll sich der Familiendiagnostiker
auch danach richten ob er an dauerhaften strukturellen Aspekten
des Familienlebens interessiert ist, oder ob er sich eher auf die weniger
stabilen prozeßhaften Merkmale des familiären Zusammenlebens
konzentriert.
Bei Minuchins (1977) Modell der strukturellen Familie
geht es, wie der Name schon sagt, um die strukturellen Merkmale des Familienlebens,
mit Betonung auf System- und Subsystemgrenzen, generationsübergreifenden
Koalitionen und auf dyadische Qualitäten innerhalb der Familie. Mit
einer Reihe von Symbolen wird, vorrausgesetzt natürlich, daß
die Familie vorher befragt und hinsichtlich ihres verbalen und nonverbalen
Verhaltens beobachtet wurde, ein Strukturdiagramm konstruiert.
Bei der prozeßorientierten Familiendiagnostik verwendet
man hauptsächlich Verfahren, die zur Kategorie der beobachtungsbezogenen
Kodierungssysteme zählen. (D.h., Familieninteraktionen werden beobachtet
und kodiert.)
In der Literatur werden zwei Ansätze der quantitativen Verarbeitung
der kodierten Daten diskutiert, entweder ihre ereignisbezogene Auswertung
über sog. Frequenzanalysen oder ihre zeit- bzw. prozeßbezogene
Verrechnung über sog. Sequenzanalysen. Die Beschränkung der Datenanalyse
auf Frequenzanalysen führt zum Verlust der Informationen über
den Interaktionsprozeß. Sequenzanalytische Methoden können besser
zwischen Funktionalität und Dysfunktionalität von Beziehungen
unterscheiden. Es können Verhaltensmuster entdeckt und Voraussagen
über Verhaltenskombinationen gemacht werden, was mittels Frequenzanalyse
nicht möglich ist. Sie finden in der Praxis jedoch kaum Verwendung,
da sie sehr zeitaufwendig sind (eine videographierte Stunde erfordert etwa
30 Stunden Kodierung und Datenanalyse), und neben der methodischen Erfahrung
ist die Apparateausstattung und Computersoftware zur Datenanalyse erforderlich.
2.2.5. Ebene der Diagnostik individuell versus systembezogen
Um bestimmte familiendiagnostische Verfahren anwenden zu können,
muß zunächst einmal entschieden werden, auf welche Familiengruppierung
das Hauptaugenmerk gerichtet wird.
A.) Individuelle Familienmitglieder:
Primäres Ziel auf dieser Ebene ist es, Informationen über
intrapsychische Strukturen und Prozesse einer bestimmten Person zu erhalten.
Individuelle Daten über Intelligenz, Motivation, Sozialverhalten,
Affektivität, Temperament, Selbskonzept usw. werden als Hinweis auf
Verhaltensdispositionen betrachtet, die sich dann unter bestimmten Situationsanforderungen
als offen beobachtbares Verhalten äußern.
B.) Ebene der Zweierbeziehungen oder Familiäre Subsysteme:
Auf dieser Ebene gibt es sowohl Dyaden als auch Tetraden, d.h. die Zahl
der Personen in einer Gruppierung muß um mind. eine Person niedriger
sein als die Gesamtzahl der Familienmitglieder. Bei den meisten Verfahren
geht es um die Erfassung dyadischer Beziehungen. (Dyadic Adjustment
Scale DAS, Marital Adaptability and Cohesion Evaluation Scales MACES)
usw.). Nach Crotevant und Carlson (1989) gibt es rund 23 Selbstberichtsverfahren
zur Erfassung von Eltern-Kind-Beziehungen.
Das Parent Perception Inventory (PPI) von Hazzard, Christensen
und Margolin verlangt vom Kind, daß es neun positive und neun negative
elterliche Verhaltensweisen beurteilt. Die Einschätzungen für
die Mutter und den Vater werden dann getrennt erhoben. Es handelt sich
bei diesem Verfahren um ein sehr ökonomisches und klinisch nützliches
Verfahren
C.) Familiensystem:
Zur Erfassung der Gesamtfamilie gibt es die größte Anzahl
an familiendiagnostischen Instrumenten. Als Beispiel dient hier die von
Moos (1974) entwickelte Family Environment Scale (FES), die
unter dem Namen Familienklimaskalen für den deutschen
Sprachraum adaptiert wurde und Bestandteil des Familiendiagnostischen Testsystems
(FDTS) sind.
D.) Suprasysteme:
Jede Familie lebt in einem gewissen Kontext und ist in verschiedene
Suprasysteme (außerfamiliäre Systeme) eingebettet und wird von
diesen auch beeinflußt.
Hier gibt es nur wenige Verfahren die Aufschluß über schulische,
berufliche, freundschaftliche und institutionelle Beziehungen etc. geben.
Ein Instrument zur Erfassung dieser Suprasysteme ist die Umwelt-Landkarte
von Hartmann (1978). Der mittlere Kreis auf einem Papier stellt den Familienhaushalt
dar, während die rund um angeordneten Kreise die extrafamiliären
Systeme symbolisieren sollen. Die Qualität der entsprechenden Beziehungen
wird mittels Symbolen dargestellt.
Dieser Ansatz ermöglicht eine ganzheitliche und integrative Veranschaulichung
des Lebensraums einer Familie.
2.2.6. Repräsentationsmodus: verbal versus bildhaft-methaphorisch
Die meisten familiendiagnostischen Instrumente beruhen auf dem verbalen
Modus z. B. bei Selbstbericht- und Interviewmehoden. Es kommen semantische,
syntaktische und pragmatische Aspekte der Sprache ins Spiel, wenn wir in
einer beschreibenden, erklärenden oder vorschreibenden Weise Aussagen
machen.
Der bildhaft-methaphorische Modus eignet sich besonders für
Personen mit geringer sprachlicher Ausdrucksfähigkeit (z. B. Kinder);
die Methoden sind einfach und ohne Aufwand durchführbar. Bei diesem
Modus werden die Beziehungen in verschiedenster Weise dargestellt
Die Familienskulptur (Duhl et al. 1973) ist eine Methode
bei der die Familienmitglieder sich so im Raum positionieren müssen,
sodaß die Beziehungen zwischen ihnen deutlich werden.
Nicht-sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten, wie Abstand, Körperhaltung,
Gestik, Mimik, Blickrichtung etc., sollten miteinbezogen werden.
Es können die tatsächlichen, idealen oder erwarteten Beziehungen
dargestellt werden.
Eine wichtige Frage in der Familientherapie ist, wie die Familienmitglieder
ihre Struktur und die Beziehungen, Nähe und Distanz, untereinander
erleben, woraus dann Erkenntnisse gewonnen und das Verhalten geändert
werden kann.
Als weiteres Verfahren wäre der Family System Test (FAST)
von Gehring und Wyler (1986) zu nennen. Auf einem schachbrettähnlichen
Brett sollen Figuren, die die Personen darstellen, entsprechend plaziert
werden um die zwei Dimensionen "Kohäsion" und "Macht" zu veranschaulichen.
2.2.7. Zeitperspektive: Vergangenheit versus Gegenwart versus
Zukunft
Verschiedene Familientherapeutische Schulen interessieren sich für
verschiedene Zeitqualitäten. Psychoanalytische Schulen orientieren
sich eher an der Vergangenheit und versuchen frühe oder generationsübergreifende
Familienbeziehungen aufzudecken, während sich der verhaltenstheoretisch
orientierte Therapeut mit dem "Hier und Jetzt" befassen wird.
Doch ist der Zeitbegriff allein schon problematisch, da zukünftige
Ereignisse, sobald sie verwirklicht werden, den Status der Gegenwärtigkeit
annehmen und gegenwärtige Ereignisse im nächsten Moment schon
wieder der Vergangenheit angehören.
A.) Vergangenheit
Ein Ansatz zur Erfassung historischer Familiendaten, besonders in der
Mehrgenerationen-Familie, stellt das Familiengenogramm dar. Es wird ein
Familienstammbaum konstruiert, wobei mindestens drei Generationen miteinander
verknüpft sein sollen. Zur Kennzeichnung des Familiengenogramms werden
2 Arten von Daten herangezogen. 1. Faktische Daten wie Geburt, Heirat,
Krankheit, Tod, Beruf, usw. und 2. Beziehungsdaten wie Krankheits- oder
Kommunikationsmuster, Probleme, Krisen etc.
B.) Gegenwart
Die meisten Verfahren in der Familiendiagnostik beziehen sich auf "Hier-und-Jetzt"-Beziehungen.
Dies gilt auch für alle beobachtungsbezogenen Schätz- und Kodiersysteme.
Die Zeitdimension stellt jedoch ein Problem dar, da Personen, die bei Selbstberichtmethoden
gebeten werden die Familie darzustellen, natürlich auf Erfahrungen
und Erinnerungen in der Vergangenheit zurückgreifen müssen.
C.) Zukunft
Zur Erfassung zukünftiger Entwicklungen in der Familie gibt es
trotz der Wichtigkeit nur wenige Verfahren. Eines davon ist die Family
Environment Scale (FES) von Moos und Moos (1986) von der es eine
Real-Version
(Einschätzung der gegenwärtigen Familie), eine Ideal-Version
und eine Erwartungs-Version gibt. Zur Erfassung zukünftiger
Ereignisse wurde von Schneewind, Vaskovics et al. (1989) ein Veränderungsfragebogen
entwickelt. Hier kann z. B. angegeben werden, was sich nach Ankunft eines
best. Ereignisses (Geburt, etc.) verändern wird. Diese Veränderungserwartungen
werden nach dem Ereignis mit dem entsprechenden Veränderungsleben
verglichen und eventuelle Erwartungsverletzungen (pos. oder neg.) können
frühzeitig erkannt werden. Belsky (1985) konnte nachweisen, daß
negative Erwartungsverletzungen auf längere Sicht zu einer Verringerung
der Beziehungsqualität führen können.
2.2.8. Datenquelle Insider versus Outsider
In der Familiendiagnostik ist eine wichtige Entscheidung, ob die Daten
von Personen stammen sollen, die direkt am Geschehen beteiligt sind (Insider)
oder von Personen, die das Ganze von außen beobachten (Outsider).
Bei allen Selbstberichtverfahren wie Fragebögen, Ratingverfahren
oder Interviewdaten stammen die Daten von Insidern, sowie auch bei Methoden
wie z. B. Familienzeichnung oder die Familienskulptur.
Outsider sind jene Personen, die nicht direkt zur untersuchten Familie
gehören, wie Lehrer, Freunde, Arbeitskollegen, etc. trotzdem aber
wichtige Informationen über die Funktionsweise der Familie liefern
können.
Untersuchungen zeigten, daß es kaum zu einer Übereinstimmung
von Daten innerhalb der Insider- bzw. Outsiderperspektive kommt, da oft
unterschiedliche theoretische Modelle zugrundeliegen, obwohl sie vorgeben
dieselben Konstrukte zu messen.
2.2.9. Datenart: subjektiv versus objektiv
Olson (1981) unterscheidet vier Typen von Methoden zur Familiendiagnostik.
Klassifikation subjektiver und objektiver Daten der Familiendiagnostik
(Olson 1981, S.78).
| |
Datenart: subjektiv |
Datenart: objektiv |
| Datenquelle: Insider |
Selbstberichtmethode |
Verhaltensbez. Selbstberichtmethoden |
| Datenquelle: Outsider |
Subjektive Beobachterberichte |
Verhaltensbezogene Methoden |
Subjektiv-orientierte Daten müssen nach Olson nicht nur auf die Insiderperspektive
beschränkt sein, sondern können auch aus der Sicht des Outsiders
erhoben werden. Dasselbe gilt für objektiv-verhaltensorientierte Daten,
die genauso von Insidern erfaßt werden können.
Nach Schneewind (1991) wird die Kategorie der subjektiven Insiderdaten
und auch die der objektiven Insiderdaten noch mit Verfahren wie der Familienskulpturtechnik
ergänzt. Auch die objektiven Daten müssen sich nicht nur auf
das Verhalten beschränken, zu dieser Kategorie können auch faktische
Daten zur Konstruktion eines Familiengenogramms oder medizinische Gesundheitsdaten
gezählt werden.
Subjektiv-introspektive Daten haben in letzter Zeit immer mehr
Beachtung gefunden. Die subjektive Realität einer Person wird als
wichtige Informationsquelle für das Verständnis von Familienbeziehungen
gesehen, darüber hinaus sind solche Daten auch einfacher zu erheben
und auszuwerten als verhaltensbezogene Daten. Dagegen spricht allerdings,
daß subjektive Daten für gewisse Antwortstile (soz. Erwünschtheit,
etc.) oder Simulationstendenzen sehr anfällig sind. Verhaltenstheoretisch-orientierte
Familiendiagnostiker betrachten objektive Daten, also die Beobachtung
und Kodierung realer Familieninteraktionen, als den "Königsweg" der
Diagnostik. Beobachtungsbezogene Kodiersysteme erlauben, trotz des erhöhten
Arbeits- und Kostenaufwands, eine feinrastrige Erfassung des Interaktionsgeschehens
innerhalb der Familie, und es kann ein hoher Grad an Genauigkeit und Beobachterübereinstimmung
erzielt werden. Auch können diese Daten statistischen Analysen unterworfen
werden, die Häufigkeitsmuster und sich wiederholende Abfolgen von
Familieninteraktionen aufdecken. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß
die gegenseitige Ergänzung beider Ansätze für das Verständnis
des komplexen Systems "Familie" notwendig ist.
3.1. Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme
Immer wieder werde ich damit konfrontiert, daß Forschung und Praxis
zwei Welten sind, die zwar nicht grundverschieden sind, aber oft nur in
geringen Ansätzen übereinstimmen.
In den 9 Dimensionen nach Schneewind, die die wichtigsten Kriterien
der Familiendiagnostik darstellen, kommen diese Gegensätzlichkeiten
auch ganz deutlich zum Ausdruck. (Bemängelnd finde ich allerdings
bei Schneewind (1991), daß er bei den Verfahrensarten völlig
auf die projektiven Verfahren vergißt.)
Ziel sollte meiner Meinung nach sein, alle diese Ansätze, diese
scheinbaren Polaritäten, mit allen ihren Vor- und Nachteilen zu akzeptieren
und so gut wie möglich zu vereinen. Gut wäre auch zukünftig
mehr Verbindungsbrücken zwischen Forschung und Praxis herzustellen
und die Vielfalt an psychologischen Testverfahren zu überarbeiten
und an die heutige Zeit zu adaptieren.
Literaturverzeichnis
Cierpka, M. (1996). Handbuch der Familiendiagnostik. Berlin:
Springer.
Gotwald V. (1995). Familiendiagnostik in der Systemischen Therapie.
Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Wien.
Petzold, M. (1992). Familienentwicklungspsychologie. Einführung
und Überblick. München: Quintessenz.
Reiter, L. (1983). Gestörte Paarbeziehungen. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Schneewind, K. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
7) Familiendiagnostisches Testsystem (Petra
Steindl)
1) Einleitung
Das Familiendiagnostische Testsystem wird vor allem für den Bereich
der familienpsychologischen Diagnostik eingesetzt. Die familienpsychologische
Diagnostik bedarf in ihren anwendungsbezogenen Aspekten einer "systemischen
Diagnose". Darunter versteht man eine Verbindung der allgemeinen Systemtheorie
mit a) Mehrebenen-Perspektive b) einer Multivariablen Perspektive und c)
einer Multimethoden-Perspektive. Solche Konzeptionen stützen sich
jedoch eher auf programmatische Aussagen.
Auch heute werden die entwickelten Methoden diagnostischer Verfahren
höchstens teilweise dem systemorientierten Ansatz gerecht.
Die von Cromewell und Peterson vorgeschlagenen diagnostische Verfahren
beruhen auf einer Zusammenarbeit von bereits bekannten, für verschiedene
Fragestellungen konstruierten Erfassungsmethoden. Dies wurde stark kritisiert.
Das Konzept von Cromewell und Peterson stellt jedoch ohne Zweifel auch
eine Bereicherung dar. Sie machten vor allem auf das Problem unterschiedlicher
Datenquellen mit ihrer Unterscheidung einer Insider- und Outsiderperspektive
aufmerksam. Das heißt, daß es einen Unterschied macht, ob ein
Outsider (dies kann ein Freund der Familie oder der Familientherapeut sein)
eine Person innerhalb der Familie bestimmte innerfamiliäre Beziehungsdyaden
oder die Familie als Ganzes beschreibt oder ob diese Aussagen von einem
Insider (Familienmitglied) getätigt werden. In neueren Arbeiten zur
familiären Sozialisationsforschung wird sowohl auf inner- als auch
außerfamiliäre Kontextbedingungen aufmerksam gemacht.
2) Theorie
2.1. Grundstruktur des FDTS
Der FDTS besteht aus einem Fragebogen-Satz, durch den möglich wird,
das innerfamiliäre Beziehunsgefüge aus der Sichtweise der Beteiligten
zu erfassen. Gegenstandsbereich ist die Kernfamilie (Vater, Mutter, Kind).
a) Triadische Interaktionsbeziehung:
Ausgehend von der Kernfamilie ergeben sich fünf mögliche Beziehungskonstellationen
und zwar jeweils aus der Sicht der beteiligten Personen.
Bsp.: Beziehungskonstellation Vater/Tochter wird sowohl aus der Sicht
der Tochter als auch des Vaters beschrieben.
Dadurch wird auch gleich deutlich, daß wir neben personenspezifischen
auch geschlechtsspezifische Aspekte finden.
b) Dyadische Beziehungskonstellation:
Aus den Beziehungen Vater-Mutter und Mutter-Kind kann, wieder aus der
Sicht jedes Beteiligten, der elterliche Erziehungsstil erhoben werden.
Fremdperzeption entspricht der Sicht des Kindes und Selbstperzeption die
der Eltern. Hier sind drei Komponenten zu unterscheiden.
1) Erziehungseinstellungen: Dies bezieht sich auf die Erlebnisdispositionen
der Eltern, die sie hinsichtlich der Realisierung bestimmter erzieherischen
Verhaltensformen besitzen.
2) Erziehungsziele: Darunter werden Vorstellungen und Forderungen
der Eltern an ihre Kinder bezüglich deren Verhalten verstanden.
3) Erziehungspraktiken: Dazu werden alle verbalen und nonverbalen
Verhaltensäußerungen der Eltern gegenüber ihren Kindern
gezählt.
Diese drei Komponenten können ebenfalls aus der Sicht des Kindes
wie auch der Eltern erhoben werden. Weiters ist es möglich mit einem
anderen Fragebogen des FDTS die Ehepartnerbeziehung zu erfassen, aus der
Sichtweise des männlichen und weiblichen Ehepartners.
Allgemein ist noch zu sagen, daß sich die erhobenen Beziehungsaspekte
(Erziehungsstil, Ehepartnerbeziehung) jeweils auf eine bestimmte Person
beziehen. Weiters ist es wichtig, über die Qualität des gesamten
innerfamiliären Beziehungsgefüge Bescheid zu wissen. Dazu werden
Familienklimaskalen verwendet.
2.2. Aufbau des FDTS
Das FDTS ist ein auf Fragebogenbasis aufgebautes modulares Testsystem,
das für Eltern mit Kindern zwischen neun und vierzehn Jahren konstruiert
wurde.
Unter modularem Aufbau des Testsystem wird die Möglichkeit nur
bestimmte oder mehrere Einzeltests aus dem gesamten Testsystem zu verwenden,
verstanden.
Das FDTS umfaßt acht Teiltestsysteme, die sich aus einer Kombination
der Subsystem- und Systemkonstellationen einer Familie und der inhaltlichen
Beziehungsaspekte auf Subsystem-und Systemebene ergeben. Sechs dieser acht
Teilsysteme orientieren sich am Geschlecht des Kindes und den drei Komponenten
des elterlichen Erziehungsstils. Es ergeben sich dann weiters unter der
Berücksichtigung jeder Sichtweise der Personen jeweils vier Einzeltests.
Die Testsysteme kurz zusammengefaßt
1) ES-Testsystem: Dieses hat die Erziehungseinstellungen der Eltern
gegenüber ihrem Sohn zum Inhalt.
2) ET-Testsystem: Dieses erhebt die Erziehungseinstellung der Eltern
gegenüber ihrer Tochter.
3) EZS-Testsystem: Dieses erfaßt die Erziehungsziele der Eltern
gegenüber ihrer Tochter.
4) EZT-Testsystem: Dieses erhebt die Erziehungsziele der Eltern gegenüber
dem Sohn.
5) EPS-Testsystem: Dieses hat die Erziehungspraktiken der Eltern gegenüber
ihrem Sohn zum Gegenstand.
6) EPT-Testsystem: Entspricht EPS-Testsystem jedoch bezogen auf die
Tochter.
Weiters gibt es das
7) FK-Testsystem: Dieses ermöglicht die Erfassung des Familienklimas.
Im Gegensatz zu den ersten sechs erwähnten Testsysteme werden beim
Siebten auf ein Geschlechtsdifferenzierung auf der Kinderseite verzichtet.
8) EB-Testsystem: Dieses befaßt sich mit Subsystem der Ehepartner
innerhalb der Familie.
Allgemein: Wie schon erwähnt, werden in jedem Teiltestsystem alle
möglichen Perspektiven berücksichtigt. Weiters sind pro Teiltestsystem
zwei Berichte vorgesehen. Der erste Bericht enthält das Testmanual,
welches die Beschreibung der Testskalen, psychometrische und teststatistische
Kennwerte, Durchführung, Auswertung, Normen etc. enthält. Der
zweite Bericht beinhaltet die Testauflagen, also die Instruktionen und
eine Auswertungshilfe.
2.3. Skalenstruktur des FDTS
Ziel des FDTS ist eine möglichst differenzierte Erfassung unterschiedlicher
Dimensionen des Beziehungsverhaltens und Beziehungserlebens.
Die inhaltliche Festlegung und Operationalisierung der Skalen stellt,
ausgenommen das FK-Testsystem, eine methodische Neuentwicklung dar. Als
Orientierungshilfe dienen bereits veröffentlichte Verfahren. Weiters
wurden zusätzlich bedeutende familiäre Beziehungsaspekte mittels
offenen Interviews eruiert und in Folge dann inhaltsanalytisch aufbereitet.
Daraus ergaben sich verschiedene inhaltliche Beziehungskonstrukte, für
die anschließend nach dem Prinzip der rationalen Skalenkonstruktionen
Items formuliert wurden. Nach einem ersten empirischen Überprüfungsverfahren
wurden jene Skalen behalten, die sich als unabhängige Dimensionen
des familiären Beziehungsverhaltens und -erlebens erwiesen.
Das Resultat:
1) Je nach Beziehungsaspekt, Beziehungskonstellation und Perzeptionsmodus
ergeben sich unterschiedliche Itemszusammenstellungen, jedoch auf das selbe
Beziehungskonstrukt bezogen.
2) Es ergaben sich auch spezifische Beziehungskonstrukte, die bei anderen
nachweisbar waren.
Weiters wurden Faktoren zweiter Ordnung bestimmt, ausgenommen vom EB-Testsystem,
um die Inhaltsstruktur der Beziehungsaspekte auf einer allgemeinen Ebene
zu erfassen. Die dabei gefundenen Sekundärfaktoren führen zu
generellen Beziehungsstrukturdimension.
3) Anwendungsgebiet des FDTS
3.1. Anwendungsfeld Familienberatung
Das FDTS kann hier dazu dienen, um zusätzlich zu sonstigen diagnostischen
Verfahren ergänzende und präzisierende Informationen über
einzelne Beziehungskonstellation sowie individuelle Sichtweisen der einzelnen
Mitglieder zu erhalten.
3.2. Anwendungsfeld Familientherapie
Die aus dem FDTS gewonnenen Informationen hinsichtlich Beziehungsaspekten,
Beziehungskonstellationen und Perzeptionsmodus werden zum therapeutischen
Zwecke genutzt.
3.3 Anwendungsfeld Familienforschung
In diesem Bereich findet das FDTS eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten.
Auszugsweise wären hier folgende zwei Beispiele zu nennen: Studien
zur Analyse innerfamiliärer Interaktionsgepflogenheiten bei traditionellen
und nicht traditionellen Familienformen, sowie Studien zur Analyse der
familiären Beziehungsmuster zu unterschiedlichen Phasen des Familienzyklus,
sowie bei der Entwicklung und Evaluation von Elterntrainingsprogramm.
4) Kritik
4.1. Als erstes sind die allgemeinen Problem bezüglich des
Informationsgewinnes mittels Fragebögen zu nennen, wie zum Beispiel
Antwortstile. Diese Probleme sind jedoch nicht spezifisch, sondern bei
allen Testsystemen auf Fragebogenbasis zu finden. Aufgrund dessen werden
auch andere diagnostische Verfahren in die Untersuchung miteinbezogen.
4.2 Auch gilt es Kritik bezogen auf bestimmte Einzeltests beziehungsweise
Testskalen des FDTS zu üben. Verbesserungen sind hinsichtlich Erhöhung
der Konzeptvalidität einzelner Skalen, Überprüfung der Skalenstabilität
über längeren Zeitraum hinweg, sowie Verzerrungen durch Antworttendenzen
nötig, um nur einige zu nennen.
4.3 Zuletzt ist zu erwähnen, daß das FDTS keine bestimmte
psychologische Theorie als Grundlage hat, sondern sich auf eine Beschreibung
verschiedener Beziehungsaspekte innerhalb der Familie.
5) Praktische Anwendung des FDTS
Es werden dazu zwei Familien B und R miteinander verglichen. Beide haben
einen neunjährigen Sohn, leben in vergleichbaren Städten in Eigenheimen
und werden der oberen Mittelschicht zugeordnet.
Dazu gibt es zwei Hypothesen:
1) Es sind Unterschiede hinsichtlich ihrer intrafamiliären Beziehungen
erkennbar. Diese Unterschiede manifestieren auf unterschiedlichen Ebenen
des Familiensystems und seiner Subsysteme.
2) Differentielle Familiendiagnose wird durch sinnvolle Verknüpfungen
verschiedener Systemebenen innerhalb einer Familie möglich.
5.1. Wahrgenommene Beziehungen auf der Familiensystemebene
Die beiden Familien nehmen ihr Familienklima unterschiedlich wahr. Dies
wurde über die Familienskalen des FDTS erfaßt und die Daten
zusammengefaßt. Das Profil der Familie B läßt erkennen,
daß Zusammenhalt und Offenheit auf niedrigen Niveau sich bewegt,
kulturelle Orientierung sowie aktive Freizeitgestaltung auf Mittleren.
Allgemein liegt eine konfliktgeladene und emotional negative Familienatmosphäre
vor, mit einem hohen Maß an Kontrolle. Bei Familie R wird das Gegenteil
deutlich. Alle Skalen sind stark ausgeprägt, abgesehen von Kontrolle
und Leistungsorientiertheit. Hier finden wir ein zufriedenstellende und
ausgeglichene Familienatmosphäre, wo man füreinander da ist.
5.2. Wahrgenommene Beziehungen auf der Ebene des Ehe Subsystems
Herr und Frau B empfinden ihre Beziehung weitgehend als unbefriedigend.
Dies läßt sich aus der Skala ganz deutlich erkennen, da sich
der Zärtlichkeitswert, bei beiden Eheleuten, auf extrem niedrigen
Niveau bewegt, Ebenso sind hohe Werte an Konfliktgeladenheit, Unzufriedenheit
wie auch Unterdrückung aus der Skala erkennbar. Dies laßt allgemein
auf eine emotional unbefriedigende Beziehung schließen. Im Gegensatz
dazu wird die Beziehung von Herr und Frau R als emotional befriedigend
erlebt. Dies erkennt man daran, daß sich die Kennwerte auf mittleren
Niveau bewegen und in keine extreme Richtung tendieren. Das bedeutet aber
nicht, daß die beiden Eheleute ihre Beziehung als perfekt wahrnehmen,
sondern diese im wesentlichen ausgeglichen ist, gekennzeichnet durch wechselseitige
Akzeptanz.
5.3. Wahrgenommene Beziehung auf der Ebene des Eltern-Kind-Subsystems
Bei Herrn und Frau B wird deutlich, daß sie sich uneinig sind
bezüglich der Erziehung ihres Sohnes. Weiters gibt es Unterschiede
hinsichtlich der Beziehung zu ihrem Sohn. Zwischen Herrn B und seinem Sohn
wird eine emotionale Distanz deutlich, ganz im Gegensatz zu Mutter und
Sohn. Die Ehepartner R haben dagegen keine Probleme ihre erzieherischen
Einstellungen sowie Erwartungen aufeinander abzustimmen, wobei aus der
Skala zu erkennen ist, daß die Mutter die Beziehung zu ihrem Sohn
belastender erlebt als der Vater. Das heißt, im Gegensatz zu Familie
B wird hier eine emotionale Distanz zwischen Sohn und Mutter erkennbar.
5.4. Die Ebene des intrapsychischen Systems
Zur Erfassung der Persönlichkeit der beiden Kinder wurde ein mehrdimensionaler
Persönlichkeitsfragebogen verwendet. Wie zu erwartend, lassen die
Ergebnisse bei dem Sohn der Familie B wesentlich mehr Anzeichen für
eine problematische Persönlichkeitsstruktur erkennen als bei Sohn
R. Dieses Ergebnis läßt sich eindeutig aus der familiären,
ehelichen und Eltern-Kind-Beziehung ableiten.
Allgemein festgehalten: Es ist klar, daß die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur
eines Kindes unproblematischer verläuft, wenn es, in einer Atmosphäre
geprägt von emotionaler Nähe sowie Offenheit aufwächst,
als wenn Eltern Kontrolle auf ihr Kind ausüben, Konflikte nicht besprochen
werden und eine emotionale Distanz in der Eltern-Kind-Beziehung vorherrscht.
6) Persönliche Stellungnahme
6.1. Das Familiendiagnostische Testsystem kann in den verschiedensten
Bereichen genutzt werden und ist außerdem sehr vielfältig bezüglich
der Verwendungsmöglichkeiten. Dies wird meiner Meinung nach vor allem
durch den Aufbau des FDTS möglich, nämlich der Einzeltests. Dadurch
kann ein Test entsprechend dem spezifischen Problem beziehungsweise der
spezifischen Fragestellung gewählt werden. Die Ergebnisse betreffen
dann ausnahmslos dem Gesuchten und umfassen nicht auch unnötige, zusätzliche
Informationen. Dies wäre nicht gegeben, müßte man den ganzen
FDTS anwenden. Das heißt, daß die Anwendung eines einzelnen
Tests aus dem gesamten Testsystems Zeit ersparen kann. Weiters ermöglicht
der FDTS Einblick in die verschiedensten Subebenen des Familiensystems.
Der Tester erhält somit die vielfältigsten Informationen über
die Familie unter Anwendung eines einzigen Testsystems.
6.2. Weiters findet das Familiendiagnostische Testsystem in den
verschiedensten Bereichen Anwendung. Es wird nicht nur eingesetzt um Informationen
über die einzelnen innerfamiliären Beziehungskonstellationen
zu erhalten und dann weiters zu Familien therapeutischen Zwecken sowie
zur Familienberatung verwendet, sondern wird auch in der Familienforschung
genützt. Dies bedeutet, daß hier eine Konstruktion eines Testsystems
gelungen ist, das sehr vielseitig einsetzbar ist. Das ist aber auch vor
allem durch seine, wie oben beschrieben, Vielfältigkeit möglich.
6.3. Durch die Berücksichtigung der Insiderperspektive sowie
Outsiderperspektive bei der Datengewinnung, werden die gewonnenen Informationen
automatisch objektiver. Zumindest mehr als würden die Informationen
nur von Beteiligten stammen. Durch die gewonnenen objektiveren Daten kann
der Therapeut oder Forscher sicher besser agieren.
6.4) Ich möchte nun noch kurz daran Kritik üben, daß
der Test nur für Familien mit bestimmten Alter konstruiert wurde.
Das heißt, dieses Testsystem kann ausnahmslos nur dann angewendet
werden, wenn die Kinder zwischen neun und vierzehn Jahren alt sind. Ein
mögliches Ziel könnte in Zukunft sicher die Erweiterung des Testsystems
sein und dadurch generell nutzbar für Familien.
7) Schlußwort
Zuletzt möchte ich noch sagen, daß mir dieser Artikel Einsicht
in das Familiendiagnostische Testsystem gab. Schlußfolgernd dazu
glaube ich, daß das FDTS durch seine Vielfältigkeit sowie seine
Vielseitigkeit als sehr nutzvoll für viele Bereiche in der Psychologie
angesehen werden kann. Weiters bedarf das FDTS wenig Aufwand bezüglich
Anwendung sowie Auswertung und ist damit auch zeitsparend. All das sind
sicher Gründe warum das FDTS häufig und in den verschiedensten
Bereichen seine Anwendung findet.
Literaturverzeichnis
Schneewind, K. (1991). Familiendiagnostisches Testsystem, S.265-306.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
8) Familienberatung und Familientherapie (Doris
Wölbitsch)
Einleitung
In einer Zeit, wo wir es mit hochkomplexen Lebensverhältnissen,
die zusätzlich noch einem raschen Wandel unterliegen, zu tun haben,
wird es immer schwieriger für die Familien und für den einzelnen
Krisen und Herausforderungen zu meistern.
Somit steigt der Bedarf an angemessener Unterstützung bei der Bewältigung
von Problemen.
Man kann hier zwei Formen der Unterstützung unterscheiden:
-
die informelle Unterstützung : Hier erfolgen Hilfeleistungen
von Personen innerhalb der Familien, oder aber auch von verschiedenen Bereichen
außerhalb der Familien (dazu gehören Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen
usw.).
-
die formelle Unterstützung: In diesen Bereich fallen alle offiziellen
Beratungs- u. Therapieangebote.
Familienberatung und Familientherapie sind als Instrumente der formellen
Familienunterstützung zu sehen.
Ich möchte an dieser Stelle noch eine kurze Definition von " Familie"
einfügen.
In seinem Buch (Schneewind, 1991, S.17) faßt Schneewind familiäre
und quasi-familiäre Personengruppen zusammen zu intimen Beziehungssystemen,
die durch folgende vier Punkte gekennzeichnet sind:
-
Abgrenzung: räumliche und zeitliche Abgrenzung von anderen
Personen und Personengruppen, es gelten bestimmte implizite und explizite
Regeln;
-
Privatheit: hier geht es um das Vorhandensein eines umgrenzten Lebensraums;
-
Dauerhaftigkeit: durch wechselseitige Verpflichtungen, Bindungen
und durch Zielorientierung;
-
Nähe: Realisierung physischer, geistiger und emotionaler Intimität.
Nach einem Modell von Morrill, Oeting und Hurst 1974 (Schneewind, 1991,
S.266) lassen sich 3 Dimensionen der Intervention darstellen:
a.) Adressaten der Intervention
Diese können sein: das Individuum, die Primärgruppe (Familie,
Gleichaltrigengruppen), informelle Gruppen, Institutionen und Gesellschaften
(Schulen, Betriebe, Gemeinden, Parteien etc.).
b.) Ziele der Intervention
Diese unterteilen sich in: Entwicklungsoptimierung, Prävention,
Remediation.
c.) Methoden
Diese beinhalten: Direkte Dienstleistung (hier ist der unmittelbare
Kontakt der Berater, Therapeuten mit einem oder mehreren Klienten gegeben
z. B. im Rahmen der Familientherapie); Konsultation und Training
(hier geht es primär um die Vermittlung von Kompetenzen z. B. im Rahmen
eines Elterntrainings); Medien (hierzu gehören interventionsunterstützende
Hilfen wie Bücher, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsendungen).
Bei einer systematischen Verknüpfung dieser Untergruppierungen
ergeben sich insgesamt 36 Einheiten. Durch dieses weite Spektrum ergeben
sich verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen der Familienberatung
und -therapie.
Es gibt verschiedene Umstände, die eine Familie in die Rolle
des Adressaten bringen:
-
primär familienspezifische Problemlagen: hier werden
mehrere oder alle Familienmitglieder in den Beratungs- u. Therapieprozeß
miteinbezogen.
Dies ist z. B. bei Partnerschafts-, Erziehungs- und Scheidungsproblemen
der Fall.
-
Problemlagen vordergründig individueller Natur: Man
geht hier von der Annahme aus, daß die betreffenden Probleme im Rahmen
der Familie entstanden oder durch sie ausgelöst worden sind, bzw.
durch sie aufrecherhalten werden. Beispiele hierfür sind Anorexie
und Schizophrenie.
-
Externe Einflüsse auf die Familie und Familienmitglieder:Besonders
unvorhergesehene Ereignisse, wie Arbeitslosigkeit, Unfälle, Katastrophen,
können die Familie stark beeinflussen.
-
Familienorientierte Beratung und Therapie bei Individualproblemen:Hier
steht die Stärkung des Selbsthilfepotentials der Familie im Vordergrund.
Mögliche Gründe für diese Form der Beratung sind chronische
Behinderung, Straffälligkeit eines Mitglieds, Drogenabhängigkeit,
etc.
Zur historischen Entwicklung der Familienberatung und Therapie:
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten Erziehungsberatungsstellen
mit dem Ziel der Behandlung verhaltensauffälliger Kinder auf Basis
tiefenpsychologischer Ansätze. Ein Beispiel dafür ist die 1906
in Berlin gegründete Medico-pädagogische Poliklinik für
Kinderforschung, Erziehungsberatung und ärztliche erzieherische Behandlung.
Bis 1922 waren in den Bezirksjugendämtern in Wien 23 Erziehungsberatungsstellen
gegründet worden. Um die selbe Zeit wurden in den USA die sogenannten
Child-Guidance-Kliniken gegründet. Es handelt sich hierbei um ein
interdisziplinäres Modell, bei dem ein Arzt, ein Psychologe und ein
Sozialarbeiter zusammenarbeiten. In Deutschland erfolgte die gesetzliche
Basis für die Aktivitäten der Beratungseinrichtungen 1953 mit
der Novellierung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (von 1923). Aber erst
20 Jahre später erfolgte die schriftliche Festlegung.
Es entstand eine neue Argumentationslinie, wo nun nicht mehr ausschließlich
Verhaltensauffälligkeiten von Kindern- und Jugendlichen im Vordergrund
standen, sondern auch Erziehung und Sozialisationsfähigkeit der Familien
(vom identifizierten Patienten zum Patient Familie).
1968 wurde auf dem Hintergrund der Systemtheorie die Familiensystemtheorie
entwickelt.
Institutionalisierte Beratungsdienststellen haben sich in Deutschland
zum DAK (= Deutscher Arbeitskreis der Jugend-, Ehe- und Familienberatung)
zusammengeschlossen.
Familienberatung und Familientherapie im Kontext
Das Modell von Bronfenbrenner (Rödler, 1993) zeigt deutlich, daß
man die Familie nie isoliert betrachten darf, sondern auch außerfamiliäre
Lebenskontexte berücksichtigen muß. Die einzelnen Systeme stehen
in ständiger Wechselwirkung zueinander, sowie auch innerhalb jedes
Systems Wechselwirkungen stattfinden.
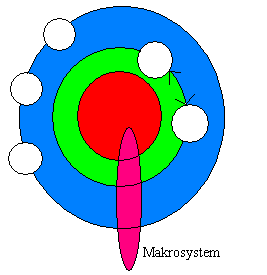 Mikrosystem: wechselt nach unmittelbaren Lebensbereich;
inkludiert Personen, Situationen, materielle Begebenheiten
Mikrosystem: wechselt nach unmittelbaren Lebensbereich;
inkludiert Personen, Situationen, materielle Begebenheiten
Mesosystem: z. B. Schule und Familie - Wechselwirkungen
treten auch unabhängig vom Individuum in Kraft
Exosystem: z. B. Unterrichtsministerium und Sozialamt
Makrosystem: Beeinflussungsgrößen wie
Religion und Kultur, die auf alle 3 Systeme einwirken.
In dem Modell von Markman, Floyd, Stanley und Lewis (Schneewind, 1991,
S.273) werden diese kontextbezogenen Aspekte berücksichtigt. Es wurde
ursprünglich für den Bereich der Prävention beim Übergang
zur Ehe entwickelt, ist aber auch allgemeiner anwendbar. Die Autoren definieren
hier vertikale Stressoren und Ressourcen und horizontale Stressoren.
Vertikale Stressoren und Ressourcen beziehen sich auf historisch
gewachsene in die Gegenwart hineinwirkende Gegebenheiten. Dazu gehören
Gegebenheiten des sozialen Systems (ökonomische Bedingung
von Familien, Werthaltungen, ...), Gegebenheiten des transgenerationalen
Systems (Beziehung zu Eltern, Schwiegereltern, ...), Gegebenheiten
des gegenwärtigen Familiensystems (familiäre Kommunikations-,
Interaktions- und Problemlösungsmuster) und Gegebenheiten des Persönlichkeitssystems
(physische, psychische Gesundheit, personale Kontrolle, soziale Kompetenzen).
Die horizontalen Stressoren lassen sich grob in normative
(dazu
gehören Übergänge und Phasen im Familienlebenszyklus; z.
B. Übergang zur Elternschaft, leeres Nest, ...) und nicht-normative
(unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Trennung, Scheidung, Todesfall)
unterteilen.
Die Balance Stressoren - Ressourcen hat einen großen Einfluß
auf die Verletzlichkeit einer Familie. Je stärker das Potential vertikaler
Ressourcen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Familie
mit Stressoren erfolgreich fertig wird.
Ansatzpunkte der Familienberatung und Familientherapie
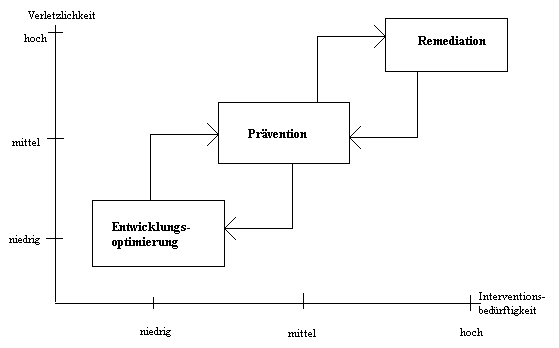
Dieses oben dargestellte Modell (vgl. Schneewind 1991, S.275) geht von
der These aus, daß die Interventionsbedürftigkeit einer Familie
mit dem Verletzlichkeitsniveau steigt.
Es wird angenommen, daß nach einer erfolgreich verlaufenen Phase
der Entwicklungsoptimierung bzw. nach der Prävention eine Phase der
Prävention bzw. Remediaton auszuschließen ist.
Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anstiegs des Verletzlichkeitsniveaus
wird auch dadurch gesenkt, indem man an eine erfolgreich abgelaufene Remediation
eine Phase der Prävention und eine Phase der Entwicklungsoptimierung
anhängt.
Nun Genaueres zu den einzelnen Interventionsmöglichkeiten:
Remediation
Die Remediation betrifft speziell Familien mit einer sehr hohen
Verletzlichkeit, diese Familien werden auch als "auffällig" bezeichnet.
Hier geht es um Symtome, die von der Familie selbst oder von anderen Bereichen
des gesellschaftlichen Systems als dysfunktional und Behandlungsbedürftig
gesehen werden. (Hier wäre eine umfassende systemische Diagnostik
wesentlich, um eventuelle Ettikettierungen zu vermeiden.)
Diese Symptome können sein:
auf der Individualebene:
- Alkohol und Drogenmißbrauch
- kriminelles Verhalten
- Depressionen
- Phobien
auf Familienbeziehungsebene:
- Chronische Partnerschaftskonflikte
- manifeste sexuelle Probleme
- Mißhandlungen von Kindern, Frauen, älteren Menschen
Die Behandlung dieser Symptome fällt in den Bereich der klinischen
Familienpsychologie und das Behandlungskonzept wird als familientherapeutisch
bezeichnet.
Prävention
Die primäre Zielgruppe dieser Art der Intervention sind die Risikofamilien.
Hier ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens bzw. des Wiederauftretens
von behandlungsbedürftigen Symptomen (auf Individual- oder Familienbeziehungsebene)
hoch. In diesen Bereich fällt die Rückfallsprophylaxe bei psychischen
Störungen und massiven Beziehungsproblemen, sowie die Abwendung von
voraussehbaren Fehlentwicklungen aufgrund normativer und nicht-normativer
horizontaler Stressoren im Familienlebenszyklus wie Erziehungsschwierigkeiten
oder Übergang zu Scheidungsphase.
Auszüge aus dem Therapieangebot:
a) Einüben von Kommunikationsfertigkeiten
b) Lösung von Problemen und Konflikten
c) Kontrolle personeninterner Zustände, die einer guten Kommunikation
im Wege stehen (Selbstbehauptung, Selbstbeherrschung).
Die Prävention läßt sich in drei Bereiche teilen:
Die primäre Prävention: Hier geht es um eine Verknüpfung
von Entwicklungsoptimierung und Prävention mit dem Hauptziel der Stärkung
vertikaler Ressourcen.
Die sekundäre Prävention: Diese besteht aus einer Verbindung
von Prävention und Remediation mit dem Ziel der Verhinderung erwartbarer
Symptome. In diesen Bereich entfällt auch Gordon´s Familienkonferenz
(vgl. auch Schneewind, 1991,S. 284).
Ich möchte dieses in den 70-er Jahren entstandene Programm hier
nur grob umreißen.
Es besteht aus einem Kurs zu 8 Wochen und beinhält Kurzvorträge,
Rollenspiele, Diskussionen und Hausaufgaben.
Die Ziele dieses Programms sind:
- aktives Zuhören (einfühlsame, akzeptierende Haltung gegenüber
dem Kind)
- Ich-Botschaften (klare und direkte Vermittlung von Gefühlen)
- Konfliktlösungen nach der "keiner- verliert- Methode"
Überprüfungen des Programms ergaben allerdings nur eine mittlere
bis schwache, über die Zeit rasch abnehmende Effektivität.
Die tertiäre Prävention:
Auch hier besteht die Intervention aus einer Verbindung von Prävention
und Remediation, jedoch erfolgt sie in zwei Schritten. Der erste Schritt
besteht aus einer remedialen Intervention zur Verringerung der Verletzlichkeit
und durch anschließende präventive Maßnahmen soll der
therapeutische Effekt gefestigt werden.
Entwicklungsoptimierung
Dieser Schritt der Intervention kommt oft bei unauffälligen Familien
zur Anwendung mit dem Ziel der Steigerung und Entfaltung der Möglichkeiten
der Einzelperson und der Beziehungspartner. Es soll eine Verbesserung des
Beziehungsklimas und der Beziehungsfertigkeiten erreicht werden.
Empirische Überprüfungen verschiedenster Programme hiezu ergaben
jedoch nur eine mittlere bis schwache Effektivität und eine rasche
Abnahme über die Zeit. Auffrischungskurse wären hier nützlich.
Wie schon weiter oben erwähnt, wäre es von Vorteil, alle Lebensräume
einer Familie in das Behandlungskonzept mit einzubeziehen Þ
Beratungsfelder für eine integrative Familienberatung:
1. Familie und Gesundheit: In diesen Bereich fallen medizinische
Gesundheitsberatung (Hygieneberatung, Krankheitsprävention, genetische
Beratung) und psychosoziale Gesundheitsberatung (Beratung bei psychischen
Problemen, Erziehungsberatung und Partnerschaftsberatung).
2. Familie und Ernährung: In engem Zusammenhang mit dem
Gesundheitsbereich; familienorientierte Ernährungsberatung (Beratung
im Sinne einer gesundheitsförderlichen Kostgestaltung, Beratung bei
medizinischen Indikationen).
3. Familie und Ökonomie: Beschäftigt sich mit Belangen
des Familienbudgets (Konsumberatung, Altersvorsorgeberatung)
4. Familie und Wohnumwelt: Hier geht es um Unterstützung
beim Erwerb und bei der Gestaltung von Wohnraum für Familien (Sicherheitsberatung);
familienorientierte Umweltberatung (Beratung zur Infrastruktur der Nahumgebung
und ihrer Nutzungsmöglichkeiten).
5. Familie und soziale Netzwerke: Die Familie sollte hier aufmerksam
gemacht werden auf soziale Unterstützungssysteme bzw. noch nicht vorhandene
sollen initiiert werden (Selbsthilfegruppen, kirchliche Unterstützungsangebote).
6. Familie und Bildungssystem: Hier sollen alle Fragen behandelt
werden, die das Bildungssystem betreffen (Schul- und Laufbahnberatung,
berufliche Weiterbildung).
7. Familie und Beschäftigungssystem: Das Ziel der Beratung
ist hier die Integration von Familien bzw. deren Mitgliedern in das Beschäftigungssystem
(Berufsberatung, Beratung im Zusammenhang mit Arbeitsplatzverlust).
8. Familie und Freizeit: Hier werden Fragen der Ferien- und Freizeitgestaltung
behandelt (Nutzung von Massenmedien, Möglichkeiten von Sport, Spiel
und kulturellen Betätigungen).
9. Familie und Rechtssystem: Betrifft alle Fragen, bei denen
die Familien mit dem Rechtssystem in Berührung kommen (Familienrecht
und andere Rechtsbereiche).
10. Familie und Staat: Hier geht es um das Angebot von monetären
und nicht-monetären Angeboten der Familienpolitik auf Ebene von Bund,
Ländern und Gemeinden.
Da dieses reichhaltige Angebot von Beratungsmöglichkeiten nicht
von einer Institution alleine getragen werden kann, sind zur Verwirklichung
dieses Konzepts die folgenden 5 Punkte wesentlich:
-
Systematische Dokumentation von Beratungsangeboten:
Eine systematische Dokumentation als hilfreiche Informationsquelle in
regionaler und überregionaler Ausgestaltung;
-
Vernetzung von Beratungsangeboten:
Voraussetzung hiefür ist 1.); Ziel ist eine stärkere
Verknüpfung und Koordination von Beratungsangeboten zur Informationsvermittlung
und zur Stärkung der Zusammenarbeit auf persönlicher und institutioneller
Ebene zwischen den einzelnen Beratungsfeldern.
-
Informationsabruf von Beratungsangeboten:
Hier gibt es mehrere Formen (z. B. Massenmedien), es sollten aber neben
nicht-personalen Informationsquellen auch persönliche Beratung und
Information angeboten werden. Ideal hierfür wäre eine Anlaufstelle
auf regionaler Ebene.
-
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen
-
Forschung im Bereich der Familienberatung
Beratungsformen
Man unterscheidet zwischen nicht-personaler und personaler Familienberatung.
1. Bei der nicht-personalen Familienberatung besteht kein unmittelbar
persönlicher Kontakt zwischen dem Klienten und den Beratern. In diesen
Bereich fallen alle einschlägigen Angebote der Medien (z. B. Beratungsliteratur,
Hörfunk, Fernsehen, neue Medien). Es geht hier primär um die
Vermittlung von Sachwissen und praktischen Kenntnissen. Der Nachteil dieser
Form der Beratung ist, daß kaum eine Einstellung auf die spezifische
Problemlage möglich ist und daher keine Rückmeldungen gegeben
werden können. Zwischen den Angeboten gibt es außerdem teils
beträchtliche Qualitätsunterschiede.
2. Bei der personalen Familienberatung ist der persönliche
Kontakt gegeben. Es gibt eine Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten
(Setting, Zeit, Profesionalität, Schulenzugehörigkeit, Beratungsumfang,
Kosten).
Obwohl der Bedarf an Familienberatung groß ist und eine hohe Nachfrage
herrscht (Wartezeiten bei institutionellen Anbietern bis zu 7 Wochen),
gibt es eine noch verhältnismäßig geringe Zahl von institutionellen
Anbietern in Deutschland und Österreich. Im Gegensatz zu den USA,
wo es bereits auf Universitäten viele Programme für Graduierte
und Postgraduierte gibt, fehlt in Deutschland "ein akademisches Gegengewicht"
(Schneewind, 1991, S. 298) zu den in den letzten Jahren zahlreich entstandenen
nicht-institutionalisierten selbsternannten Familienberatungsstellen. Ein
großes Problem besteht darin, daß es weder in Österreich
noch in Deutschland professionelle Maßstäbe für die Ausbildung
und Praktizierung von Familienberatung und Familientherapie gibt.
Zusammenfassung
In meinem Referat habe ich drei Formen der Intervention bei Familienberatung
und Familientherapie vorgestellt: Entwicklungsoptimierung, Prävention
und Remediation.
Für jede Form gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten.
Ideal wäre es, den Familien ein umfassendes Beratungsangebot alle
Lebensbereiche betreffend bieten zu können. Man darf die Familie nie
isoliert betrachten, denn auch außerfamiliäre Ereignisse können
einen großen Einfluß auf ihre Befindlichkeit haben.
Es muß aber in den folgenden Jahren noch sehr viel in Richtung
Ausbildung geschehen, um eine professionelle Beratung bieten zu können,
was meiner Meinung nach sehr wesentlich ist. Von vielen derzeit angebotenen
alternativen Formen bin ich nicht immer so ganz überzeugt (z. B. Bioresonanz-
Methode ... ich lasse mich aber gerne überzeugen).
Literatur:
Schneewind, K. (1991). Familienpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Rödler, P. (1993). Menschen, die Lebenslang auf die Hilfe
anderer
angewiesen sind Grundlagen einer allgemeine basalen Pädagogik.
Frankfurt/Main: AFRA-Verlag.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
9) Einstellungen zur Familie (Anita
Wisberger)
Einleitung
Im Europa der letzten 20 - 30 Jahre zeichnen sich aufgrund der statistischen
Daten zwei wesentliche Trends in der Entwicklung der Familien ab. Einerseits
hat sich die Geburtenrate bei durchschnittlich zwei Kindern pro Familie
(oft auch nur Frau) eingependelt. Das heißt, es ist im Vergleich
zu früher von einem Geburtenrückgang auszugehen. Andererseits
nimmt die Anzahl der Scheidungen zu und (angeblich) auch die Anzahl der
Eheschließungen ab.
Allgemein werden diese Trends, vor allem von den Medien, als ein Bedeutungsverlust
der Institution der Ehe und Familie interpretiert.
Wie sehen nun die Betroffenen selbst dieses Phänomen? Hat die Familie
tatsächlich durch die vielfältigen Beziehungsformen und Lebensstile,
die derzeit in vielen Ländern bereits nebeneinander bestehen und auch
im wesentlichen toleriert werden, an Bedeutung verloren?
Im folgenden möchte ich einen kleinen Überblick über
die wesentlichsten Ergebnisse verschiedener Studien geben, die sich mit
der Einschätzung bzw. Einstellung der Befragten beschäftigen.
Auch die laienhafte Interpretation statistischer Daten soll kurz problematisiert
werden, ebenso die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Studien
miteinander. Zu guter letzt soll noch eine Interpretation der Statistiken
über die Ehescheidungen und den verringerten Kinderwunsch im Zusammenhang
mit den bekundeten Einstellungen der Befragten versucht werden.
Anmerkung zur Interpretation der Daten
Was können uns die Statistiken tatsächlich mitteilen?
Ein wesentliches Faktum, das meines Erachtens oft übersehen wird,
ist, daß Statistiken über Daten wie Scheidungen, Verehelichung
und Kinderanzahl qualitative Merkmale erheben. Das heißt, wir können
maximal
die Häufigkeit, mit der etwas eingetreten ist oder eben nicht
eingetreten ist, feststellen. Wir können jedoch nichts über die
Ursachen, warum etwas eingetreten ist, aussagen. Es ist unter anderem auch
eine Aufgabe von Psychologen, darauf hinzuweisen, daß auf Grund von
Häufigkeiten keine Motivanalysen durchgeführt werden können
(wir bewegen uns auf Nominalskalenniveau!). Im Falle der Interpretation
der vorweg genannten Scheidungs- und Geburtenstatistiken als "Bedeutungsverlust",
findet dies jedoch statt. Tatsache ist, daß ein Phänomen auftritt.
Dieses Erkennen eines Phänomens kann Grundlage für weitere Forschung
sein. Das Phänomen an sich kann uns jedoch keinerlei Aussagen über
die Ursachen, die dazu führten, mitteilen.
Probleme der Einstellungsforschung
-
Das Problem der Validität der Ergebnisse ist ein bei methodischen
Erhebungen unumgängliches. Bewirkt wird dieses im Zusammenhang mit
unserem Thema vor allem dadurch, daß den meisten Untersuchungen die
oft implizite Theorie der Maslow´schen Bedürfnishierarchie
zu Grunde liegt, welche in eine eindimensionale Wertehierarchie transponiert
wird.
-
Weiters wird bei der Erhebung von Einstellungen unter anderem auch die
aktuelle Befindlichkeit erhoben. Man kann (meist) nicht unterscheiden,
ob es sich um kurzfristige Reaktionen auf aktuelle Zustände (Befindlichkeiten)
oder um überdauernde Einstellungen zum erfragten Bereich handelt,
sofern man keine Längsschnittstudien durchführt.
-
Die Interpretation als Generationseffekt ist immer problematisch. Tatsächlich
stehen uns für keine Generation Längsschnittdaten zur
Verfügung. Man kann also in Wirklichkeit zwischen Alterseffekten und
Generationseffekten auf Basis unserer Informationen nicht unterscheiden.
-
Außerdem wurden die erhobenen Variablen bei den verschiedenen Untersuchungen
unterschiedlich operationalisiert.
Diese Probleme sind bei der Interpretation der Ergebnisse immer auch mit
zu bedenken.
Einige Ergebnisse zum Thema Familie, Ehe und Kinder
Etliche empirische Erhebungen, oft im Rahmen der Familiensoziologie,
befaßten sich bereits mit der Erforschung von Fragestellungen zur
Bedeutung
von Familie, Zufriedenheit mit Familie, Bewertung der aktuellen Trends.
Die dargestellten Ergebnisse wurden im Zuge umfassenderer Fragestellungen
erhoben, sie befaßten sich also nicht ausschließlich mit obigen
Fragestellungen.
Folgende Einstellungen/Einschätzungen werden kurz dargestellt:
-
Bewertung der derzeitigen Trends (Geburtenrückgang, Scheidungshäufigkeit)
-
Gründe (nach Einschätzung der Befragten) für den Geburtenrückgang
allgemein
Persönliche Gründe gegen (weitere) Kinder
-
Subjektive Bedeutung von Familie und Kindern
-
Gründe für Eheschließung
-
Zufriedenheit mit der bestehenden Ehe
-
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ad 1) Bewertung der derzeitigen Trends (Geburtenrückgang, Scheidungshäufigkeit)
Die allgemeine Meinung zu den aktuellen Trends ist überwiegend
negativ. Dies ist auch das Ergebnis in internationalen Studien. Das
heißt, es wird als "bedenklich" empfunden, daß immer weniger
Kinder pro Familie geboren werden und daß immer öfter Ehen geschieden
werden. Auch die Zunahme an Alleinerziehern wird nicht gutgeheißen.
Man steht jedoch den verschiedenen Lebensformen zunehmend toleranter gegenüber.
Die Toleranz ist allerdings abhängig von der Verbreitung der jeweiligen
Lebensformen in einem Land (Gewöhnungseffekt).
Ad 2) a) Gründe (nach Einschätzung der Befragten) für
den Geburtenrückgang - allgemein
-
Egoismus - Konkurrenz mit anderen Lebenszielen wie: Karriere, Wohlstand,
persönliche Bequemlichkeit,..
-
ökonomische, politische, soziale Gründe (Arbeitslosigkeit, Wohnverhältnisse,
allgemeine wirtschaftliche Lage, ...)
b) Persönliche Gründe gegen (weitere) Kinder:
-
gewünschte Kinderanzahl bereits erreicht (Ö 59%, D 60%, NL 61%,
CH 69%)
-
Gesundheitszustand (CZ, SL zu 60%, NL 43%, CH 56%)
-
Wohnverhältnisse (CZ, SL 33%)
-
Alleinlebend, ohne festen Partner (CZ, SL 34%, CH 59%)
-
Konkurrenz zu sonstigen Lebenszielen (kaum)
-
Sorgen um die Zukunft des Kindes (ca. ein Drittel der Befragten in allen
Ländern mit Ausnahme der Italiener)
-
Benachteiligung bereits vorhandener Kinder (CZ, SL 28%, CH 31%)
Ad 3) Subjektive Bedeutung von Familie und Kindern
Die subjektive Bedeutung von Familie und auch von Kindern ist allgemein
sehr hoch. Auch im internationalen Vergleich wird der Wert einer eigenen
Familie, und für Jugendliche als Zukunftsperspektive, der Wert eigener
Kinder, als wesentlicher Wert im eigenen Leben betrachtet und auch
angestrebt. Die Ehe wird keineswegs als überholte Einrichtung empfunden.
Vor allem Kinder sind nach wie vor ein vorrangiger Wert im Leben der
Menschen.
Die überwiegende Mehrheit hat Kinder gerne um sich und gibt auch
an, daß die engste Beziehung, die man haben kann, jene zu den eigenen
Kindern ist (Ausnahme: NL mit nur 36% Zustimmung).
Ad 4) Gründe für Eheschließung
Als einer der häufigsten Gründe für die Entscheidung
zu einer Ehe wird nach wie vor ein vorhandener Kinderwunsch bzw. eine bestehende
Schwangerschaft genannt.
Wobei vieles darauf hinweist, daß nicht so sehr auf Grund äußerer
Faktoren (Meinung der anderen, Benachteiligung von unehelichen Kindern
und ledigen Müttern,..) eine Ehe geschlossen wird, sondern, daß
man die Ehe als die richtige Sozialisationsinstanz für Kinder ansieht.
Weiters erwartet man zunehmend die Erfüllung grundlegender emotionaler
Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Ehe. Ein Zeichen für den
Bedeutungswandel, dem die Institution der Ehe in den letzten 20 Jahren
unterlegen ist. Waren früher hauptsächlich externe Faktoren ausschlaggebend,
so nehmen derzeit die persönlichen (internen) Gründe zu. Das
heißt aber auch, daß es zu einer sehr hohen Erwartung an die
Ehe kommt, welche sich bei Frustration in der Zunahme der Scheidungshäufigkeiten
niederschlägt. Auch wirkt sich die veränderte rechtliche Lage,
die eine leichtere Revision dieser Entscheidung zuläßt, auf
die Anzahl der Scheidungen aus.
Ad 5) Zufriedenheit mit der bestehenden Ehe
Ein interessantes Ergebnis liefert die Befragung nach der Zufriedenheit
mit der bestehenden Ehe. Die Mehrheit aller Befragten, sowohl Männer
als auch Frauen, gibt an, mit ihrer bestehenden Ehe zufrieden zu sein.
Und, auch im internationalen Vergleich, sind Männer sogar noch zufriedener
als Frauen. Die Konfliktwahrnehmung ist zwar gestiegen und viele haben
bereits Krisen in ihrer bestehenden Ehe erfahren, die positive Bewältigung
solcher Krisen scheint sich jedoch in der Folge auf die Zufriedenheit auszuwirken.
In diesem Zusammenhang dürfen jedoch die eingangs erwähnten Probleme
bei der Interpretation solcher Ergebnisse nicht vergessen werden. Die Unterscheidung,
ob es sich um eine kurzfristige Reaktion auf äußere Faktoren
(bzw. einen aktuellen Zustand) oder um ein überdauerndes Merkmal handelt,
ist schwierig und wahrscheinlich auf Grund dieser Daten nicht eindeutig
möglich.
Ad 6) Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, wie könnte es anders
sein, vorwiegend ein Problem der Frauen. Sie sind nach wie vor mehrheitlich
davon betroffen, das "time-management", welches in zunehmenden Ausmaß
mit der Kindererziehung verbunden ist, im Griff zu haben. Es wurden daher
in einer internationalen Erhebung (1) Frauen zwischen 20 und 39 Jahren
zu diesem Thema befragt. Die Mehrheit hält Kinder und einen Vollzeitjob
nicht für vereinbar. In den ehemaligen Ostblockländern (CZ, SL)
sind sogar 67% der befragten Frauen dafür, daß frau keinen
Job haben sollte, wenn Kinder vorhanden sind. Dies dürfte unter anderem
auf die zunehmend gespannte Lage am Arbeitsmarkt zurückzuführen
sein. Diese begünstigt die "Zurück-an-den-Herd-Mentalität".
Die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß nach einer Kinderpause
ist dadurch erheblich erschwert. Lediglich bei den Italienerinnen können
sich 11% vorstellen, sogar einen Vollzeitjob mit mehreren Kindern in Einklang
bringen zu können. Allgemein wird Teilzeitarbeit für die Mütter
als Lösung des Konfliktes "Familie - Beruf" angesehen und von der
Politik werden mehr und innovative Maßnahmen erwartet, welche diesen
Konflikt entschärfen.
Zusammenfassung
Die aktuellen Trends in der Entwicklungen der Ehe- und Geburtenstatistiken
werden allgemein negativ bewertet, trotzdem nimmt die Toleranz gegenüber
anderen Lebensstilen zu.
Als Gründe für die Geburtenrückgänge werden sowohl
persönliche Gründe ("Egoismus"), als auch allgemeine Faktoren
genannt (ökonomische, soziale, politische) gesehen. Für die persönliche
Entscheidung gegen (weitere) Kinder ist, vor allem in den Wohlstandsländern
(Ö, D, NL, CH) ausschlaggebend, daß die gewünschte Kinderanzahl
bereits erreicht ist. In den ärmeren Ländern wird vor allem der
eigene (schlechte) Gesundheitszustand und die Wohnverhältnisse als
Grund gegen (weitere) Kinder angegeben. Bei allen Befragungen konnte festgestellt
werden, daß Ehe, Familie und Kinder keineswegs an Bedeutung verloren
haben - eher im Gegenteil. Allerdings haben sich die Ansprüche, welche
an eine Ehe und auch an die Kindererziehung gestellt werden, geändert.
Standen früher vorwiegend materielle Gründe für eine Ehe
und auch für Kinder im Vordergrund, und war die Familie ein multifunktionaler
Ort, so sind derzeit sehr hohe emotionale Erwartungen an die Ehe geknüpft,
und die Aufgabe der Ehe wird vorwiegend in der Sozialisation der Kinder
gesehen. Das heißt, es kommt zu einer zunehmenden Spezialisierung
der Funktion der Familie. Die Innenzentrierung der Ehepartner auf die Familie
nimmt zu, gleichzeitig nimmt aber auch die Wichtigkeit von äußeren
Sozialkontakten des einzelnen Ehepartners zu. Vor allem Frauen betonen
die Bedeutung von eigenen Sozialkontakten. Möglicherweise entsteht
so eine Wechselwirkung zwischen dem "In-System" (Familie) und dem "Out-System"
(restliche Beziehungen), welche zu den bekundeten hohen Zufriedenheitswerten
beiträgt (2). Politische Maßnahmen, welche die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie erleichtern würden, wären nach Sicht der
Betroffenen wünschenswert. Allgemein dürften die hohen Erwartungen
an die Ehe und die Ansprüche im Zusammenhang mit der Kindererziehung,
aber auch die zunehmende Sensibilisierung für Konflikte häufig
zu einer Überforderung des Systems "Familie" führen.
Stellungnahme
Vor allem die Interpretation des Bedeutungswandels der Ehe und die damit
zusammenhängenden Ansprüche, die an eine Lebensgemeinschaft gestellt
werden, scheinen mir beachtenswert. Wie sich in den Untersuchungen zeigt,
ist die Aufmerksamkeit für Konflikte gestiegen. Dies geht aber nicht
zwangsläufig einher mit einer gestiegenen Konfliktfähigkeit.
Es ist anzunehmen, daß über die tatsächlichen Erwartungen,
mit denen in eine Ehe hineingegangen wird, vorher nur äußerst
selten explizit gesprochen wird. Da viele Ehen in jungen Jahren eingegangen
wird, stellt sich die Frage, ob sich die Betroffenen überhaupt selbst
im klaren sind, welche Ansprüche sie haben. In einer Gesellschaft,
deren Werte wesentlich auch von den Medien mitbestimmt werden, spukt das
Modell der Familie als Ort der Geborgenheit und des emotionalen Rückhaltes
in den Köpfen der Leute. Dies ist nicht gleichbedeutend mit konfliktfreiem
Raum. Nichtsdestotrotz scheint dies aber oftmals stillschweigend angenommen
zu werden. Konflikte können sowohl innerhalb des Systems auftreten,
als auch in der Interaktion des Systems mit der Außenwelt und auch
des einzelnen als Teils sowohl inner- als auch außerfamiliärer
Systeme. Es kommt also in der Realität zu vielfältigen Wechselwirkungen,
welche wiederum Anlaß für Konflikte sein können und diese
finden auch ihren Niederschlag in der Familie. Problematisch erscheint
vor allem die überwiegend negative Konnotation von Konflikten. Häufig
werden sie als Bedrohung für das bestehende System empfunden. Es wäre
daher eine Umdeutung von "Bedrohung" zu "Herausforderung" notwendig, um
das produktive Potential, welches Konflikte auch beinhalten, mehr herauszustellen.
Allerdings scheint derzeit noch ein Mangel an Modellen (Vorbildern) im
Umgang mit Konflikten zu herrschen. Die Neigung, eher die Flucht (in die
nächste Beziehung) zu ergreifen, statt sich einer Herausforderung
zu stellen, ist groß. Ein weites Betätigungsfeld für systemische
Familientherapeuten steht also offen.
Ein weiterer Faktor, der durchaus bezeichnend für unsere derzeitige
Lebensform ist, ist die Kurzlebigkeit. Diese symbolisiert sich auf den
Ebenen des familiären Geschehens ebenso, wie im Umgang mit den Dingen
des Alltags. Alles scheint austauschbar, auch die Familie. Die rechtlichen
Erleichterungen in bezug auf Trennungen und also einer Revision der Entscheidung
zur Ehe sind "Gott sei Dank" ein gegebenes Faktum. Vielleicht sollte man
aber für die Zukunft doch einen Ehevertrag, der bewußt
von den Partnern mit gestaltet wird, als Grundlage jeder Ehe einführen.
Es könnte (sollte) zu einer Auseinandersetzung (im Sinne des Wortes:
sich mit etwas/jemanden auseinandersetzen, unterschiedliche Einstellungen
klären) der Partner bereits im Vorfeld der Ehe kommen. Vielleicht
sollten Mediatoren nicht erst im Zuge der Scheidung eingesetzt werden,
sondern bereits bei "Vorbereitungslehrgängen" zu einer Ehe als "Katalysator"
dienen. Sie könnten die Möglichkeit zur Kommunikation über
die jeweiligen Erwartungen an die Ehe schaffen und so vielleicht einiges
vorweg klären.
Faktoren wie die festgestellte Kurzlebigkeit, aber auch ein Mangel an
traditionellen Werten und Umgangsformen führen auf der emotionalen
Ebene zu Bedürfnissen, welche sich unter anderem auch in den Erwartungen
an die Ehe äußern. Auch die hohe Bedeutung, die Kinder derzeit
haben, spiegelt diese Bedürfnisse wieder. Diese hohe Wertigkeit von
Kindern in unserer Zeit findet jedoch auch ihren Niederschlag in den Ansprüchen,
welche Mütter/Väter an ihr eigenes Erziehungsverhalten haben.
Sie sind sich zunehmend ihrer Bedeutung als Sozialisationsinstanz bewußt,
was aber oft Verunsicherung zur Folge hat (Pädagogisierung der Kindheit).
So müssen sie oft die Erfahrung machen, daß hohe Ansprüche
mit großem Zeitaufwand und auch mit hoher psychischer und physischer
Belastung einhergehen. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis: viele empfinden
ein Kind als anstrengend genug und wollen kein weiteres mehr.
Zusammenfassend kann vielleicht gesagt werden, daß überhöhte
Ansprüche,
sowohl im Zusammenhang mit der Kindererziehung als auch mit der Institution
Ehe in Kombination mit erhöhtem Problembewußtsein und mangelnder
Konfliktfähigkeit eine Mischung ergeben, welche unter anderem auch
zur erhöhten Scheidungsrate und Geburtenrückgängen führt.
Literaturverzeichnis
Gisser, R., Holzer, W., Münz, R & Nebenführ, E. (1995).
Familie
und Familienpolitik in Österreich. Wissen, Einstellungen, offene Wünsche,
internationaler Vergleich. Wien: Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie.
Nave-Herz, R. (1989). Zeitgeschichtlicher Bedeutungswandel von Ehe und
Familie in der Bundesrepublik Deutschland. In R. Nave-Herz & M. Markefka
(Hrsg.), Handbuch der Familien- und Jugendforschung (Bd. 1) (S.
211 - 221). Neuwied: Luchterhand.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
10) Nichteheliche Lebensgemeinschaften(Petra
Stögerer)
Einleitung
In meinem Referat beschäftigte ich mich mit der Thematik der "nichtehelichen
Lebensgemeinschaften" sowie mit "nichtkonventionellen Lebensformen".
Die Ehe als soziale Institution ist sehr alt. Das Ziel dieser Institution
scheint zu sein, der Gemeinschaft gegenüber zu betonen, daß
eine Frau mit einem Mann eine Einheit bildet und daß die Kinder,
die von der Frau geboren werden, ebenso zu dieser Gemeinschaft zählen.
Heutzutage gibt es eine Vielzahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften
mit eheähnlichem Charakter, zum Beispiel in Südamerika, der Karibik
und den USA. Dort findet oftmals aus ökonomischen Gründen keine
Heirat statt. Das Fest selbst und die Einladung von Freunden etc. sind
zu teuer beziehungsweise ist kein eigener Haushalt vorhanden. Wenn dann
zu einem späteren Zeitpunkt mehr Geld vorhanden ist, verbleiben die
Paare oft aus Gewohnheit in der eheähnlichen Gemeinschaft.
In Schweden zogen Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen aufgrund
der starken Industrialisierung nach Stockholm, wo großer Wohnungsmangel
herrschte. Viele hatten keinen eigenen Haushalt, konnten deshalb nicht
heiraten, sondern es lebten mitunter mehrere Paare unverheiratet in einem
Haushalt zusammen. Diese Lebensform genoß allerdings kein besonderes
Ansehen und wurde nur als Durchgangsstadium bis zur Eheschließung
betrachtet. Außerdem gab es in Schweden um 1900 nur die Staatskirche,
wodurch eine Heirat nur kirchlich möglich war. Die Forderung nach
Einführung der standesamtlichen Eheschließung brachte den Wunsch
nach Entscheidungsfreiheit zwischen kirchlicher und standesamtlicher Trauung
zum Ausdruck. Eine weitere Form von nichtehelicher Lebensgemeinschaft stellt
das sogenannte "Living Apart Together" dar, das vor allem in den Niederlanden
praktiziert wird. Beide Partner haben eine eigene Wohnung und wohnen teilweise
zusammen.
Hauptteil
Veränderung der Heiratsquoten
In der Folge möchte ich den rapiden Rückgang der Eheschließungsquoten
anhand der beiden Staaten USA seit Mitte der siebziger Jahre und Schweden
seit 1966 veranschaulichen. Dieser Rückgang ist in ganz Europa zu
beobachten, wobei aber Dänemark, Schweden, die Niederlande sowie Deutschland
führend sind. Außerdem zieht sich der Rückgang quer durch
alle Altersgruppen, jedoch kann man folgende Aussage ziehen: je jünger
die Paare sind, desto größer ist der Rückgang.
Allerdings bedeutet der Rückgang der Eheschließungsquote
keinen Anstieg der Quote der Alleinlebenden, da dieser Rückgang durch
den Anstieg der nichtehelichen Lebensgemein
schaften quantitativ mehr als ausgeglichen wird. Nun möchte ich
anhand von zwei Tabellen die Eheschließungsquoten illustrieren.
Eheschließungsraten auf 1000 nichtverheirateter Frauen in Schweden
und USA
| |
USA
|
Schweden
|
| Alter |
1966
|
1983
|
Differenz (in %)
|
1966
|
1983
|
Differenz (in %)
|
| 18 - 19 |
163
|
75
|
-54
|
39
|
4
|
-90
|
| 20 - 24 |
262
|
116
|
-56
|
194
|
41
|
-79
|
| 25 - 29 |
189
|
127
|
-33
|
175
|
72
|
-59
|
| 30 - 34 |
135
|
98
|
-27
|
87
|
55
|
-37
|
Eheschließungsquoten lediger Frauen
| |
1965
|
1970
|
1875
|
1980
|
1981
|
Diff. (%)*
|
| Belgien |
100
|
98
|
89
|
79
|
75
|
-25
|
| Dänemark |
97
|
81
|
66
|
53
|
50
|
-48
|
| England u. Wales |
101
|
105
|
88
|
77
|
71
|
-30
|
| Finnland |
93
|
94
|
71
|
67
|
68
|
-27
|
| Frankreich |
99
|
92
|
86
|
71
|
67
|
-32
|
| BRD |
110
|
97
|
76
|
66
|
64
|
-43
|
| Italien |
102
|
101
|
93
|
77
|
73
|
-28
|
| Niederlande |
113
|
106
|
83
|
69
|
65
|
-42
|
| Norwegen |
93
|
96
|
80
|
65
|
65
|
-30
|
| Spanien |
98
|
100
|
102
|
74
|
68
|
-31
|
| Schweden |
96
|
62
|
63
|
52
|
53
|
-45
|
* Unterschied 1965 - 1981
Begriff der nichtehelichen Lebensgemeinschaft:
In der Folge möchte ich einige Definitionen über nichteheliche
Lebensgemeinschaften zitieren, so zum Beispiel jene von Macklin
(1972), der diese Lebensform folgendermaßen beschreibt: Jemand teilt
mit einer Person des anderen Geschlechts mindestens vier Nächte pro
Woche innerhalb einer Zeitspanne von mindestens drei aufeinanderfolgenden
Monaten das Schlafzimmer. Diese Definition, ebenso wie die von Brunborg
(1978), Montgomery (1975) und viele andere mehr wählen eindeutig
als zentrales Kriterium ihrer Begriffsbestimmung das Sexualverhalten.
Im Vergleich zur Ehe wird die nichteheliche Lebensgemeinschaft zumeist
als "das Zusammenleben von zwei erwachsenen Personen verschiedenen Geschlechts
in einem gemeinsamen Haushalt unter eheähnlichen Bedingungen, jedoch
ohne ihre Beziehung durch Heirat legitimiert zu haben" beschrieben (siehe
Alnebring, 1973 und Näsholm, 1972). Die Begriffsbestimmung erfolgt
meist über die Festlegung bestimmter Merkmale, wie sexuelle Beziehung,
gemeinsames Wohnen, Essen beziehungsweise gemeinsame Haushaltskassa.
Entwicklung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften:
Vor der Christianisierung war die Eheschließung alleinige Angelegenheit
der Familien, ohne Bedeutung für den Staat. Während der Verbreitung
des Christentums forderte die Kirche die religiöse Trauung als ausschließlich
konstituierende Form der Eheschließung; trotzdem blieb es weiterhin
Tradition, daß das Händeschütteln als Zeichen gültiger
Eheschließung galt.
Heute handelt es sich bei vielen nichtehelichen Lebensgemeinschaften
genau genommen um voreheliche Lebensgemeinschaften, das heißt diese
Paare heiraten zu einem späteren Zeitpunkt. In Dänemark und Schweden
haben fast 100 Prozent der Paare vor der Ehe eine nichteheliche Lebensgemeinschaft,
in den USA nur fünf Prozent; aber auch dort nahm die Anzahl der vorehelichen
Lebensgemeinschaften seit 1970 stark zu. In Dänemark und Schweden
haben 45 Prozent der nichtehelich zusammenlebenden Paare Kinder, in Deutschland
verzichtet man eher innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft auf
Kinder beziehungsweise heiratet bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft.
Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften in % zu allen Frauen
| |
20 - 24
|
25 - 29
|
30 - 34
|
| Dänemark 1981 |
65
|
29
|
13
|
| Frankreich 1980/81 |
16
|
6
|
2
|
| Großbritannien 1980 |
11
|
6
|
2
|
| Schweden 1980 |
75
|
40
|
17
|
Das Zusammenziehen der Paare erfolgt entweder zu einem im voraus bestimmten
Zeitpunkt, oder es handelt sich um einen sukzessiven Prozeß, bei
dem der einzelne im nachhinein nur schwierig einen bestimmten Zeitpunkt
angeben kann.
Gründe für und gegen eine Eheschließung
Früher wurde eine nichteheliche Lebensgemeinschaft häufig
als Protest gegen die Ehe als soziale oder religiöse Institution begründet.
Auch spielte die Ideologie der Privatheit eine Rolle. Heutzutage wird Heirat
nicht mehr als Notwendigkeit bewertet; dennoch gehen viele bereits länger
zusammenlebende Paare aus traditionellen Gründen eine Ehe ein. Schwangerschaft
und Kinderwunsch sind noch immer gute Gründe für eine Eheschließung,
während Faktoren wie "Abschluß der Ausbildung und Übernahme
einer beruflichen Tätigkeit" sowie "günstige Wohnungsangebote"
keine wesentliche Bedeutung mehr zukommt. Die Vermutung, daß voreheliches
Zusammenleben eine selektive Wirkung hätte, ist nicht haltbar, da
eine negative Korrelation zwischen der Zeitspanne des vorehelichen Zusammenlebens
und der Scheidungsrate nicht nachgewiesen werden konnte.
Trennung
Da keine gravierenden Unterschiede zwischen ehelichem und nichtehelichem
Zusammenleben bestehen, gibt es auch keine Unterschiede zwischen einer
Ehescheidung und der Auflösung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Juristische Unterschiede bestehen allerdings hinsichtlich Vermögensteilung,
Erbschaft und Pensionsansprüchen. Immer mehr Staaten sind bestrebt,
die nichteheliche Lebensgemeinschaft auch hinsichtlich der rechtlichen
Aspekte der Ehe gleichzustellen.
Bis jetzt habe ich mich zwar mit Ehe und nichtehelichen Lebensgemeinschaften
auseinandergesetzt, bin aber noch nicht näher auf andere nicht traditionelle
Lebensformen eingegangen. Zu den nichtkonventionellen Lebensformen werden
außer nichtehelichen Lebensgemeinschaften auch noch Singles, Alleinerzieher
und Stieffamilien etc. gezählt. Definitionsgemäß ist eine
konventionelle Lebensform nämlich eine "durch Eheschließung
legitimierte, auf lebenslange Dauer angelegte, sexuell exklusive Partnerschaft
zwischen einem Mann und einer Frau mit Kindern und einer klaren geschlechtsbezogenen
Rollenteilung mit dem Mann als Ernährer und höchster Autorität".
Demgemäß sind bereits Familien mit einer voll berufstätigen
Mutter, sogenannte "dual career families", nichtkonventionell.
Man muß bei dieser Definition von Lebensformen zwei Kriterien
beachten: einerseits die Binnenstruktur, das heißt die Beziehungsmuster
zwischen Geschlechtern und Generationen einer Lebensform, Arbeitsteilung,
Macht- und Entscheidungsstrukturen, Partnerschaftstyp, Bildungsunterschiede,
Nationalitäten, und andererseits die Entstehungskontexte der
jeweiligen Lebensform, das heißt Grad der Freiwilligkeit des Zustandekommens,
Zeithorizont, Hintergründe und Motive sowie die an die Lebensform
gerichteten subjektiven Erwartungen und Sinnzuschreibungen. Wenn man Familien
anhand ihrer äußeren Strukturmerkmale betrachtet, sagt es immer
weniger über das tatsächliche Leben der Personen aus, wenn man
weiß, in welcher Lebensform diese Person lebt. Wenn man die individuellen
Kontexte nicht kennt, kann dies leicht zu falschen Schlußfolgerungen
führen. Die beiden traditionellen Merkmale, Familie und Blutsverwandtschaft,
verloren stark an Bedeutung für den Lebensvollzug vieler Menschen.
Lebensformen mit äußerlich gleichen Strukturmerkmalen differieren
also hinsichtlich ihrer Binnenstruktur, ihrer Entstehungszusammenhänge,
aber auch betreffend ihre subjektiven Sinnzuschreibungen so erheblich,
daß eine solche Kategorisierung fast zwangsläufig zu unrichtigen
Schlußfolgerungen führen muß. Die Motive und Umstände
des Zustandekommens von Lebensformen müssen berücksichtigt werden.
Die nichtkonventionellen Lebensformen sind strukturell betrachtet nicht
neu, sondern nur ihre Entstehungskontexte und gesellschaftliche Akzeptanz.
Heute entstehen diese Lebensformen infolge einer freien Wahl, und sie sind
nicht mehr diskriminiert. Der Trend zu nicht-konventionellen Lebensformen
setzt ökonomische Unabhängigkeit der Frau vom Mann voraus. Stichworte
sind Autonomie, Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Variiert
wird hinsichtlich des Familienstandes, der Elternschaft, des biographischen
Timings und der Dauer der Lebensformen, nicht aber hinsichtlich der Partnerschaft;
hier ist weiterhin die dyadische heterosexuelle Partnerbeziehung vorherrschend.
Alternative Lebensformen mit mehr als zwei Partnern sowie homosexuelle
Paare kommen nach wie vor relativ selten vor.
Allerdings führte der gesellschaftlicher Modernisierungsprozeß
zur Individualisierung der Lebensverläufe. Es gibt fast überhaupt
keine erweiterten Familien- haushalte mehr, das heißt Haushalte mit
Personen, die nicht zur Kernfamilie gehören, kaum Familien mit mehr
als zwei Kindern. Die Binnenstruktur der Familie änderte sich durch
die wachsende Emanzipation von Frau und Kindern. Nur während der Karenzzeiten
kommt es in meisten Familien zu einer dauerhaften Retraditionalisierung
der Geschlechterrollen.
Die Familie kann gleichzeitig moderne und traditionelle Merkmale aufweisen,
etwa in Form von Gleichberechtigung der Geschlechter bei gleichzeitig eingeschränkten
Scheidungsmöglichkeiten. Solche Muster sind instabil, sie treten als
Zwischenstufen im Verlauf sozialen Wandels auf. Man kann sagen, daß
die gesellschaftliche Modernität mit den gesellschaftlich zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten variiert, individuelle Modernität mit
den individuellen Fähigkeiten, sich selbstbestimmt und reflektiert
für bestimmte Alternativen zu entscheiden, und diese kreativ gestalten
zu können, und familiale Modernität mit dem Maß an Gleichberechtigung
aller Familienmitglieder. Biographische Entscheidungen werden häufig
nur für begrenzte Lebensabschnitte getroffen, regel- mäßig
überprüft und gegebenenfalls revidiert. Die Elternschaft allerdings
stellt, besonders für die Frauen, eine schwer revidierbare und zumeist
langfristig bindende Entscheidung dar. Elternschaft durchdringt modernes
Leben
mit traditionellen Momenten und führt zu Widersprüchlichkeiten
und Inkompatibilitäten im Kontext des Lebensvollzuges. Nichtkonventionelle
Lebensformen sind dann als modern zu betrachten, wenn es sich um eine Lebensform
handelt, in der kein Partner strukturell benachteiligt wird. Daher muß
man auch Ehe und Familie als moderne Lebensform bezeichnen.
Zusammenfassung
Resumierend möchte ich nochmals auf die Abnahme der Heiratsquoten
in den letzten 30 Jahren hinweisen, und darauf, daß es dadurch zu
keiner wirklichen Zunahme der Singles kam, sondern zu einer stark steigenden
Zahl von nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Immer mehr Paare, die heiraten,
leben zuvor in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammen, entschließen
sich später dann häufig doch zur Eheschließung als Bestätigung
der Paarbeziehung. Kinderwunsch und Schwangerschaft spielen dabei eine
zentrale Rolle.
Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden immer mehr als "normal" betrachtet,
diese Lebensform wird von ihrer Bedeutung her allmählich der Ehe angeglichen
in vielen Staaten der westlichen Welt. Es ist das Bestreben vieler, auch
die noch bestehenden Unterschiede, zumeist juristischer Natur, bei Auflösung,
Trennung oder Tod eines Partners betreffend das Sorgerecht für die
Kinder, die Aufteilung des Besitzes und das Wohn- und Erbrecht allmählich
zu egalisieren.
Persönliche Stellungnahme
Ich möchte zu diesem Thema gerne Stellung nehmen, da mich ein großes
persönliches Interesse mit der Fragestellung verbindet. Nach meiner
elfjährigen, mittlerweile geschiedenen Ehe, aus der auch meine beiden
Kinder, sieben und fünf Jahre alt, stammen, lebe ich seit ungefähr
einem halben Jahr mit einem neuen Partner zusammen, sozusagen in einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Ich kann im Alltagsleben keinen Unterschied
feststellen zu einer ehelichen Lebensgemeinschaft und finde auch, daß
man nichteheliche Lebensgemeinschaften immer mehr, auch rechtlich, an Ehe
angleichen sollte. Dies würde für alle Beteiligten Vorteile und
neue Rechte bringen, ein Faktum, was vor allem für etwaige der Beziehung
entstammende Kinder hinsichtlich Erbrecht, Pensionsansprüchen etc.
wichtig wäre. Klarerweise würden die Partner allerdings auch
mehr Verpflichtungen eingehen.
Prinzipiell glaube ich, daß der Ehe immer mehr ideelle Bedeutung
als rechtliche und gesellschaftlich notwendige zukommt. Persönlich
gibt es für mich im Stellenwert zwischen Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft
keinen Unterschied.
Literaturverzeichnis
Schneider, N. (1996). Familien im Modernisierungsprozeß.
Soziologische Betrachtungen. Bamberg: Universität, Staatsinstitut
für Familienforschung.
Trost, J. (1989). Nichteheliche Lebensgemeinschaften. In R. Nave-Herz
& M. Markefka (Hrsg.), Handbuch der Familien- und Jugendforschung.
Familienforschung (Bd. 1) (S. 363-373). Neuwied: Luchterhand.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
11) Grundlagen der Bindungstheorie (Brigitta
Wiesmüller)
1. Einleitung
Die moderne Bindungsforschung hat das von Sigmund Freud entworfene Bild
des Neugeborenen und Kleinkindes teilweise ad absurdum geführt. Das
menschliche Neugeborene ist weder eine "tabula rasa" d.h. ein "unbeschriebenes
Blatt" noch das "polimorph-perverse Triebbündel", das Freud in ihm
sah. Außerdem entsprach es diesem Zeitgeist, das Neugeborene als
ein eigensüchtiges, gieriges Wesen anzusehen, dessen Triebe durch
Erziehung gezähmt werden müssen, damit es ein nützliches
Mitglied der menschlichen Gesellschaft werden könne.
Hierzu ist interessant, was Anna Freud 1952 meinte:
Wenn der kleine Säugling über eine entsprechende Muskelkraft
verfügte, wäre er das gefährlichste Individuum, das man
sich vorstellen kann. Er wäre eine Art Orang-Utan, der durch die Gegend
streift, nach allen Seiten Schläge austeilt und sich nimmt, was immer
er haben will. Vor diesem gefährlichen Individuum sind wir nur durch
die Tatsache geschützt, daß es sich nicht bewegen, nicht gehen
und nicht greifen kann und keine Kraft hat. Es ist ein Glück, daß
wir mit wachsender Körperkraft auch ein zunehmend funktionsfähiges
Ich erwerben, das diese Kraft automatisch kontrolliert. (Freud, 1993, in
Spangler und Zimmermann, 1995)
2. Innere Arbeitsmodelle von Bindung
2.1 Allgemeine Beschreibung von Bindung
Bindungsverhalten begleitet den Menschen von der Geburt bis zum Tod
(Bowlby, 1979, zitiert nach Spangler & Zimmermann, 1995). Schon das
Neugeborene ist mit einem Verhaltensrepertoire ausgestattet, das dazu dient,
die Nähe zur Pflegeperson aufrecht zu erhalten. Durch das Pflegeverhalten
der Eltern bildet sich das Bindungsverhalten des Kindes. Das Bindungsverhalten
entwickelt sich stufenweise. Mit etwa sechs Monaten formt sich das Kind
ein Bild von seiner Bezugsperson. Es hat bereits die Fähigkeit entwickelt,
auch dann nach seiner Bindungsperson zu suchen, wenn diese nicht anwesend
ist. Mit dieser Errungenschaft treten nun Kummergefühle bei einer
Trennung auf. Ab diesem Zeitpunkt ist das Kind zu einer festen Bindung
fähig. Über das Bindungsverhalten und die Reaktionen der Bindungspersonen
entwickelt das Kind eine innere Repräsentation von Bindung, das sogenannte
innere Arbeitsmodell von Bindung.
2.2 Aufbau innerer Arbeitsmodelle
Viele Autoren gehen davon aus, daß die inneren Arbeitsmodelle
von Bindung aktive Konstruktionen sind, die im Prinzip auch jederzeit wieder
neu umstrukturiert werden können.
Solche Neuorganisationen sind aber sehr schwierig, da ein einmal strukturiertes
Modell dazu tendiert, auch unbewußt zu wirken und Veränderungen
zu widerstehen. Es stellt sich nun die Frage, wie ein Kind sein eigenes
Beziehungsmodell konstruiert. Man geht davon aus, daß das Arbeitsmodell
einer konkreten Eltern-Kind-Beziehung sich aus Handlungen des Kindes, den
folgenden Konsequenzen und den Eltern-Kind-Interaktionen heraus entwickelt.
Man geht davon aus, daß schon sehr kleine Kinder ihre Bindungsmodelle
entwickeln. Da jedes Bindungsmodell von der Bindungsfigur und von bindungsrelevanten
Ereignissen abhängig ist, entwickeln sich von Anfang an unterschiedliche
Modelle bei Kindern. Jedoch führt dies nicht, wie theoretisch möglich,
zu einer unendlichen Varianz von Bindungsmodellen, es lassen sich vielmehr
die wesentlichen Unterschiede der Modelle zu einigen wenigen zentralen
Kategorien zusammenfassen.
-
Differentielle Beschreibung innerer Arbeitsmodelle von Bindung
Bindungsmodelle in ihren entwicklungsbedingt unterschiedlichen Ausprägungen
lassen sich recht genau beschreiben. In den entwicklungsbedingten Unterschieden
der verschiedenen Altersstufen lassen sich dennoch immer wieder die gleichen
zugrundeliegenden Strukturen finden. Ein einjähriges Kind setzt sein
Arbeitsmodell direkt in Verhalten um, ein sechsjähriges Kind verschlüsselt
sein Arbeitsmodell bereits in die Art des Dialogs, den es mit seiner Mutter
führt. Beim Erwachsenen läßt sich das Arbeitsmodell am
besten daran erkennen, wie er über bindungsrelevante Themen spricht,
wenn er aufgefordert wird, sich an seine Bindungserfahrungen zu erinnern.
2.3.1 Das sichere Modell
Ein sicher gebundenes Kind bringt Vertrauen in die Verfügbarkeit
seiner Bindungsperson. Das Kind kann die Bindungsperson als sichere Basis
benützen um beispielsweise eine fremde Umgebung zu erforschen. Auch
wenn die Bezugsperson den Raum verlassen hat, empfindet es sie noch als
anwesend und beginnt sich erst allmählich zu sorgen, wenn sie länger
nicht zurückkommt. Kommt sie zurück, sucht das Kind Trost bei
ihr, läßt sich schnell wieder beruhigen, und kann so sein Erkundungsverhalten
fortsetzen. Die Rückkehr der Bindungsperson bestärkt das Kind
also im Glauben an ihre Verläßlichkeit. Allgemein gesagt werden
negative Gefühle, in diesem Fall die Trennung, mit diesem Modell in
insgesamt positive übergeleitet, in diesem Fall die Bestätigung
eines guten Ausganges.
Entsprechende Verhaltensweisen lassen sich auch bei sicher gebundenen
älteren Kindern und Erwachsenen finden.
2.3.2 Das unsicher-ambivalente Modell
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder erleben ihre Bindungsperson als
nicht berechenbar. Diese Kinder sind unruhig, ihr Bindungssystem ist chronisch
aktiviert. Aufgrund ihrer Erfahrungen suchen sie die Nähe ihrer Bezugsperson
schon vor deren Abwesenheit. Durch diese permanente Aktivierung ihres Bindungssystems
ist ihr Erkundungsdrang stark eingeschränkt. Verläßt die
Bindungsperson den Raum, erleben diese Kinder die Trennung als sehr stark
belastend. Die Kinder werden in der Erwartung bestärkt, daß
die Bezugsperson wieder nicht verfügbar ist. Kehrt die Bezugsperson
nun zurück, zeigen die Kinder ein ambivalentes Verhaltensmuster. Einerseits
suchen sie die Nähe zur Bindungsfigur, andererseits reagieren sie
wütend und verärgert. Da nie eine positive Erwartungshaltung
aufgebaut wurde, können die negativen Gefühle nicht in positive
transferiert werden. Die Unberechenbarkeit der Bezugsperson läßt
unsicher-ambivalent gebundene Kinder aufgrund ihrer Anhänglichkeit
lange als unreif erscheinen. Selbst eine einstündige Trennung wirkt
als Bedrohung auf die Kinder.
Unsicher-ambivalent gebundene Erwachsene sind charakterisiert durch
Verwirrtheit, Widersprüchlichkeit und besonders wenig Objektivität,
wenn sie über ihre Beziehungen Auskunft geben sollen. Sie sind in
früheren Bindungserfahrungen gefangen, dabei aber passiv, ängstlich
oder ärgerlich den Bezugspersonen gegenüber.
2.3.3 Das unsicher-vermeidende Modell
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder wirken in fremden Situationen wenig
beunruhigt, sie vermeiden sogar die Nähe zur wiederkehrenden Bindungsfigur.
Dieses Bindungsmodell hat sich durch frühere oftmalige Zurückweisung
durch die Bezugsperson entwickelt. Um nun die Wahrscheinlichkeit für
eine solche schmerzhafte Zurückweisung zu verringern, machen sich
diese Kinder die Strategie der Vermeidung zu Nutze. Sie versuchen ihre
Verunsicherung nicht mehr zu zeigen und suchen auch nicht mehr die Nähe
der Bezugsperson, da sie von ihr keine Auflösung dieser Verunsicherung
mehr erwarten. Auch hier ist keine Umwandlung negativer Gefühle in
eine positive Erwartungshaltung möglich, die Kinder versuchen aber,
im Gegensatz zum ambivalenten Modell, negative Gefühle gegenüber
der Bezugsperson nicht zum Ausdruck zu bringen.
Bei älteren Kindern äußert sich das Modell folgendermaßen:
Sie sprechen zwar höflich, aber sehr distanziert zur Bindungsperson.
Die Antworten sind kurz und auf das Nötigste beschränkt. Seitens
des Kindes besteht kein Interesse an einem Dialog, da es mögliche
abwertende Reaktionen der Bezugsperson vermeiden will. Das Kind wirkt,
als hätte es eine unsichtbare Mauer um sich aufgebaut.
Entsprechend entwickeln sich solche Kinder zu zurückgezogenen distanzierten
Erwachsenen.
2.3.4 Das unsicher-desorganisierte Modell
Über das unsicher-desorganisierte Modell gibt es noch wenig konkrete
Aussagen. Zu erwähnen wäre jedoch, daß unsicher-desorganisierte
Kinder nicht in der Lage sind, eine klaren Bindungsstrategie zu entwickeln
und ihre Erwartungen an die Bindungsperson in einem Arbeitsmodell abzubilden.
Diese Kinder entwickeln im Laufe der Zeit eine Art kontrollierende Strategie,
die sich in vielen Fällen als Rollenumkehr äußert. Die
Kinder fühlen sich für die Bezugsperson verantwortlich, was sich
in einem überfürsorglichem oder bestrafenden Verhalten zeigt.
Bei Erwachsenen zeigt sich diese Desorganisation in verbalen und gedanklichen
Irrationalitäten bei bestimmten Bindungsthemen wie Tod oder Trennung.
3. Bindung, Emotionen und Persönlichkeitsentwicklung
Mittlerweile ist klar, daß die Fähigkeit, bei Angst, Ärger
oder Kummer die negativen Gefühle der Bindungsperson zu zeigen, für
die Entwicklung einer sicheren Bindung ganz entscheidend ist. Studien haben
gezeigt, daß unsicher-vermeidende Kinder in nicht belastenden Situationen
durchaus in einer angemessenen Art und Weise mit der Bezugsperson kommunizierten
können, daß aber die Kommunikation in belastenden Situationen
erheblich eingeschränkt ist. Es konnte gezeigt werden, daß diese
frühen Kommunikationsprobleme äußerst bedeutsam sind für
die spätere Persönlichkeitsentwicklung.
Untersuchungen von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern konnten nachweisen,
daß die Kinder bei emotionaler Belastung Strategien zur Unterdrückung
von negativen Gefühlen wie Angst oder Kummer entwickeln. Auf der anderen
Seite ist bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern ein erhöhtes
Maß an Ärger und Kummer in ihrem Verhalten zu erkennen. Es zeigten
sich also deutliche Unterschiede in der Kommunikation und in der Art des
Umgangs mit Gefühlen.
Einer der beeindruckendsten Befunde bezüglich unsicher-ambivalent
und unsicher-vermeidend gebundener Kinder ist die Erkenntnis, daß
Ärger einen ganz besonderen Einfluß auf die Persönlichkeitsentwicklung
hat. Beide entwickeln bei Ärger ein bestimmtes Reaktionsmuster, das
sich später auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt und sich
im Verhalten widerspiegelt.
Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind verdrängt oder verschiebt
seinen Ärger vorerst, jedoch können später oft spontane
Aggressionsausbrüche beobachtet werden. Ein unsicher-ambivalent gebundenes
Kind dagegen drückt seinen Ärger offen aus und verstärkt
ihn oft sogar.
Diese unterdrückten bzw. verstärkten Verhaltenstendenzen tragen
zur Entwicklung von spezifischen Strategien bei, die dann bei ärgerlichen
Gefühlszuständen je nach Typ eingesetzt werden. Ebenso beeinflusse
sie die Entwicklung von Kommunikationsmustern.
3.1 Einfluß elterlicher Verhaltensweisen auf das Bindungsverhalten
3.1.1 Unsicher-vermeidende Bindung
Eltern von unsicher-vermeidend gebundenen Kindern werden als unfeinfühlig
gegenüber den Signalen des Kindes beschrieben, als überstimulierend
und als verdeckt feindselig. Diese elterlichen Charakteristika führen
bereits zu einem vermeidenden Interaktionsstil. Sie werden zu aversiven
Partnern, aber das Kind kann sich kaum leisten zu protestieren, weil es
dadurch den Ärger der Bezugsperson auslösen würde. So muß
das Kind alternative Strategien im Umgang mit Unbehagen erwerben, wie zum
Beispiel die Vermeidung.
3.1.2 Unsicher-ambivalente Bindung
Eltern von unsicher-ambivalenten Kindern zeigen bestimmte Verhaltensweisen
wie Inkonsistenz und Vernachlässigung. Inkonsistenz elterlichen Verhaltens
bedeutet, daß einmal aufgebaute kindliche Erwartungen stets wieder
enttäuscht werden und somit die Grundlage für Frustration, dem
klassischen
Auslöser für Ärger, geschaffen wird.
3.2 Bindungsqualität und Persönlichkeitsentwicklung
Es stellt sich nun die Frage, wie die verschiedenen Bindungsmuster mit
der späteren Persönlichkeit zusammenhängen.
Ein Persönlichkeitsansatz besagt, daß Emotionen Wünschen
und Zielen dienen und, daß bestimmte Emotionen im Verlauf der Entwicklung
Bestandteile der Persönlichkeit werden können. Das heißt,
daß Kinder im Verlauf der Entwicklung lernen, emotionale Zustände
bei anderen zu identifizieren und ihren eigenen emotionalen Erfahrungen
Bedeutung zuzuordnen.
Mit fortschreitender Entwicklung rücken bestimmte Emotionszustände
in den Erfahrungsmittelpunkt. Durch Wiederholungen und thematische Veränderungen
entstehen nun Verbindungen zum Selbstwertgefühl und zur Selbstidentität,
die dann Einfluß auf die jeweilige Persönlichkeitsentwicklung
haben. So kristallisieren sich bestimmte Persönlichkeitscharakteristika
heraus, die dann Auswirkungen für vielfältige Verhaltensbereiche
haben.
4. Zusammenfassung
Das jeweilige Bindungsverhalten eines Kindes entwickelt sich aus dem
Pflegeverhalten der Bezugsperson. Über das Bindungsverhalten und das
Verhaltensmuster der Bezugsperson entwickelt das Kind sogenannte innere
Arbeitsmodelle von Bindung. Es wird angenommen, daß das Arbeitsmodell
einer Eltern-Kind-Beziehung aus Handlungen des Kindes, den folgenden Konsequenzen
und der Eltern-Kind-Interaktion heraus entsteht.
Es werden im allgemeinen vier verschiedene Bindungsmodelle unterschieden:
* das sichere Modell
* das unsicher-ambivalente Modell
* das unsicher-vermeidende Modell
* das unsicher-desorganisierte Modell
Sicher gebundene Kinder bringen der Bindungsperson Vertrauen entgegen.
Sie haben die Erfahrung machen können, daß sie von der Bezugsperson
nie im Stich gelassen werden.
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder erleben ihre Bindungsfigur als
unberechenbar. Entsprechend reagieren diese Kinder mit gegensätzlichen,
das heißt ambivalenten Gefühlen der Bezugsperson gegenüber.
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder vermeiden die Nähe zur Bindungsperson.
Das vermeidende Modell hat sich aus oftmaliger Zurückweisung der Bezugsperson
entwickelt. Bei unsicher-desorganisiert gebundenen Kindern findet eine
Art Rollenumkehr statt. Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Erziehungsperson.
Die Fähigkeit negative Emotionen wie Trauer und Ärger der Bezugsperson
zu zeigen, ist für die Entwicklung einer sicheren Bindung entscheidend.
Es konnte gezeigt werden, daß vermeidend gebundene Kinder in belastenden
Situationen negative Gefühle unterdrücken. Bei ambivalent gebundenen
Kindern hingegen ist ein erhöhtes Maß an Ärger und auch
Aggression in ihrem Verhalten beobachtbar. Es ist nachgewiesen, daß
sich die verschiedenen Bindungsmodelle auf die spätere Persönlichkeitsentwicklung
auswirken. Es bilden sich bestimmte Persönlichkeitscharakteristika
heraus, die sich auf viele Verhaltensbereiche auswirken.
5. Persönliche Stellungnahme
Aus eigener Erfahrung innerhalb der Familie kann ich die Einteilung
in ein sicher gebundenes, ein unsicher-ambivalentes, ein unsicher-vermeidendes
und ein desorganisiertes Modell nur bestätigen. Bei genauer Betrachtung
zeigt mein siebenjähriger Neffe die klassischen Anzeichen eines unsicher-vermeidenden
Kindes. Man findet bei ihm die typischen Verhaltensweisen, wie sie oben
beschrieben wurden. Wenn man nun seine Entwicklung und seine damalige Situation
zurückverfolgt, scheint es sonnenklar, warum aus diesem Kind ein vermeidend
gebundenes wurde. Der Bub wuchs ohne Vater auf, er lebte mit seiner Mutter
bei den Großeltern. Obwohl die Großeltern der Mutter (d.h.
ihrer Tochter) tatkräftig zur Seite standen, fühlte sie sich
die meiste Zeit überfordert und von ihrem Sohn genervt. So suchte
sie nach anderweitigen Beschäftigungen außer Haus und ließ
den Buben bei den Großeltern. Wenn sie dann nach Hause kam, und der
Bub ihre Nähe suchte, wies sie ihn zumeist zurück, da sie nach
dem langen Tag müde war und ihre Ruhe haben wollte. Zudem konnte sie
nicht verstehen, warum sie sich noch um den Jungen kümmern sollte,
wo er doch ohnehin die Großeltern um sich hatte. Dazu kam noch, daß
sie zu dieser Zeit ihren jetzigen Mann kennen gelernt hatte, der den Buben
nie so richtig akzeptieren wollte und mit dem sie seit kurzem noch ein
Kind hat. Außerdem leben sie jetzt einige hundert Kilometer von den
Großeltern weg, die für das Kind den einzigen Trost bedeuteten.
Der Junge bekommt diese Situation natürlich mit und fühlt sich
von der Mutter noch mehr verlassen. Das ist soweit grob die Geschichte
meines Neffen. So ist es wohl nicht mehr verwunderlich, daß er alle
Anzeichen eines vermeidend gebundenen Kindes zeigt. Er scheint seine Kummer
in sich hineinzufressen, der sich immer wieder in enormen Aggressionsausbrüchen
zeigbar macht.
Jetzt, wo die Ehe zu scheitern scheint, löst sich die Mutter mehr
von ihrem Mann und versucht nun verstärkt, spät aber doch, um
das Vertrauen ihres Sohnes zu kämpfen.
Literaturverzeichnis
Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.). (1995). Die Bindungstheorie,
Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
12) Pubertät als Herausforderung für die
Familie (Sabine Nimmervoll und Irene Hanke)
Einleitung
Im psychologischem Alltagsverständnis versteht man unter Pubertät
eine Phase der körperlichen Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen,
die von extremen Gefühlsschwankungen und der Rebellion gegenüber
Sitte und Moral der Erwachsenen begleitet ist. Auch in den traditionellen
Theorien zur Pubertät wurde dieses Bild übernommen, wobei man
Krisen und abweichendes Verhalten als Kennzeichnung dieses Entwicklungsabschnittes
in den Vordergrund stellte.
Heute sieht man in dieser Phase, bei der körperliche, intellektuelle
und soziale Veränderungen zusammenspielen, eine Zeit, die mit vielfältigen
Erfahrungen einhergeht und für den einen Jugendlichen positiv verlaufen
kann, für den anderen jedoch mit Problemen, persönlicher, familiärer
oder außerfamiliärer Art einhergeht. Die Forschung konzentriert
sich bei der Betrachtung dieser Phase der Entwicklung heute vor allem auf
die unterschiedlichen Anforderungen, die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben,
die an den Jugendlichen in dieser Epoche gestellt werden und die Bewältigungsstrategien,
die dieser dabei einsetzt. Er muß die Verhaltensformen eines Kindes
aufgeben und Kompetenzen erwerben, die den Status der Erwachsenen begründen.
Unter diesem Blickwinkel kann man die Zeit der Pubertät als eine
turbulente und herausfordernde Phase betrachten, die an den Jugendlichen
aber auch an seine Eltern verschiedene Anforderungen stellt. Das Eltern-Kind-Verhältnis
ändert sich notwendigerweise in der Zeit der Adoleszenz. Dieser Wandel
in der Beziehung zueinander muß jedoch nicht unbedingt besonders
krisenhaft vorsichgehen, sondern kann, wenn Eltern ihre Aufgabe ernst nehmen,
eine Chance für ein gleichgestelltes und freundschaftliches Verhältnis
zwischen dem Jugendlichen und dessen Eltern darstellen.
Im Rahmen dieser Arbeit gehen wir nun kurz auf die verschiedenen Theorien
des Jugendalters und die Entwicklungsaufgaben in dieser Lebensphase ein
und beschäftigen uns dann hauptsächlich mit der Veränderung
in der Interaktion zwischen dem Pubertierenden und seiner Familie.
Theorien des Jugendalters
Anlagetheorien der Adoleszenz
Die erste Theorie, aus dem Bereich der biogenetischen Erklärungsansätze,
geht auf Granville Stanley Hall (1846-1924) zurück.
Der Ansatz beruht auf Grundideen der Evolutionstheorie von Charles Darwin
und dem daraus abgeleiteten biogenetischen Grundgesetz von Ernst Haeckel
(1834-1919).
Entwicklungsprozesse des Wachstums und der Reifung beruhen demnach im
wesentlichen auf physiologischen Faktoren, unabhängig von der soziokulturellen
Umgebung.
Nach Halls Auffassung ist die Adoleszenz eine "Sturm-und-Drang-Periode"
(auch "Stör-Reiz-Modell" genannt), eine Zeit extremer Ausprägungen
des Erleben und Verhaltens, die von innerpsychischen Spannungen und interpersonellen
Konflikten begleitet ist. Die Universalität und Unvermeidbarkeit dieser
Phänomene sieht er darin begründet, daß die körperliche
Entwicklung sprunghaft verlaufe und diese Diskontinuität ihr Pendant
in der psychischen Organisation finde.
Trotz Relativierung und Kritik hat Halls Adoleszenztheorie nachhaltigen
Einfluß auf spätere Entwicklungskonzeptionen gehabt.
Umwelttheorien der Adoleszenz
Kulturanthropologischer Ansatz:
Die schärfste Kontrastierung zur biogenetischen Adoleszenztheorie
geht von der Kulturantropologie aus. Margaret Mead erforschte Riten
und Gebräuche im Kontext von Themen des Erwachsenwerdens.
Ihre Ergebnisse zeigten, daß die Adoleszenz in anderen Gesellschaften
eine der freudvollsten Perioden persönlicher und sozialer Entwicklung
ist; negative Charakteristika von Übergangsphasen, vergleichbar denen
der westlichen Welt blieben aus. Während für Jugendliche in statischen
Kulturen (postfigurative Kultur) Identität aus der Zugehörigkeit,
den Sitten und Handlungsformen ihres Volkes erwächst, wird die Identitätssuche
vor allem in komplexen, sich rasch wandelnden Gesellschaften (kofigurative
Kultur) zum Problem.
Eine Unterstützung seitens der Erwachsenen wird in der Fähigkeit
gesehen, Bindung zu lehren. Als wesentliche Kritikpunkte an Meads jugendtheoretischem
Konzept des Identitätsaufbaues durch die umgebende Kultur hebt Griese
hervor, daß von einer einheitlichen Jugendgeneration ausgegangen
wird, d.h. subkulturelle Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft werden
ausgeklammert. Ferner werden Generationskonflikte pauschaliert.
Lerntheoretische Ansätze:
Speziell zwei Ansätze beschäftigen sich mit Prozessen des
sozialen Lernens, die zum Verständnis von Entwicklungsphänomenen
der Adoleszenz beitragen können:
1. Die Theorie der sozialisierten Angst von Davis (1944):
Bei Davis gilt als Basisannahme seiner Theorie, daß menschliches
Verhalten auf dem Erlernen der Regeln einer Gesellschaft beruht.
In unserer Gesellschaft sind die Rollenerwartungen Jugendlichen gegenüber
unklar und insofern ist sich der Jugendliche nicht sicher, welches Verhalten
für ihn Akzeptanz und Belohnung oder Mißbilligung und Strafe
mit sich bringt. Daraus folgt, daß ihm die Reduktion der sozialisierten
Angst schwer fällt.
Er sieht sich nicht in der Lage, das Ausmaß emotionaler Belastung
zu verringern und infolgedessen bringt diese Periode emotionale Beeinträchtigung
mit sich.
2. Die drive theory adoleszenten Verhaltens von McCandless (1970):
Die Theorie von McCandless geht davon aus, daß Verhalten durch
Triebe ausgelöst wird.
Triebreduzierendes Verhalten hat Belohnungscharakter, während Verhalten,
das Triebspannung nicht reduziert, Bestrafungsqualitäten aufweist
und daher nicht wiederholt wird. Wiederholungen habituieren Verhalten (bauen
Gewohnheiten auf). Das Auftreten einer bestimmten Triebspannung erhöht
die Wahrscheinlichkeit, daß habituierte Verhaltensmuster ausgeübt
werden. Die Zeitdauer der Habituierung und des Aufbaus einer neuen Selbstdefinition
kann für den Jugendlichen eine Periode unverminderter Treibspannung
darstellen und von daher Streß und emotionale Belastung mit sich
bringen.
Interaktionstheorien der Adoleszenz
Die Interaktionstheorien betonen die Anlage-Umwelt-Dynamik.
Unterschiede zwischen Interaktionstheorien beruhen darauf, wie stark
Anlage und Umwelt jeweils gewichtet werden und in welchen Konzepten die
Interaktion erklärt wird.
Psychodynamische Ansätze:
Die klassische Psychoanalyse Sigmund Freuds weist der Adoleszenz
relativ wenig Gewicht zu. Anna Freud betrachtet den Lebensabschnitt
der Adoleszenz als eine notwendige und universell entwicklungsbedingt turbulente
Periode. Ihrer Auffassung nach beruht die Konflikthaftigkeit auf gesteigerten
internalen Anforderungen, die aus der sexuellen Reifung und der damit verbundenen
Intensivierung des Sexualtriebes hervorgehen.
Der Entwicklungsfortschritt in der Adoleszenz wird im wesentlichen in
der Bewältigung der neuen Triebkonflikte gesehen, die darauf beruht,
daß gestärkte Ich-Funktionen den Ansturm libidinöser Energien
balancieren können. Gelingt dies nicht, so treten Störungen auf,
die zu Regressionen auf frühere Entwicklungsstufen führen.
Ebenso wird das Ausbleiben von Konflikten als eine Störung aufgefaßt,
im Sinne eines pathologischen Gleichgewichts, das auf einem Übermaß
an Abwehr beruht.
Psychosozialer Ansatz:
Nach der psychosozialen Entwicklungstheorie von Erik H. Erikson
(1902-1994) beruht der Gewinn von Identität auf der Bewältigung
von Anforderungen, die aus der Einbettung des Individuums in eine Sozialordnung
resultieren.
Die Bewältigung von Krisen kennzeichnet die wachsende Persönlichkeit,
die der Umwelt aktiv begegnet und deren Kernbereich (Ich) eine gewisse
Einheit aufweist.
Die Ausbildung von Ich-Identität entspricht dem Aufbau von Selbstkonsistenz
(man weiß, wer man ist und worin über Zeit, Situationen und
soziale Kontexte hinweg die Einheitlichkeit und Unverwechselbarkeit der
eigenen Person, die Individualität, begründet ist).
Für den Verlauf und das Resultat des Entwicklungsprozesses spielt
das Identifikationsverhalten eine bedeutende Rolle.
Dynamischer Interaktionismus
Die Interaktion wird als ein Prozeß einer wechselseitigen Beeinflussung
verstanden, so daß jedes Element innerhalb des Systems zugleich Produkt
und Produzent des jeweils anderen ist. Für die Anwendung dieser Modellkonzeption
wird speziell die frühe Adoleszenz als geeigneter Abschnitt innerhalb
der Lebensspanne erachtet, da das Spektrum der Veränderungen den Einfluß
unterschiedlicher Ebenen umfaßt.
Das Modell spezifiziert also, in welcher Weise der Jugendliche Produzent
seiner eigenen Entwicklung werden kann.
Entwicklungsaufgaben des Jugendalter
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben stammt ursprünglich von Havighurst
(1948), der die Entwicklung als einen Lernprozeß auffaßt, der
sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt und dazu dient, Kompetenzen
und Fertigkeiten zu erwerben, die für ein zufriedenstellendes Leben
in der Gesellschaft notwendig sind. Eine Entwicklungsaufgabe stellt somit
ein Bindeglied zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und den individuellen
Bedürfnissen dar. In jeder Lebensperiode gibt es eine sensitive Phase
für spezifische Entwicklungsaufgaben, in der der Lernprozeß
zur Bewältigung dieser den geringsten Aufwand mit sich bringt und
in der externe Hilfestellungen am meisten Erfolg erwarten lassen. Die Bewältigung
von Aufgaben in früheren Lebensperioden wirkt sich auf die nachfolgenden
aus. Man muß jedoch unterscheiden zwischen Aufgaben, die zeitlich
begrenzt sind (z. B. der Erwerb von grundlegenden Kulturtechniken) und
solchen, die sich über mehrere Lebensperioden erstrecken (z. B. Aufbau
von Beziehungen zu Gleichaltrigen).
Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz sind nach Havighurst:
-
Neue und reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts aufbauen;
-
Übernahme der männlichen / weiblichen Geschlechtsrolle;
-
Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung, effektive Nutzung
des Körpers;
-
Emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen;
-
Vorbereitung auf Ehe und Familienleben;
-
Vorbereitung auf eine berufliche Karriere;
-
Werte und ein ethisches System erlangen, das als Leitfaden für Verhalten
dient; Entwicklung einer Ideologie;
-
Sozial verantwortliches Verhalten anstreben und erreichen.
Dreher und Dreher (1985) haben die Entwicklungsaufgaben von Havighurst
für die Jugendlichen, die heute in unserer Kultur leben, modifiziert,
indem sie Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren den Aufgabenkatalog von
Havighurst vorlegten und sie befragten welche Thematiken bzw. Formulierungen
sie bei der Schaffung eines Befragungsinstrumentes für Jugendliche
wählen würden. Dabei wurden von den Jugendlichen als fehlende
Thematiken Partnerbeziehungen, Selbstkenntnis und Zukunftsplanung angegeben.
Auch wurden die Thematiken Werte und sozial verantwortliches Verhalten
nach Havighurst als integrierte Entwicklungsaufgabe betrachtet.
Die Familie als Umwelt des Jugendlichen
Bei der Betrachtung der Identitätsentwicklung des Jugendlichen
ist es wichtig die verschiedenen Umweltbereiche miteinzubeziehen. Lewin
(1963) nennt vier Lebensregionen, nämlich Schule, Beruf, Peergruppe
und die Familie. Die Familie übt zeitlebens einen Einfluß auf
die Entwicklung des Jugendlichen aus, muß ihn jedoch im Jugendalter
mit der Schule und der Peergruppe teilen. Diese Distanzierung, die im Zuge
des Ablösungsprozesses erfolgt, darf jedoch nicht über die Wichtigkeit
eines grundlegenden Gefühls von Akzeptanz, Aufgehobensein und Ernstgenommen-werden
seitens der Eltern hinwegtäuschen.
Baumrind (1991) unterscheidet drei Sichtweisen bei der Eltern-Kind-Beziehung
im Jugendalter:
-
bei der klassischen Sichtweise wird die Loslösung von den Eltern als
entscheidend für die Identitätsbildung angesehen.
-
bei der Sichtweise der Umbruchstendenz steht das Bestreben nach größerer
Unabhängigkeit im Mittelpunkt, verbunden mit Mißachtung der
elterlichen Standards und der höheren Bewertung der Meinungen von
Freunden.
-
bei der neuerdings bevorzugte Sichtweise der Interdependenz geht es um
die Herstellung einer Balance zwischen selbständigem Handeln und Kommunikation,
zwischen Trennung und Bindung und zwischen Konflikt und Harmonie in familiären
Beziehungen.
Baumrind unterscheidet weiters vier elterliche Erziehungsstile, die einen
maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklung im Jugendalter ausüben,
nämlich den autoritativen, den autoritären den permissiven und
den zurückweisenden-vernachlässigenden Stil. In einer Längsschnittuntersuchung
zeigte sich, daß die günstigsten Entwicklungsbedingungen in
Familien mit autoritativem und demokratischem Interaktionsstil und die
schlechtesten in Familien mit autoritärem und desinteressiertem Erziehungsstil
vorzufinden sind.
Die affektive Qualität der Familienbeziehungen ändert sich,
sobald der Jugendliche in die Pubertät eintritt. Zur Erklärung
der Familiendynamik dieser affektiven Änderung benutzt Steinberg (1989)
die Hypothese der emotionalen Distanzierung. Diese behauptet,
daß der Höhepunkt des pubertären Wachstumschubes mit einer
Zunahme der emotionalen Distanzierung zwischen dem Jugendlichen und den
Eltern einhergeht. Während dieser Zeit lockern sich also die Bindungen
und die emotionale Ausdrucksfähigkeit in der Familie verändert
sich. Dies führt beim Jugendlichen zu Gefühlen von sozialer Angst
und Depression. Diese Hypothese konnte durch bisherige Untersuchungen bestätigt
werden (Papini & Sebby, 1987; Steinberg, 1988, 1989;).
Die Dämpfungshypothese (buffering hypothesis) von Armsden
und Greenberg (1987) besagt nun, daß die Qualität der Bindungsbeziehungen
zu den Eltern einen Puffer für Streß und Angst bildet. Hat der
Jugendliche also die Möglichkeit unter Streßbedingungen Zuflucht
im Bindungsverhalten zu suchen, so dämpft dies seine Ängste.
Auch diese Hypothese konnte bestätigt werden (Papini, Roggman &
Anderson, 1991). Jugendliche, die eine stärkere Bindung zu den Eltern
ausdrückten, waren weniger depressiv und sozial ängstlich und
schätzten den Zusammenhalt in der Familie positiv ein.
Es konnte jedoch auch gezeigt werden, daß sich diese beiden Hypothesen
nicht direkt in Beziehung bringen lassen. Es scheint kein Zusammenhang
zwischen Pubertät - Hang zu Depression durch emotionale Distanzierung
und Variation durch unterschiedlich starke Bindung zu bestehen.
Förderliche und hemmende Faktoren zur Bewältigung der
Entwicklungsaufgaben von Familien mit Pubertierenden
Janig und Wilk (1997) führten eine qualitative Pilotstudie an 26
Familien, in denen jeweils das älteste Kind zwischen 13 und 15 Jahre
alt war, durch. In dieser ging es darum, empirisch zu erfassen, wie Jugendliche
und ihre Eltern die Pubertät erleben und wie sie die an sie gestellten
Herausforderungen bewältigen. Es wurden dabei Einzelinterviews mit
den Müttern, Vätern und den Jugendlichen, gemeinsame Familiengespräche
und Gruppendiskussionen über fiktive Situationen durchgeführt.
Dabei stellten sich spezifische innerfamiliäre Dynamiken als hinderlich
heraus:
-
Zum ersten: falsch verstandener Zusammenhalt, bei dem Eltern, aus Angst
um das familiäre Gleichgewicht, Konflikte und Änderungen der
familiären Regeln nicht zulassen.
-
Weiters sind dichte Familiengrenzen, bei denen der Aufbau außerfamiliärer
Beziehungen erschwert wird, als hinderlich zu betrachten.
-
Wenn Jugendliche zu "Ersatzpartnern" und Eltern zu "Ersatzgeschwistern"
gemacht werden, wird die Loslösung voneinander erheblich erschwert.
-
Auch Beziehungsprobleme und Konflikte der Partner, die über den Jugendlichen
ausgetragen werden, verhindern dessen Ablösung.
Weitere hemmende Faktoren in der Bewältigung dieser Entwicklungsphase
durch Eltern und Jugendliche sind:
-
Erziehungsunsicherheiten und Uneinigkeiten der Partner in der Erziehung.
Wenn Eltern keinen gemeinsamen klaren Vorstellungen über ihre Erziehungsmethoden
haben, fällt es dem Jugendlichen schwer, sich zu orientieren und zurechtzufinden.
-
Halten die Eltern sehr streng an traditionellen Werten und Normen fest,
führt dies oft zu extremen Verhaltensweisen und Provokationen seitens
des Jugendlichen.
-
Unrealistische Ängste der Eltern, daß der Jugendliche in "falsche
Kreise" geraten könnte.
-
Geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen, bei denen gemeinsame Bezugspunkte
fehlen, z. B.: zwischen Vätern und ihren Töchtern.
-
Zusätzliche Stressoren. Haben Familien in dieser Zeit zusätzlich
kritische Life-events (Arbeitslosigkeit,....) besteht die Gefahr, daß
die Herausforderungen durch die Pubertät nicht entsprechend wahrgenommen
werden.
Die Elternbildung stellt eine Möglichkeit dar, Eltern mit Pubertierenden
zu unterstützen förderliche Faktoren auszubauen, bzw. hemmende
Faktoren zu minimieren. Diese versucht, durch Beratungen und Vorträge,
Eltern bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich ihnen in
der Erziehung stellen, nach dem Grundsatz "Hilfe zur Selbsthilfe", zu unterstützen.
Zusammenfassung
Es scheint in der Literatur über die Pubertät unumstritten
zu sein, daß die Familie in dieser Entwicklungsphase eine wichtige
Rolle spielt. Die Jugendlichen sind mit körperlichen Veränderungen,
ihrer Geschlechtsrolle und der Suche nach der eigenen Identität konfrontiert
und benötigen gerade in dieser Zeit, in der sie sich von den Eltern
distanzieren, ein grundlegendes Gefühl von Akzeptanz und Aufgehobensein.
Dies stellt auch große Anforderungen an die Eltern, die beim Loslösungsprozeß
die nötige Balance zwischen den eigenen Ängsten und dem Vertrauen
gegenüber den Kindern finden, und ihre bisherige starke Orientierung
am Leben der Kinder schön langsam aufgeben müssen. Die Pubertät
stellt somit eine große Herausforderung für die Familie dar,
durch Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse, einen zufriedenen Verlauf
dieser Entwicklungsphase zu gewähren.
Eine persönliche Stellungnahme
Rückblickend gesehen, war meine eigene Pubertät mit extremen
Gefühlsschwankungen verbunden (von "keiner hat mich lieb" bis hin
zu "das Leben ist so wunderbar").
Meine Eltern zeigten sehr viel Geduld, diskutierten mit mir, versuchten
mir zu helfen und mich zu verstehen, aber auch Schreiduelle blieben nicht
aus. Trotzdem war ihr Rückhalt sehr wichtig für mich und auch
wenn es Zeiten gab, in denen wir viel stritten, so waren es meine Eltern,
bei denen ich mich ausweinte, wenn sich die ganze Welt gegen mich verschwörte.
In der Schule bekam ich zu dieser Zeit große Schwierigkeiten,
da ich mich gegen die Lehrer auflehnte, wann immer ich mich ungerecht behandelt
fühlte, aber auch hier standen meine Eltern immer hinter mir. Ich
hatte zwar einen Freundeskreis, der aber für mich zu dieser Zeit nicht
wirklich an Bedeutung gewann, denn wir verbrachten auch vor meiner Pubertät
sehr viel Zeit miteinander und es änderten sich weder die Mitglieder
noch die Freizeitgestaltung.
Das Zurechtfinden in seinem "neuen Körper" ist zwar oft mit Schwierigkeiten
verbunden, fördert aber auch das Selbstwertgefühl und den Aufbau
einer eigenständigen Persönlichkeit wenn man diese Phase des
Lebens positiv bewältigt. Abschließend ist zu sagen, daß
die Pubertät eine große Herausforderung für den Jugendlichen
und seine Familie ist, die gemeinsam positiv bewältigt werden kann.
Literaturverzeichnis
Janig, H. & Wilk, L. (1997). Pubertät - Herausforderung
für Eltern und Jugendliche. Wien: Österreichisches
Institut für Familienforschung.
Oerter, R. & Dreher, E. (1995). Jugendalter. In R. Oerter &
L. Montada (Hrsg.). (1995). Entwicklungspsychologie (S. 310-395).
Weinheim: Beltz.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
13) Geschwisterforschung (Barbara
Klaus)
1. Einleitung
Ziel dieser Arbeit soll es sein, den Themenbereich der Geschwisterforschung
näher zu beleuchten. Um jedoch auf die Forschung und deren Ergebnisse
eingehen zu können, ist es zu Beginn notwendig, den Begriff der Geschwisterbeziehung
und -bindung zu erläutern. Anschließend gehe ich kurz auf die
Entstehung dieser besonderen Art der Bindung ein. Der zweite Teil befaßt
sich mit der Forschung. Obwohl Geschwister im Alltag für viele eine
mehr oder weniger wichtige Rolle spielen, hat sich die Wissenschaft erst
recht spät mit diesem komplexen Themenbereich auseinandergesetzt.
Zunächst behandle ich die Anfänge der Geschwisterforschung und
gehe dann auf die Erhebungsmethoden, die im Rahmen dieser Verwendung finden,
ein. Die eigentlichen Forschungsergebnisse zum Thema Geschwister sollen
in dieser Arbeit nicht zu kurz kommen. Ich gebe einen, wenn auch sehr komprimierten,
Überblick über die zum Teil recht widersprüchlichen Ergebnisse
diverser Studien. Dabei komme ich auf unterschiedliche Forschungsfelder,
die mit unterschiedlicher Intensität behandelt wurden, zu sprechen.
Die Geschwisterbeziehung über die Lebensspanne betrachtet, Einflüsse
von Geburtsrangplatz, Geschlecht und Altersabstand gehören hier zu
den wesentlichen Punkten. Abschließend finden auch noch Geschwisterbeziehungen
besonderer Art, wie Zwillinge, Stief- und Halbgeschwister, Eingang in diese
Arbeit.
2. Geschwister - Geschwisterbeziehung - Geschwisterbindung
Theorie und begriffliche Klärungen
Mit dem Begriff Geschwister bezeichnet man in den meisten Kulturen Personen,
die über eine (zumindest) teilweise identische genetische Ausstattung
verfügen, weil sie dieselben Eltern oder dieselbe Mutter oder denselben
Vater haben. Darüber hinaus werden aber auch Individuen als Geschwister
bezeichnet, die ein spezifisches, kulturell bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis
zueinander aufweisen. In den meisten Gesellschaften werden auch Cousins
und Cousinen in die Kategorie Geschwister eingruppiert. Erstaunlich ist,
daß weniger als 20% der Weltbevölkerung die Verwandtschaftsbegriffe
Bruder und Schwester verwendet; in ungefähr 10% der Gesellschaften
differenziert man lediglich zwischen älteren und jüngeren Geschwistern
(vgl. Kasten, 1994, S. 14 f.).
Die klinisch-psychoanalytisch orientierten Autoren Bank und Kahn (1989)
sehen nicht die gesellschaftlich anerkannte, allumfassende Geschwisterbeziehung,
sondern eher eine Vielzahl von Bindungen, die sich zu einer bestimmten
Anzahl vorhersagbarer Muster formen. Sie sehen "...die Geschwisterbindung
als - intime wie öffentliche - Beziehung zwischen dem Selbst von zwei
Geschwistern: die Zusammensetzung der Identitäten zweier Menschen.
Die Bindung kann sowohl warm und positiv als auch negativ sein" (Bank &
Kahn, 1989, S. 21). Auch bei rivalisierenden Geschwistern, die sich gegenseitig
hassen, kann man von Bindung sprechen, wenn sie sich auf der Identitätsebene
beeinflussen.
Intensive Geschwisterbindungen mit Konsequenzen für die Persönlichkeitsentwicklung
entstehen, wenn Geschwister in Kindheit oder Adoleszenz miteinander sehr
viel Kontakt haben und ihnen zuverlässige elterliche Zuwendung
vorenthalten wird. In dieser Situation sind Geschwister füreinander
ein wesentlicher Einflußfaktor auf der Suche nach persönlicher
Identität. Es hängt von den Umständen in der Familie, den
Persönlichkeiten der Kinder und den Handlungen oder Einstellungen
der Eltern ab, ob diese Intensivierung konstruktiv oder destruktiv ist.
Emotional befriedigende Beziehungen (zu Eltern, eigenen Kindern oder Partnern)
lassen die Geschwisterbeziehung schwächer und unwichtiger werden (vgl.
Bank & Kahn, 1989, S. 24f).
3. Geschwisterforschung - Einführung in den Forschungsbereich
3.1 Anfänge der Forschung
Seit Kain aus Eifersucht die Hand gegen seinen Bruder Abel erhob und
ihn erschlug, haben Geschwister in fast allen schriftlichen Überlieferungen
der zivilisierten Menschheit immer wieder eine wichtige Rolle gespielt.
Das Thema Geschwisterrivalität ist auch heute noch in der Literatur
evident. Es scheint also die Menschen zu bewegen. Erstaunlicherweise haben
Geschwister
in den Sozial- und Humanwissenschaften der Neuzeit als Forschungsthema
lange Jahrzehnte kaum eine Rolle gespielt. Dies ist verwunderlich angesichts
des Stellenwertes, welcher der Geschwisterbeziehung im Bereich der Sozialbeziehungen
im allgemeinen beigemessen wird. Ihre Bedeutung für die individuelle
Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung, besonders innerhalb
der Familie und während der Kindheit und der Jugendjahre, ist evident.
Die empirische Psychologie hat das Thema Geschwisterbeziehung relativ spät
entdeckt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es vor allem
Psychoanalytiker und Soziologen, welche sich, meist nur am Rande und ohne
systematischen und theoretischen Anspruch, mit der Thematik befaßten
(vgl. Kasten, 1993, 10ff).
Alfred Adler lenkte in seiner in den 20er Jahren geschaffenen Individualpsychologie
die Aufmerksamkeit auf mögliche Verbindungen zwischen Geburtsrangplatz
und Eigenschaften des Individuums. Darauf bezogene Fragestellungen bildeten
im wesentlichen für fast ein halbes Jahrhundert das Ausgangsmaterial
für immer wieder ähnlich aufgebaute Geschwisterkonstellationsuntersuchungen.
Erst in den letzten 25 Jahren weitete sich allmählich das Interesse
der Forschung aus (vgl. Kasten, 1993, S. 4).
Während in früheren Arbeiten zur Geschwisterbeziehung häufig
die Frage im Mittelpunkt des Interesses stand, welchen Einfluß eine
spezifische Geschwisterbeziehung auf andere Variablen, wie Persönlichkeitseigenschaften
der Geschwister zu einem späteren Zeitpunkt, ausübt, befassen
sich jüngere Arbeiten auch mit der umgekehrten Fragerichtung: Welche
Einflüsse sind es, die die Qualität einer Geschwisterbeziehung
ausmachen (vgl. Kasten, 1993, S. 17)? Das heißt, "Geschwisterbeziehung
muß zum einen analysiert werden als abhängige Variable,
d.h. als etwas, das seine Ursachen und Hintergrundbedingungen hat; gleichzeitig
ist es aber auch notwendig, Geschwisterbeziehung als unabhängige
Variable
zu betrachten, die ihrerseits Ursache und Hintergrundbedingung für
zahlreiche individuumsbezogene, zwischenmenschliche und soziale Variablen
ist" (Kasten, 1993, S. 18).
3. 2 Überblick über die Erhebungsmethoden, die im Bereich
der Geschwisterforschung Verwendung finden
Im Rahmen der Geschwisterforschung ist eine theoretische und praktische
Ausdifferenzierung von spezifischen Forschungsperspektiven zu konstatieren.
"Diese Forschungsperspektiven sollten prinzipielle und idealtypische und
methodologische Zugangswege zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe
Geschwisterbeziehungen empirisch untersucht werden können. Aus jeder
Forschungsperspektive können durch den Einsatz von Informanten Daten
über den Forschungsgegenstand zutage gefördert werden. Durch
Installation dieser Forschungsperspektiven wird angestrebt, die Determinanten
und Ausprägungsformen von Geschwisterbeziehungen möglichst vollständig
zu erfassen und differenziert zu rekonstruieren." (Kasten, 1993, S. 14)
Kasten (1993) unterscheidet drei Forschungsperspektiven:
1) Die Forschungsmethode der aufeinander Bezug nehmenden Geschw. = Erhebungsmeth.1
2) Die Forschungsperspektive der teilnehmenden Interaktionspartner =
Erhebungsmethode 2
3) Die Forschungsperspektive der außenstehenden Beobachter = Erhebungsmethode
3
Die drei Forschungsperspektiven werden gleichberechtigt behandelt und
keine davon darf bevorzugt werden. Die Informationen werden in der Regel
durch Interviews, Explorationen, Fragebögen, Checklisten und Verhaltensbeobachtung
gewonnen (vgl. Kasten, 1993, S. 24f). Fehlende Übereinstimmung der
erhobenen Daten muß nicht auf Unzulänglichkeiten der Erhebungsmethode
zurückzuführen sein, sondern kann damit zusammenhängen,
daß einfach verschiedene Sichtweisen von ein und derselben Beziehung
existieren.
3.3 Forschungsergebnisse
3.3.1 Unterschiede zwischen Geschwistern
Geschwister sind sich meist im Hinblick auf äußere Merkmale
sehr ähnlich. Untersuchungen belegen jedoch, daß sich Geschwister
im Hinblick auf Merkmale wie Intelligenz, Gedächtnis oder bestimmte
Persönlichkeitseigenschaften nicht ähnlicher sind als zufällig
ausgewählte, nicht miteinander verwandte Kinder (desselben Alters,
Geschlechts und derselben Schichtzugehörigkeit). Geschwister also,
die so vieles gemeinsam haben - dieselbe Gebärmutter, dasselbe Zuhause
und 50 Prozent ihrer Erbanlagen - sollen sich dennoch ungleich verhalten?
Geschwister wollen sich nicht gleichen, sie wollen sich deutlich vom anderen
abgrenzen und eigene Wege gehen. Die amerikanische Psychologin Schachter
(1982) bezeichnet diesen Prozeß der Abgrenzung, der schon früh
einsetzt, als "De-Identifikation" (vgl. Schachter, 1982 zitiert nach Kasten,
1994, S. 29f). Vor allem eineiige Zwillinge sind darauf besonders erpicht,
eine eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Interessen und
Vorlieben zu entwickeln.
3.3.2 Veränderung der Geschwisterbeziehung im Laufe der Zeit
3.3.2.1 Geburt des zweiten Kindes und frühe Kindheit
Erst seit gut 15 Jahren werden Beobachtungsstudien durchgeführt,
die ihre Aufmerksamkeit darauf richten, was in der Familie vom Zeitpunkt
der Geburt eines zweiten Kindes an passiert. Simmel (1983) geht davon aus,
daß die Ein-Kind-Familie soziologisch gesehen eine Zweiergemeinschaft
ist - Elternpaar mit einem Kind. Ein zweites Kind wirkt sich auf die Gemeinschaft
wie ein drittes Mitglied aus (vgl. Simmel, 1983, zitiert nach Schütze,
1989, S. 313).
Die Geburt des zweiten Kindes bringt aus der Sicht der Eltern weniger
Umstellungen und Veränderungen mit sich, als die Geburt des ersten
Kindes. Der Rollenwechsel vom Ehe- zum Elternpaar ist bereits erfolgt.
Für das ältere Kind kommt es jedoch zu massiven Umstellungen
(vgl. Kasten, 1993, S. 19f; Kasten, 1994, S. 99f). Aus Sicht der Psychoanalyse
hat die Geburt des zweiten Kindes für das erstgeborene immer traumatische
Qualitäten. "Es fühlt sich entthront, beraubt, in seinen Rechten
geschädigt, wirft einen eifersüchtigen Haß auf das Geschwisterchen
... ." (Freud, 1972, zitiert nach Schütze, 1989, S. 315). Der Aspekt
der Rivalität ist sowohl im Alltag als auch in Wissenschaft und Forschung
ein wesentlicher. Grundsätzlich kann man Veränderungen der Geschwisterbeziehung
in der frühen Kindheit anhand eines 3-Phasen-Modells erläutern
(vgl. Kasten, 1993, S. 19ff, 1994, S. 101ff; Schütze, 1989, S. 314ff):
1. Phase (bis etwa 8. Lebensmonat des nachkommenden Kindes):
Etwa die Hälfte der Kinder reagieren auf die Ankunft des Babys mit
negativen Verhaltensänderungen wie Schlafprobleme, Anklammern, Trotz
und dergleichen mehr. Gleichzeitig machen Kinder aber auch Entwicklungsfortschritte.
Die Kontakte zwischen den Kindern werden primär von den Eltern stimuliert,
wobei das Verhalten des ersten Kindes gegenüber dem Baby durchaus
positiv ist. Besonders interessiert und liebevoll erwiesen sich Kinder,
deren Mütter das Kind ermutigten, sich an der Pflege des Babys zu
beteiligen (vgl. Schütze, 1989, S. 316).
2. Phase (8. bis ungefähr 16. Lebensmonat des nachkommenden
Kindes): Die zweite Phase der Geschwisterbeziehung ist einerseits durch
die Rivalität (sowohl körperlich wie verbale Aggressionen), die
das ältere Kind gegenüber dem jüngeren demonstriert, gekennzeichnet.
Das konfliktreiche Verhältnis entsteht vor allem dadurch, daß
der Aktionsradius des Kleineren beträchtlich zunimmt. Auch durch die
etwas einseitige Parteinahme der Eltern für das zweite, "noch schützenswerte"
Kind. Andererseits darf man nicht übersehen, daß in dieser Phase
auch erstmals wechselseitige Interaktionen zwischen den Geschwistern in
Gang kommen (vgl. Kasten, 1994, S. 101f; Schütze, 1989, S. 317f).
3. Phase (17. bis 24. Lebensmonat des nachkommenden Kindes):
Diese Phase, in der das jüngere Kind über passives Sprachvermögen
verfügt, ist durch zunehmende Konsolidierung und Unabhängigkeit
von den Eltern gekennzeichnet. Es gibt zwar zwischen den Geschwistern nicht
weniger Konflikte, die Eltern sehen sich aber nicht mehr genötigt,
ständig einzugreifen (vgl. Kasten, 1993, S. 21; Kasten, 1994, S. 103;
Schütze, 1989, S. 318).
3.3.2.2 Geschwisterbeziehung in der mittleren und späten Kindheit
Studien zu qualitativen Veränderungen der Geschwisterinteraktionen
in dieser Entwicklungsphase belegen, daß sich zwischen den Geschwistern,
natürlich in Abhängigkeit von Geschlechtskombination und Altersabstand,
typische Rollenstrukturen herausbilden. Erstgeborene nehmen häufig
die Rolle des Lehrers oder Modells ein. Die jüngeren Geschwister sind
Lernende, akzeptieren aber dominante geschwisterliche Vorbilder eher, wenn
es sich um eine große Schwester handelt (vgl. Kasten, 1993, S. 43).
Über das Ausmaß der Rivalität zu diesem Zeitpunkt liegen
widersprüchliche Untersuchungsergebnisse vor (vgl. Kasten, 1994, S.
117). In vielen Kulturen übernehmen die älteren Kinder die Versorgungs-
und Betreuungsaufgaben der Geschwister, was in den modernen Industrienationen
jedoch kaum mehr anzutreffen ist (vgl. Kasten, 1993, S. 47).
Für den Psychologen Hartup (1978) ist die Geschwisterbeziehung
ein günstiges Übungsfeld für Aggressionskontrolle. Geschwister
sind einander sozusagen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und letztlich
darauf angewiesen, Lösungs- und Kontrollmöglichkeiten für
ihre gegenseitigen Aggressionen zu finden (vgl. Hartup, 1978, zitiert nach
Kasten, 1994, S. 120).
3.3.2.3 Geschwisterbeziehung in Adoleszenz und frühem Erwachsenenalter
Um mehr Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erwerben, ist
es für Jugendliche und junge Erwachsene besonders wichtig, sich allmählich
von ihren Geschwistern und anderen Familienmitgliedern innerlich und äußerlich
abzugrenzen und zu distanzieren. Es werden jetzt auch gefühlsmäßig
intensive Beziehungen zu Personen außerhalb der Familie aufgebaut.
Geschwister verlieren an Bedeutung (vgl. Kasten, 1994, S. 122f). Bezüglich
Ausmaß der Geschwisteraggression liegen widersprüchliche Ergebnisse
vor. In einer Reihe von Studien wurde dokumentiert, daß der Geschwisterbeziehung
ein beträchtlicher Stellenwert bei der individuellen Sexualentwicklung
beizumessen ist (vgl. Kasten, 1993, S. 87). Ebenso wurde der Einfluß
von älteren Geschwistern bei der Ausbildung devianten und pathologischen
Verhaltens vielfach belegt (vgl. Kasten, 1993, S. 98).
3.3.2.4 Die Geschwisterbeziehung im Erwachsenenalter und höheren
Alter
Die Geschwisterbeziehungen treten vermehrt in den Hintergrund, da andere
Beziehungen z. B. zum Partner oder zu den eigenen Kindern in den Vordergrund
rücken. Ereignisse wie Wohnortwechsel und Heirat eines Geschwisters
spielen dabei eine wesentliche Rolle (vgl. Kasten, 1994, S. 138ff). Im
späteren Erwachsenenalter muß mit dem Tod der Eltern gerechnet
werden, der, wenn damit gerechnet wurde, die Geschwister wieder näher
zusammenbringt. Durch das gemeinsame Trauern entsteht meist wieder Nähe
und Verbundenheit (vgl. Kasten, 1993, S. 140f). Studien zeigen, daß
Geschwister im Alter "einander häufig mehr oder weniger intensiv wiederentdecken
und ihre Beziehung in mehrfacher Hinsicht, z. B. auf den Dimensionen emotionale
Nähe und instrumentelle Unterstützung, reaktivieren und teilweise
auch neu gestalten" (Kasten, 1993, S. 165).
Geschwisterbeziehungen sind, von der Zeitdauer her betrachtet, die längsten
Beziehungen, die es überhaupt gibt. Sie sind jedoch auch die Beziehungen
mit den größten Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten und
Zwiespältigkeiten. Das gleichzeitige Vorhandensein von Zuneigung und
Abneigung begleitet Geschwisterbeziehungen über die gesamte Lebensspanne
(vgl. Kasten, 1994, S. 175).
3.3.3 Einfluß von Geburtsrangplatz
Der Wegbereiter der Geschwisterkonstellationsforschung war Alfred Adler,
der als erster einen Zusammenhang zwischen dem Platz eines Menschen in
der Familie und seiner Lebenseinstellung sah. Auf ihn geht auch die Annahme
vom Entthronungstrauma des erstgeborenen Kindes zurück. (vgl. Leman,
1995, S.13) Das gesamte Sozialverhalten von Erstgeborenen wird demnach
durch diese traumatische frühkindliche Erfahrung geprägt. Zeitgenössische
Vertreter dieser Auffassung bedenken jedoch auch die Wirksamkeit diverser
anderer Faktoren (vgl. Kasten, 1994, S. 44f). Es darf nicht vergessen werden,
daß ein Erstgeborener die Zuwendung seiner Erzeuger zunächst
für sich allein genießen kann. Kein Bruder und keine Schwester
kann diesen "Vorsprung" jemals aufholen.
Von Toman (1988) stammt das Verdopplungs- und Dublikationstheorem. Er
geht von der Annahme aus, daß die Erfahrungen in der Herkunftsfamilie
die Gestaltung neuer Beziehungen in zukünftigen Partnerschaften maßgeblich
bestimmen. Je stärker die späteren Beziehungen den Beziehungen
in der Herkunftsfamilie gleichen, um so glücklicher verlaufen sie.
Das bedeutet für Ehepartner, daß sie besser miteinander auskommen,
wenn ihr Partner dem eigenen Geschwister ähnelt. Sichere Belege gibt
es für diese Theorie jedoch nicht (vgl. Kasten, 1994, S. 45ff).
Erstgeborene werden häufig als introvertiert, leistungsorientiert
und perfektionistisch bezeichnet. Letztgeborene gelten im Alltag oft als
extravertiert, spontan und unkompliziert. Dem mittleren Kind in der "Sandwich-Position"
werden häufig die schlechtesten Ausgangsbedingungen zugeschrieben,
denn sie haben die Eltern nie für sich allein. Einige Untersuchungen
zeigen auch, daß mittlere Kinder häufig aggressiv, asozial und
delinquent sind (vgl. Kasten, 1994, S. 52). Tatsache ist jedoch, daß
Zusammenhänge zwischen Geburtsrangplatz und Persönlichkeitsmerkmalen
nur sehr vage nachgewiesen werden können. "Es ist nicht die Geschwisterposition
an sich, die eine Wirkung ausübt, sondern es sind die mit der Geschwisterposition
verbundenen sozialen, ökologischen, ökonomischen, zwischenmenschlichen
und individuellen Verhältnisse, welche letztlich bestimmen, was für
Persönlichkeitseigenschaften entwickelt werden" (Kasten, 1994, S.
39).
3.3.4 Rolle des Geschlechts der Geschwister
Einflüsse der Geschlechtszusammensetzung der Geschwisterreihe konnten
in einigen Persönlichkeitsbereichen, wie Intelligenz, Kreativität,
Leistung und Berufsinteressen nachgewiesen werden. Man darf hier jedoch
andere Einflußfaktoren wie Altersabstand, Geburtsrangplatz, Familiengröße,
den elterliche Erziehungsstil usw. nicht vergessen. Diese wesentlichen
Einflußfaktoren können die Wirkung des Geschwistergeschlechts
abschwächen, neutralisieren, aber auch verstärken. Die meisten
Untersuchungen sind in 2-Geschwister-Familien durchgeführt worden.
Die Ergebnisse sind daher auch nur beschränkt verallgemeinerungsfähig
(vgl. Kasten, 1994, S. 76f). Die Studien zeigen, daß männliche
Geschwister ihre nachfolgenden Brüder und Schwestern in Richtung des
traditionellen Geschlechtsrollenstereotyps beeinflussen. Buben fördern
also bei ihren Geschwistern das mathematisch-technische Verständnis,
regen schriftstellerische und schauspielerische Fähigkeiten an und
begünstigen den beruflichen Erfolg. Bei weiblichen Geschwistern profitieren
die anderen vor allem in schulischer Hinsicht und im Hinblick auf Kreativität
und sprachabhängige Fähigkeiten. Kinder, die mit älteren
andersgeschlechtlichen Geschwistern aufwachsen, übernehmen mehr typische
Interessen und Beschäftigungsvorlieben des anderen Geschlechts. Sie
verhalten sich in geringerem Umfang rollenklischeehaft. Gleichgeschlechtliche
Geschwister, vor allem wenn sie altersgemäß eng beieinander
liegen, verstärken hingegen das rollenkonforme Verhalten (vgl. Kasten,
1994, S. 63ff).
3.3.5 Rolle des Altersabstandes
Ein Altersabstand von weniger als zwei Jahren wird als klein, einer
über zwei Jahre als groß bezeichnet. Zwischen Geschwistern mit
wenig Altersdifferenz entwickelt sich häufiger eine enge, gefühlsintensive,
aber nicht unbedingt konflikt- und widerspruchsfreie Bindung, als zwischen
Geschwistern mit einem größeren Altersabstand. Geschwister,
die fast gleich alt sind, sind sich oft bezüglich ihrer äußeren
Merkmale recht ähnlich, was eine Identifikation erleichtern kann.
Sie haben mehr Gemeinsamkeiten als altersmäßig weit auseinanderliegende
Geschwister und beschäftigen sich daher auch häufiger miteinander.
Trotzdem spielt sich weitaus mehr Aggression zwischen Geschwistern mit
wenig Altersabstand ab. Grund für diese Aggression scheint Eifersucht
und Neid von seiten des älteren Geschwisters, das sich bei geringem
Altersabstand meist in einer ungünstigeren Position befindet, gegenüber
dem kleinen Geschwisterchen zu sein. Die Anfänge der Ausbildung einer
eigenen, von der Mutter abgegrenzten Identität spielen sich nämlich
im zweiten und dritten Lebensjahr ab und können dann durch die Geburt
des jüngsten Geschwisters massiv beeinträchtigt werden (vgl.
Kasten, 1994, S. 79ff).
3.3.6 Einfluß der Geschwisterzahl
Mit diesem Thema hat sich vor allem der klinische Psychologe Langenmayr
(1985) auseinandergesetzt. Er versucht zu zeigen, daß die Geschwisterzahlendifferenz
(unterschiedliche Anzahl von Geschwistern bei Ehepartnern in ihrer Herkunftsfamilie)
ein wesentlicher Einflußfaktor für partnerschaftliche Zufriedenheit
ist (vgl. Langemayr, 1985, zitiert nach Kasten, 1994, S. 95f). Ältere
Studien zur Geschwisterzahl berücksichtigen den Einfluß anderer
Faktoren nicht.
3.4 Geschwister besonderer Art
3.4.1 Geschwisterbeziehung von Zwillingen
Die Zwillingsforschung wurde schon früh zur Klärung der Anlage-Umwelt-Problematik
verwendet. Erst in den 80er Jahren gab es dann Studien, die sich mit der
besonderen zwischenmenschlichen und sozialen Situation von Zwillingen befaßten
(vgl. Kasten, 1993, S. 53f).
Zwillinge konkurrieren miteinander schon im Mutterleib, um den zunehmend
engeren Raum. Nachgeburtliche Trennungen können sich jedoch ungünstig
auswirken und das Verhältnis zum Zwillingspartner beeinträchtigen.
Der von außen und innen wirkende Individualisierungsdruck führt
dazu, daß sich Zwillinge im Laufe der Zeit auseinander entwickeln
und unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen ausbilden. Es wurde
vielfach nachgewiesen, daß getrennt aufgewachsene Zwillinge sich
in vielen Bereichen ähnlicher bleiben als zusammen aufgewachsene (vgl.
Kasten, 1993, S. 53ff). Schave und Ciriello (1983) sind zusammenfassend
der Ansicht, daß die Zwillingssituation die Ausbildung besonderer
Empathiefähigkeiten begünstigt, welche die Beziehungsgestaltung
und eventuell auch berufliche Orientierung im späteren Leben beeinflussen
(vgl. Schave & Ciriello, 1983, zitiert nach Kasten, 1993, S. 100).
Zwillinge können sich lieben oder hassen, eine besondere Bindung besteht
jedoch lebenslänglich zwischen ihnen.
3.4.2 Geschwisterbeziehung und Behinderung
Im Mittelpunkt vieler empirischer Untersuchungen stehen die nicht behinderten
Geschwister und ihre Anpassungsleistungen. Behinderte (vor allem ältere)
Geschwister stellen eine Belastung für die anderen Kinder in der Familie
dar. Spannungen und Konflikte können aber mit der Zeit abgebaut werden.
Vielfach werden sogar positive Persönlichkeitseigenschaften, wie Einfühlungsvermögen,
Verantwortungs- und Hilfsbereitschaft, die durch das Aufwachsen mit einem
behinderten Geschwister gefördert werden, erwähnt. Relativ selten
wurde das Verhalten und Erleben behinderter Geschwister untersucht. Die
meisten Autoren sind sich jedoch einig, daß behinderte Kinder profitieren,
wenn sie mit nicht behinderten Geschwistern aufwachsen (vgl. Kasten, 1993,
S. 101ff).
3.4.3 Geschwisterbeziehung von Stiefgeschwistern und Halbgeschwistern
Aufgrund der immer steigenden Scheidungsrate kommt es neben der Kernfamilie
zu neuen Familienformen. Stief- und Halbgeschwister sind heute keine Seltenheit
mehr. Stiefgeschwister kennen sich oftmals kaum, wenn sie beginnen, in
einem gemeinsamen Haushalt zu leben. Außerdem haben sie vorangehende
Erlebnisse (Scheidung) zu bewältigen. Dennoch untermauern empirische
Befunde, daß sich ganz normale geschwisterliche Beziehungen entwickeln,
wenn bestimmte Mindestvoraussetzungen, wie vergleichbares Alter und Kontakthäufigkeit,
erfüllt sind (vgl. Kasten, 1993, S. 147ff). Die Geburt eines Halbgeschwisters
stellt in der Regel ein kritisches Ereignis dar, da sich die älteren
Stiefkinder meist ablehnend gegenüber dem kleinen Geschwister verhalten.
"Typische Stiefgeschwisterprobleme entstehen vor allem dann, wenn die neue
Familie zum Zeitpunkt der Geburt des Halbgeschwisters in sich noch nicht
gefestigt ist und den mitgebrachten Kindern noch keine Geborgenheit vermittelt"
(Kasten, 1994, S. 186).
3.4.4 Geschwisterbeziehungen von Adoptiv- und Pflegekindern
Geschwisterbeziehungen von Adoptiv- und Pflegekindern sind von der empirischen
Forschung so gut wie gar nicht als eigenständiges Thema behandelt
worden. Verschiedene Autoren betonen jedoch, daß sich nach der manchmal
komplizierten Eingewöhnungsphase zwischen Kindern in Adoptiv- und
Pflegefamilien ganz normale geschwisterliche Beziehungen entwickeln. Empirische
Nachweise fehlen jedoch bislang (vgl. Kasten, 1993, S. 174ff; 1994, S.
205f).
4. Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme
Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand darin, einen kurzen Überblick
über den Bereich der Geschwisterforschung zu geben. Die empirischen
Sozialwissenschaften haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mit dem
Thema Geschwister und dessen Einflüsse auf die Persönlichkeit
nur wenig befaßt. Dies ist verwunderlich, angesichts des Stellenwertes,
welcher der Geschwisterbeziehung im Alltag beigemessen wird. In den letzten
Jahren sind jedoch vermehrt Arbeiten zu registrieren. Die Geschwisterbindung
ist durch Konflikte in allen Lebensphasen geprägt, egal ob das Geschwisterchen
gerade auf die Welt gekommen ist oder ob man im Alter den verlorengegangen
Kontakt wieder sucht. Fest steht, daß die Geschwisterbeziehung von
Ambivalenzen geprägt ist. Eifersucht, Neid, Haß und Bestrebungen,
sich weg vom Geschwister zu bewegen, sind Gefühle, die Geschwister
kennen. Andererseits ist die Geschwisterbeziehung aber auch durch Wärme,
Hilfsbereitschaft, Kooperation und Nähe gekennzeichnet. Sie ist eine
schwierige, aber auch einzigartige Bindung, die uns unser ganzes Leben
lang begleitet. Jeder, der Brüder oder Schwestern hat, wird von ihnen
geprägt und beeinflußt.
Forscher haben Einflüsse, wenn auch sehr vage, sowohl des Geburtsrangplatzes
als auch der Geschlechtszusammensetzung der Geschwisterreihe und der Geschwisterzahl,
auf die Persönlichkeitsentwicklung festgestellt. Vergessen darf man
dabei jedoch nicht, daß andere Faktoren, wie die Eltern-Kind-Beziehung,
der elterliche Erziehungsstil und sozioökonomische Bedingungen neben
den Einflüssen der Geschwisterbeziehung, wesentlich für die Ausbildung
spezieller Persönlichkeitsmerkmale sind. Die spätere Partnerbeziehung
wird zwar von den Geschwisterbeziehungen in der Herkunftsfamilie mitgeprägt,
hat aber, wie alle Bereiche des Lebens, eine eigene Dynamik. Besondere
Arten der Geschwisterbeziehung, wie die von Zwillingen, Stief- und Halbgeschwistern
oder Adoptiv- und Pflegekindern, sind teilweise stärker problembehaftet.
Es ist aber durchaus möglich, daß sich eine, für beide
Geschwisterseiten befriedigende Bindung entwickelt.
Ich habe einen sieben Jahre älteren Bruder. Seine damalige Reaktion
auf meine Geburt: "Kann man die nicht gegen einen Hund austauschen". Ich
wurde also von meinem lieben Geschwisterchen sehr herzlich empfangen. Unsere
"Liebe" breitete sich in unser beider Kinderjahre noch aus. Mein Bruder
Martin steckte mich in die Klomuschel, ich steckte ihm den schmutzigen
Besen ins Gesicht und hin und wieder störte ich die traute Zweisamkeit
mit seinen neuen Freundinnen. Wir verstanden uns also alles in allem prächtig
und mußten uns auch noch ein gemeinsames Zimmer teilen, was zur Vertiefung
unserer Gefühle beitrug. Mit der Zeit erkannte ich aber, daß
es auch gewisse Vorteile bringt, einen großen Bruder zu haben. Auch
mein Bruderherz entdeckte Seiten an mir, die ihm nicht lästig erschienen.
Aus dem Haß der Kindheit wurde eine tiefe, ehrliche und harmonische
Beziehung. Mein großer Bruder wurde ein wertvoller Freund.
Die Behandlung des Themas Geschwisterforschung hat meine Erinnerungen
an meine Kindheit mit meinem Bruder wieder aufgefrischt. Ich erlebte unsere
Geschwisterbeziehung als eine wichtige Erfahrung, die die Entwicklung meiner
eigenen Persönlichkeit mitprägte. Der Literatur kann entnommen
werden, daß die Forschung auf diesem Gebiet erst am Beginn steht,
und daß in den nächsten Jahren zahlreiche Studien folgen werden.
Literaturverzeichnis
Bank, S. P. & Kahn, M. D. (1989). Geschwister-Bindung.
Paderborn: Junfermann Verlag.
Haberkorn, R. (Hrsg.). (1991). Als Zwilling geboren. Über eine
besondere Geschwisterkonstellation. München: Kösel-Verlag.
Kasten, H. (1993). Die Geschwisterbeziehung (Bde. 1 und 2). Göttingen:
Hogrefe.
Kasten, H. (1994). Geschwister: Vorbilder, Rivalen, Vertraute.
Berlin: Springer.
Leman, K. (1995). Füreinander geboren. Wie die Geschwisterreihe
unsere Partnerwahl prägt. Freiburg: Herder Verlag.
Schenk-Danzinger, L. (1993). Entwicklungspsychologie (22., unveränderte
Aufl.). Wien: Österreichischer Bundesverlag.
Schütze, Y. (1989). Geschwisterbeziehungen. In R. Nave-Herz &
M. Markefka (Hrsg.), Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Familienforschung
(Bd. 1) (S. 311-324). Neuwied: Luchterhand.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
14) Scheidung und ihre Folgen für die betroffenen
Kinder (Carina Kreuzinger)
1. Einleitung
"Scheidung ist ein dermaßen streßgeladenes Problem, daß
es gesunde Menschen für eine unterschiedlich lange Zeit zu funktionsgestörten
Personen macht" (BEAL, 1994).
"SCHEIDUNG" - mit diesem Wort assoziiert man Schmerz, Leid, Einsamkeit,
Streit, Depression, neuer Anfang, Erlösung; letztendlich eine Trennung,
die endgültig und unwiderruflich ist. Welche Gefühle wirklich
damit verbunden sind, wird nur der nachvollziehen können, der mit
einem solchen Konflikt bereits konfrontiert worden ist. Eine Scheidung
kann als kritisches Lebensereignis gesehen werden, das für alle Beteiligten
sehr schwer verarbeitbar ist.
Grundsätzlich gilt, daß eine Scheidung kein punktuelles Ereignis
ist. Einer Scheidung gehen meist Jahre des Konfliktes voraus, und diese
Jahre waren für alle Betroffenen sehr belastend. Auf jeden Fall sollte
unterschieden werden zwischen juridischem und psychologischem Zeitpunkt
der Scheidung. Der juridische Zeitpunkt bezeichnet den Tag, an dem die
Scheidung rechtskräftig wird. Psychologisch gesehen handelt es sich
um einen Prozeß, an dessen Beginn konflikthafte Auseinandersetzungen
zwischen den Ehepartnern stehen, die auch den Kindern nicht verborgen bleiben.
Der psychologische Prozeß setzt sich fort über die tatsächliche
Trennung, bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beteiligten ihre Beziehungen
neu strukturiert haben, d. h bis sie den Bewältigungsprozeß
hinter sich gebracht haben, was 1-1,5 Jahre dauern kann.
Warum kommt es zu Scheidungen ?
Ein Grund ist, daß sich die Rollenverteilung zwischen Mann und
Frau verändert hat, denn es ist heutzutage keine Seltenheit mehr,
daß eine Frau berufstätig ist. Diese Vorstellung einer gleichberechtigten
Partnerschaft bietet ausreichend Hürden. Andere wieder möchten
aus einer Beziehung fliehen, die unerträglich geworden ist. Für
die Betroffenen einer Trennung ergeben sich Veränderungen in vielen
Bereichen - in sozialen, psychischen und ökonomischen.
Mittlerweile sind Trennung und Reorganisation eines neuen Familiensystems
Massen-phänomene unserer Zeit, wie es auch die psychotherapeutische
Praxis zeigt. Doch im Alltag ist noch immer die subjektive Theorie vorherrschend,
daß eine Scheidung für Kinder psychische Folgen nach sich ziehen
muß,
weil es für die psychische Gesundheit kleiner Kinder unabdingbar ist,
in einer typischen Kleinfamilie aufzuwachsen. Sollte es zu einem Versagen
einer Familie kommen, so könne man die delinquente Entwicklung des
betroffenen Kindes bereits voraussagen.
2. Die Scheidung aus der Sicht des Kindes
Kinder sind in Fällen von Trennung oder Scheidung regelmäßig
Betroffene, selten sind sie Handelnde im Sinne von Entscheidenden. Sie
sind allen Auswirkungen wie familiären Spannungen (z. B. Mutter und
Vater gleich viel lieben), sozialen Spannungen (wie denken andere über
die Scheidung, z. B. Nachbarn) und finanziellen Spannungen (zukünftiger
Wohnort) ausgeliefert. Zusätzlich bedeutet für ein Kind Scheidung
die Trennung vom Vater und meistens auch den nachhaltigen Bruch in der
Beziehung zum Vater. Die Väter sind meistens die nicht-sorgeberechtigten
Elternteile und sie müssen den gemeinsamen Haushalt verlassen,
was oft dazu führt, daß sie den Kontakt mit dem Kind abbrechen.
Es ist möglich, daß längerfristige bzw. permanente Konsequenzen
auftreten. Kurzfristig gesehen stellt eine Scheidung für ein Kind
eine hochgradige Belastung dar, bedeutet dieser Umstand doch den Verlust
des Vaters. Trotzdem kann man nicht sagen, daß es besser wäre,
eine Scheidung zu vermeiden, dem Kind diese emotionale Erschütterung
zu ersparen und statt dessen eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die keine
emotionale Basis mehr bietet. Die Lösung des Familiensystems
führt bei allen Beteiligten zu verschiedenen Symptomen wie Schlafstörungen,
psychosomatischen Erkrankungen, Depression, überdurchschnittliche
Kränkbarkeit, Schulversagen, Gewalt oder erhöhte Disposition
für spätere neurotische Erkrankungen als Langzeitfolge. Der Scheidungsprozeß
kann sowohl eine Identitätskrise, als auch eine Erschütterung
des Selbstkonzepts zur Folge haben. "Die Entscheidung, eine unglückliche
Partnerschaft zu beenden, fällt Eltern besonders schwer, wenn sie
an die Kinder denken. Doch die Trennung muß für Kinder keine
Tragödie bedeuten" (Bernhardt, 1995, S. 6).
Man muß sich darüber im klaren sein, daß die Auflösung
einer Familienkonstellation deshalb von den Ehepartnern beschlossen wird,
weil sie keine andere Lösung ihrer Probleme sehen. Für die Kinder
bedeutet das in der Regel neue Probleme und Veränderungen in ihrem
Leben. Was für die Eltern eine Lösung ihrer eigenen Probleme
bedeutet, heißt für das Kind das Entstehen von Problemen.
3. Scheidungszahlen in Österreich
-
Betrachtet man die Scheidungsrate, so kann man sagen, daß sie seit
den 70er Jahren angestiegen ist, 1985 einen Höchststand erreicht hat
und sie nimmt seither kontinuierlich zu.
-
Es gibt rund 15.000 Ehescheidungen im Jahr.
-
Die Gesamtscheidungsrate liegt bei ca. 40%, d.h. 4 von 10 während
der 90er Jahre geschlossenen Ehen werden früher oder später geschieden
(durchschnittl. Ehedauer ca. 8 Jahre, Scheidungsrisiko ist in den ersten
5 Ehejahren am größten).
-
Jährlich sind rund 16.000 Kinder und Jugendliche von einer elterlichen
Scheidung betroffen, davon sind ca. 2/3 unter 14 Jahren. Man kann davon
ausgehen, daß fast die Hälfte der heute geborenen Kinder bis
zu ihrer Volljährigkeit die Scheidung ihrer leiblichen Eltern erlebt
(in Wien sogar 50%, in den USA 40% aller Kinder, viele davon sogar im Vorschulalter).
-
Ungefähr ein Drittel der alleinerziehenden Eltern ist auf eine Wiederheirat
orientiert und lebt zum Teil mit Kind und Partner zusammen.
-
Die Hälfte der leiblichen Eltern ohne Sorgerecht hält einen mehr
oder wenigen regel-mäßigen Kontakt zu ihren Kindern, davon sind
35 % aktiv an der Erziehung beteiligt.
4. Studien
Die folgenden Untersuchungen sollen zeigen, wie unterschiedlich die
Reaktion der Kinder auf eine Scheidung sein kann.
Wallerstein et al. (1988) führten eine Langzeitstudie durch,
weil sie erkannten, daß eine Scheidung kein isolierter Prozeß
ist, sondern daß Auffälligkeiten erst nach einiger Zeit auftreten.
Sie haben 131 Kinder aus 60 Scheidungsfamilien zum Trennungszeitpunkt und
zu drei späteren Zeitpunkten untersucht (18 Monate, 5Jahre, 10 Jahre).
Die Ehepaare waren durchschnittlich 11 Jahre verheiratet, das Alter der
Kinder variierte vom Vorschulalter bis zur Adoleszenz. Es wurden intensive
Gespräche geführt, die Kinder wurden bei Spielsitzungen beobachtet
und zur Ergänzung der Daten wurden Informationen aus der Schule geholt.
Wie Wallerstein et al. herausfanden, sind die Reaktionen der Kinder
altersabhängig.
Die Vorschulkinder waren stark beunruhigt hinsichtlich der Scheidung,
es kam zu einer Regression und akuter Trennungsangst. Zum ersten Zeitpunkt
waren die Jungen weiterhin verstört, während sich die Mädchen
einigermaßen beruhigt hatten. Fünf Jahre später konnten
sich die Kinder kaum noch bewußt an Familie und Scheidung erinnern.
Einige waren darunter, die noch Versöhnungsphantasien hegten, ansonsten
wiesen sie angepaßtes Verhalten in der Schule auf und entsprachen
auch den Leistungsanforderungen.
Die älteren Kinder litten unter Gefühlen der Machtlosigkeit.
Sie waren voller Wut und Aggressionen, dann kam es zu Depressionen, sozialem
Rückzug und Leistungsabfall. Auch hier erholten sich Mädchen
schneller, während Buben noch länger verstört waren. 10
Jahre später wurden noch starke Nachwirkungen registriert und Gefühle
von Angst, die Situation könne sich im eigenen Leben wiederholen.
In Folge könnte man sagen, daß die älteren Kinder mehr
belastet waren als die zum Zeitpunkt der Scheidung jüngeren Kinder.
Langfristige Störungen können auftreten, sind aber abhängig
von der Lebensqualität und von der Beziehung zum nicht-sorgeberechtigten
Elternteil.
Eine weitere Untersuchung führte Hetherington (1979) durch,
und diese Studie zählt zu den bekanntesten und gründlichsten
Langzeitstudien im bezug auf das Verhalten außerhalb der Familie,
z. B. im Spiel, sozialen Interaktion. 48 Jungen und Mädchen wurden
2 Monate, 1 Jahr und 2 Jahre nach der Scheidung untersucht, wobei die Kinder
ungefähr 4 Jahre alt waren. Informationen bekamen die Untersucher
durch Beobachtung, Spiel und Interaktion im Kindergarten und in der Schule,
das Verhalten wurde von Lehrern und Erziehern eingeschätzt.
In intellektueller und sozialer Hinsicht waren Kinder aus Scheidungsfamilien
denen aus der Kontrollgruppe unterlegen. Sie waren ängstlicher, apathischer,
litten unter Schuldgefühlen. Diese Symptome waren nach 2 Jahren bei
den Mädchen verschwunden, während die Buben diese Verhaltensmuster
beibehielten. In der Interaktion mit anderen Kindern waren sie sehr um
Aufmerksamkeit bemüht, aggressiver und abhängiger von Bestätigung.
Die Jungen waren bei anderen Kindern weniger beliebt und verbrachten mehr
Zeit mit Mädchen. Hetherington (1985) untersuchte die Kinder nochmals,
wobei sie zu Hause beobachtet wurden und sowohl selbst als auch Lehrer,
Eltern und Klassenkameraden Fragebögen auszufüllen hatten. In
Familien, wo die Mutter nicht wieder geheiratet hatte, waren Mädchen
nicht auffällig, während Buben in ihrem Verhalten eher aggressiv
waren. Im Falle einer Heirat, die noch keine 2 Jahre zurücklag, wiesen
beide Gruppen Verhaltensprobleme auf, bei mehr als 2 Jahren zeigten sich
Mädchen weniger angepaßt und die Jungen waren ruhiger. Die Folge
daraus ist, daß langfristige Auswirkungen abhängig vom Geschlecht,
von der Wiederverheiratung der Mutter, der Anpassung der Mutter an die
neue Situation und von der ehelichen Harmonie sind.
Guidubaldi et al. (1986) führten eine landesweite Untersuchung
in den USA durch. Sie untersuchten Faktoren wie soziale Anpassung und schulische
Leistungen sowie die Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen. Man fand
heraus, daß eine gute Beziehung zum Vater insbesondere bei Jungen
zu weniger Konflikten und in Folge zu besseren schulischen Leistungen führt.
Auch ein lockerer Erziehungsstil und regelmäßiger Tagesablauf
wirken sich positiv aus. Der Bericht wollte aufweisen, daß man sich
nicht darauf festlegen sollte, Scheidungskinder mit Kindern aus traditionellen
Familien zu vergleichen, sondern auf verschiedene Reaktionen der Kinder
eingehen sollte, um bessere Ratschläge geben zu können.
Kulka (1979) untersuchte das psychische Wohlergehen Erwachsener,
deren Eltern geschieden worden waren, in Form von 2 Querschnittuntersuchungen
in den Vereinigten Staaten 1957 und 1967. Es konnte festgestellt werden,
daß Ängstlichkeit, körperliche Beschwerden und Ehe-probleme
häufiger auftreten als bei Erwachsenen ohne Scheidungserfahrung. Frauen
hatten tendenziell mehr Trennungen hinter sich und betonten ihre Rolle
als Mutter oder im Beruf mehr als die Rolle der Ehefrau. Generell war der
Grad der allgemeinen Zufriedenheit hinsichtlich der eigenen Elternrolle
und der elterlichen Kompetenz bei allen gleich.
Auch Block (1986) führte zu diesem Thema Untersuchungen
durch. Es wurden 128 Kinder vor und nach der Scheidung der Eltern untersucht
(mit 3 und 14 Jahren). Sie wurden dann von Lehrern auf einer Persönlichkeitsskala
bewertet. Grundsätzlich unterschieden sich die Kinder bereits gravierend
von anderen vor der Trennung. Die Jungen wirkten schon im Alter von 3 Jahren
störrisch, labil, ruhelos und in weiterer Folge waren sie aggressiv,
impulsiv und sie konnten Streßsituationen nur unzureichend standhalten.
Die Mädchen waren destruktiv, kamen mit anderen Kindern schlecht zurecht,
waren emotional labiler. Daraus konnte Block folgern, daß Spannungen
schon Jahre vorher in der Ehe spürbar sind, welche dann auf die Kinder
übertragen werden. Sie wachsen in einer konfliktreichen Atmosphäre
auf, die Mütter zeigen weniger Selbstwertgefühl und sind weniger
auf die Kinder orientiert. Man hat jetzt gesehen, daß verschiedene
Faktoren herausgearbeitet werden können, die in Folge zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Wie bereits erwähnt, ist Scheidung ein Prozeß
und die jahrelangen Spannungen, der Ablauf der Scheidung, wie es den Kindern
mitgeteilt wurde und vor allem "was", die Auswahl des sorgeberechtigten
Elternteils, die Besuchszeitenregelung das alles fließt auf ein
Kind ein und wirkt sich dann auf seine Persönlichkeit und auf die
Bewältigung aus.
5.1 Reaktionen der Kinder
Kinder reagieren immer auf die Scheidung, weil ein so einschneidendes
Erlebnis für alle liebenden Personen eine Erschütterung bedeutet.
Man kann die Problematik der Beteiligten oft nicht genau ermessen, weil
es auf den Zeitpunkt der Untersuchung ankommt und dazu sind Langzeituntersuchungen
notwendig. Die Auswirkungen einer Scheidung auf Kinder sind unterschiedlich,
und sind von verschiedenen Faktoren abhängig wie man bereits an den
Studien sehen konnte:
-
vom Geschlecht
-
von der Zeit, die seit der Scheidung vergangen ist
-
günstige Umstände, (z. B. Selbstheilungskräfte) sind
erforderlich, aber es ist auch möglich, daß Konflikte im erwachsenen
Alter wieder auftreten;
-
es spielen auch verschiedene andere Faktoren mit, z. B. Beziehung zu
den Eltern, Sorgerechtsregelung, Lebensqualität nach der Scheidung
usw.
-
Altersspezifische Reaktionen: Es gibt kein optimales Alter, in dem
Kinder die Scheidung ihrer Eltern leichter oder schwerer verkraften. Jede
Altersstufe stellt dem Kind auf Grund seiner kognitiven und psychischen
Entwicklungsstufe qualitativ unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen
zur Verfügung, weswegen Kinder ihre Reaktionen auf die Scheidung unterschiedlich
zum Ausdruck bringen, verarbeiten und bewältigen können.
Im Kleinkindalter kommt es zu deutlich beobachtbaren Verhaltensänderungen,
wie z. B. Regression in der Sauberkeit, Trennungszustände, Weinen,
Angstzustände, gesteigerte Aggressivität und Trotzverhalten.
Man sollte Gefühle des Kindes wahrnehmen und versuchen es zu verstehen,
auch ist es wichtig eine kindgerechte Erklärung abzugeben. Bei guter
Qualität der Betreuung verschwinden Symptome innerhalb eines Jahres.
Die Vorschulkinder reagieren mit erhöhter Irritierbarkeit, verstärktem
Weinen, aggressivem Verhalten. Sie haben Schuldgefühle, weil sie alle
Probleme auf sich selbst beziehen (egozentrische Weltansicht). Kinder zwischen
fünf und sechs Jahren sind bereits in der Lage, ihre Gefühle
der Wut und Trauer zu zeigen und zu artikulieren. Schulkinder zeigen Gefühle
starker Traurigkeit, Gefühle der Macht-, und Hilflosigkeit und ambivalente
Gefühle in bezug auf eine Person. Neun- bis Zwölfjährige
sind bereits in der Lage die Gründe der Eltern für die Scheidung
zu verstehen. Sie wollen nach außen hin gelassen und mutig wirken,
aber das deutet keineswegs auf eine gute emotionale Bewältigung hin.
Kinder im Schulalter fühlen sich besonders erschüttert und alleingelassen
und es kann zu Schulproblemen und depressiven Reaktionen kommen. Im Jugendalter
gibt es oft Reaktionen wie Zorn, Trauer oder Schmerz. Aber sie verfügen
über die Fähigkeit zur bewußten Reflexion und die ermöglicht
ihnen, die Eltern als voneinander unabhängige Personen zu sehen, die
unterschiedliche Interessen entwickelt haben. Die Jugendlichen können
auch eigene Beziehung zu den Eltern von deren Beziehung zueinander trennen.
5.2. Reaktionen aus psychoanalytischer Sicht
Kinder sind in solchen Situationen die Hauptleidtragenden, weil sie
der Willkür der Eltern ausgeliefert sind. Meist können die Kinder
nicht verstehen, warum der Vater sie verläßt, sie sehen es auch
als Scheidung von ihnen und reagieren mit Trauer oder auch Wut. Diese Emotionen
können sich gegen beide Elternteile oder gegen den einen, dem sie
die Verantwortung am Scheitern der Ehe zuweisen, richten. Ein Teil dieser
Vorwürfe, der sich gegen die Eltern richtet, dient als Abwehr der
eigenen Schuldgefühle, denn die Kinder geben sich oft selbst die Schuld
an einer Scheidung. Sie glauben, sie seien Schuld an der Trennung,
weil sie die Eltern enttäuscht haben. Solche Gedanken führen
bei vielen Scheidungskindern zu einer Verminderung des Selbstwertgefühls,
die Scheidung erscheint ihnen als Strafe, Vergeltung für zu geringe
Leistungen und sogar für verbotene Gedanken (z. B. Ambivalenz zwischen
Liebe und Haß). Solche Schuldphantasien im Sinne einer Mitschuld
an der Trennung treten laut einer Schätzung von Wallerstein und Kelly
in 30-50 % der Fälle auf. Zusätzlich kann es auch zu einer massiven
Angst
kommen,
Angst vor Liebesverlust, vor den Veränderungen, die mit der Trennung
einhergehen. Diese emotionale Erschütterung kann so schwerwiegender
Art sein, daß sie dem Kind Schlaf und Ruhe rauben. Fragen wie -wo
werden wir wohnen? werde ich den Papa je "wiedersehen"? wie soll es denn
jetzt weitergehen? beschäftigen die Kinder sehr. In weiterer
Folge beginnen die Kinder sich zu fürchten, nach dem Papa auch noch
die Mama zu verlieren. Das kann zu Regressionen führen oder zu einer
extremen Anhänglichkeit, die soweit gehen kann, daß das Kind
alleine nirgends mehr bleibt und die Mutter nicht mehr aus seiner Nähe
läßt. Die Trennung von einem Elternteil kann bei manchen Kindern
zu psychischen Reaktionen führen. Ein Junge, der sich mit seinem
Vater identifiziert, der so sein will wie er, kann durch den Weggang des
Vaters alles verlieren. Der Verlust erscheint ihm wie eine Kastration,
es tritt Verzweiflung, Angst und ein Gefühl der Überwältigung
auf. Das Ausmaß und die Art der unmittelbaren Reaktion auf die Scheidung
hängt auch von der individuellen Disposition des Kindes ab, aber es
kann passieren, daß ein Kind sein psychisches Gleichgewicht verliert.
6. Nach-Scheidungs-Krise
Diese Krise ist wesentlich von äußeren Einflüssen der
Scheidung abhängig. Die negativen Auswirkungen der Scheidung auf die
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern können von den Eltern
reduziert werden.
-
Besonderes Augenmerk sollte auf die Art der Mitteilung gelegt werden. Meistens
ist es für die Kinder ein Schock zu erfahren, daß sich die Eltern
trennen wollen. Davor haben viele Eltern Angst, eigentlich sind es eher
Schuldgefühle und deswegen erfolgt die Mitteilung meist in sehr knapper
Form. Eltern müssen ihren Kindern gegenüber Verantwortung übernehmen
und sich Schuld eingestehen, aber auch dem Kind gegenüber = verantwortete
Schuld.
-
Wenn es von seiten des Kindes zu keiner Reaktion kommt, sind viele Eltern
froh und glauben, das Kind wäre gar nicht betroffen. ABER: Das Ausbleiben
sichtbarer Affekte bedeutet nicht, daß die Kinder nicht trauern,
sondern es weist auf Schwierigkeiten in der Bewältigung hin. Eltern
machen oft den Fehler auf Symptome zu warten, auf abnorme Verhaltensmuster
und übersehen dann wirkliche Veränderungen, die möglicherweise
erst Jahre später auftreten. Wenn die Kinder also nicht sofort reagieren,
unterlassen Eltern Gespräche über die Scheidung und über
die zukünftige Lebensgestaltung. Somit stehen die Kinder alleine da
mit ihren Problemen.
-
Manchmal kommt es auch zu einem Abwälzen der Verantwortung
auf den anderen Elternteil. Der Konflikt zwischen den Partnern geht weiter,
und das Kind wird inmitten ihrer Streitereien vergessen bzw. wird sogar
zum Zentrum der Streitigkeiten. Manche Eltern erwarten, daß sich
das Kind ihrer Meinung anpaßt, sich mit ihm solidarisiert und den
anderen Partner ablehnen soll. Damit kommt das Kind in einen Loyalitätskonflikt.
-
Man soll die Scheidung vor dem Kind nicht verheimlichen und es belügen.
Die Eltern verschieben das Gespräch oder wollen es rasch hinter sich
bringen, weil sie sich selbst schuldig fühlen, sie erzählen etwas
vom Urlaub des Vaters. Kinder haben zu Eltern Grundvertrauen (sie sollten
immer da sein, Stütze sein, jemand, auf den man sich verlassen kann)
und dieses Vertrauen sollte nicht erschüttert werden. Ein Kind bildet
sich seine eigene Meinung über die Trennung. Wenn es die Eltern belügen,
so ist das Vertrauen verletzt, somit hat ein Kind später Probleme
in Beziehungen. Die Eltern müßten also versuchen den Schmerz
der Trennung zu lindern. Leider können das viele nicht, geben sich
Illusionen und Hoffnung hin, es würde dem Kind nichts ausmachen, übersehen
seelische Reaktionen.
-
Auch die neuen Lebensumstände sind für Kinder eher belastend
(Umzug, neue Mitschüler, Mutter als Alleinerzieher, pädagogische
Verantwortung wird aufgeteilt), und diese Verhaltensmuster können
zu Streß und Spannung führen.
-
Kinder schämen sich oft, weil sie keine "richtige" Familie haben.
-
Es kann zu Konflikten in der Mutter-Kind-Beziehung (ökonomische Probleme,
Mehrfach-belastung, Stimmungsschwankungen, auf beiden Seiten Aggressionen,
Alltagskonflikte) und zu Konflikten in der Vater-Kind-Beziehung (Haß,
weil er Kind verlassen hat, Kränkung) kommen.
7. Wie kann man auf die Kinder eingehen ?
Wichtig in der ersten Phase nach der Trennung ist vor allem die verbale
Kommunikation. Man muß mit den Kindern sprechen, sie trösten,
ihnen Gelegenheit geben Affekte zu äußern, auf Aggressionen
nicht aggressiv antworten, ihnen zuhören und sie verstehen. Es ist
wichtig mit den Kindern über die Umstände der Scheidung und die
Zukunft zu sprechen, den Schmerz zu erkennen und ungewöhnliches Verhalten
zu verstehen. Sie müssen wissen, daß sie von beiden Elternteilen
geliebt werden. Für das Kind sollte es möglich sein, mit der
Mama über den Papa sprechen zu können, ohne damit in einen Loyalitätskonflikt
zu geraten. Zusätzlich sollte man hilfreiche Aktivitäten und
Strategien entwickeln, um ihnen zu helfen die Krise zu bewältigen.
Viele Eltern wollen für die Krise ihres Kindes keine Verantwortung
übernehmen, was zu einer Verschlimmerung der psychischen Situation
führt. Es treten Symptome oder sollte man es als Hilferufe bezeichnen
auf wie Bettnässen, soziale Konflikte, Leistungsnachlaß, vermehrte
Aggressionen, übertriebene Anhänglichkeit. Diese Zeichen werden
nicht mit der Scheidung in Zusammenhang gebracht, sondern als Fehlverhalten
bezeichnet. Diese Eltern erkennen die Scheidung nicht als Krise an. Sie
verstehen die Reaktionen nicht, und können deswegen ihren Kindern
auch nicht bei der Bewältigung helfen. Die Kinder spüren den
Verlust an liebevoller Zuwendung und werden immer einsamer, ihre Angst
wird größer. Sie leben in einem ständigen Hin-und-Her,
die Konflikte mit den Eltern werden größer, was dazu führt,
daß die zurückweisenden und kritischen Reaktionen der Eltern
häufiger werden.
Wichtig ist, daß Kinder das Gefühl haben, daß es weitergeht,
daß sie noch immer geliebt werden und auch lieben können. Sie
müssen sich der Mutter sicher sein, nicht von ihr verlassen zu werden.
Man sollte darauf achten, daß sich ein Kind auch in der neuen Beziehung
sicher und geborgen fühlt. Zusätzlich sollte man ihm die Aussicht
auf Freude und Befriedigung offenhalten. Die tiefgreifendste Veränderung
erfahren die Kinder durch den Verlust des Vaters, deswegen sind regelmäßige
Kontakte wichtig. Auf die Qualität dieser Beziehung sollte besonders
Wert gelegt werden (Väter halten häufiger zu ihren Söhnen
Kontakt). Eine gemeinsame elterliche Sorge wäre vorteilhaft (Kinder
sollten Kontakt zu beiden Elternteilen haben). Auf jeden Fall sollte das
Kind über die Tätigkeiten seines Vaters informiert sein und vice
versa. Schützend können auch Persönlichkeitsfaktoren sein
wie Kontrollüberzeugung, soziale Kompetenzen, Flexibilität in
den Bewältigungsstrategien, geringes geschlechtsstereotypes Verhalten,
überdurchschnittliche sprachliche und kommunikative Fähigkeiten.
8. Zusammenfassung
Scheidung ist manchmal die beste Lösung für Kinder, die in
einer Familie aufwachsen, wo es statt Liebe nur mehr Spannungen gibt. Trotzdem
kann es zu Folgeerscheinungen kommen, die das Kind in seinem Leben begleiten.
Es kann zu leistungsbezogenen Beeinträchtigungen, aber auch zu emotionalen
und sozialen Problemen kommen. Auf Grund der erschwerten Entwicklungsbedingungen
können psychische Störungen nicht ausgeschlossen werden. Diese
Kinder leiden unter Problemen der psychosozialen Anpassung, sie haben Probleme
mit ihrem Selbstwertgefühl und auch in Beziehungen zu anderen. Ihre
Probleme im Umgang mit Aggression richten sie oft gegen sich selber, und
das kann zu einer Depression führen. Leider kann es passieren, daß
sich Kinder geschiedener Partner vorschnell in eine Beziehung stürzen,
um dort jene Zuneigung zu suchen, die sie vermißt haben. Es kann
auch so sein, daß ihnen die Ablösung vom Elternhaus sehr schwer
fällt und sie sich "losreißen" müssen. Mädchen insbesondere
wählen sich den erstbesten Partner, weil sie große Sehnsucht
nach einer Partnerschaft haben. Und obwohl sie den Fehler der Eltern nicht
wiederholen wollen, sind sie viel zu sehr geprägt von der Beziehung
ihrer Eltern. "Ich weiß nicht, wie Menschen persönliche Konflikte
bereinigen können, weil ich nie gesehen habe, daß meine Eltern
es taten. Ich habe nie eine normale gesunde Beziehung zwischen einem Mann
und einer Frau erlebt" (FASSEL 1994, S. 169). Die Bewältigung ist
in jedem Fall von der individuellen Persönlichkeit, von der Unterstützung
der Eltern und günstigen Umweltbedingungen abhängig. Für
Kinder ist es deshalb besonders schwer, weil sie in eine Situation hineingedrängt
werden, die sie sich nicht ausgesucht haben und in der sie machtlos sind.
Jedes Kind reagiert anders, das kann man sehr gut beobachten, aber tiefe
Wunden bleiben überall zurück. Leider kommt es in Scheidungsfamilien
meistens zu argen Auseinandersetzungen, wobei auf die Kinder sicher keine
Rücksicht genommen wird. Diese befinden sich dann auf einer Gratwanderung.
Sie wissen nicht, was sie zu wem sagen dürfen, wie sie
sich verhalten sollen, wie es weitergehen soll und vor allem hängen
sie mit ihren eigenen Gefühlen völlig in der Luft. Eine einverständliche
und optimale Regelung zwischen den Partnern, wo besonders auf das Kind
Rücksicht genommen wird, wäre wünschenswert, aber das gibt
es in der Realität selten.
"Überwindung der Scheidung kann es nicht geben. Lebensgeschichte
ist nicht ungeschehen zu machen. Unter guten Umständen kann es dem
Kind aber gelingen, diese Geschichte so zu bewältigen, daß es
sich seine Lebenstüchtigkeit und Glücksfähigkeit erhalten
kann."(Figdor, 1991).
Literaturverzeichnis
Figdor, H. (1991). Kinder aus geschiedenen Ehen: Zwischen Trauma
und Hoffnung. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.
Hofer, M., Klein-Allermann, E. & Noack, P. (1992). Familienbeziehungen.
Eltern und Kinder in der Entwicklung. Göttingen: Hogrefe.
Hörhan, P. (1997). Die Konsequenzen der elterlichen Trennung:
Psychische Spätfolgen für die betroffenen Kinder. Unveröffentlichte
Dissertation, Universität Wien.
Schaffer, H. R. (1992). ... und was geschieht mit den Kindern? Psychologische
Entscheidungshilfen in schwierigen familiären Situationen. Bern:
Huber. (Original erschienen 1990: Making Decisions about Children. Psychological
Questions and Answers)
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
15) Psychologie der Großelternschaft (Barbara
Martl)
Einleitung
Die Mehrheit aller Menschen verbringt etwa 1/3 ihres Lebens als Großeltern.
Dennoch gibt es seitens der Entwicklungspsychologie nur wenige Studien
über die Bedeutung der Großeltern für die Entwicklung ihrer
Enkel. Tatsächlich spielen aber Großeltern eine bedeutende Rolle
hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Familie,
sowie für die Entwicklung der Kinder. Die Bedeutung der Großeltern
ist u. a. abhängig von der jeweiligen Familienstruktur, von sozialen
Gegebenheiten, wie z. B.: Berufstätigkeit der Eltern, Gesundheit,
Einstellung zur Ehe, etc. Diese Faktoren sind allerdings von Kultur zu
Kultur sehr unterschiedlich. Im westlichen Kulturkreis werden ca. 70% aller
Menschen mittleren und höheren Alters Großeltern. Frauen werden
im Durchschnitt mit 50 Jahren zum ersten Mal Großmutter, während
Männer einige Jahre älter sind, wenn sie zum ersten Mal Großvater
werden. Da die meisten Menschen durchschnittlich 25 Jahre lang Großeltern
sind, d.h. etwa 1/3 ihres Lebens, stellt diese Zeit einen wichtigen Lebensabschnitt
dar. Viele erleben ihre Rolle als Großeltern sehr positiv. Im Schnitt
haben sie etwa ein Mal pro Woche Kontakt zu ihren Enkeln, und hegen sehr
zufriedenstellende Beziehungen zu ihnen.
Historisch
Aus diesem Grund erscheint es seltsam, daß diesem Thema von seiten
der Entwicklungspsychologen sehr lange Zeit nur wenig Aufmerksamkeit beigemessen
wurde. So gab es vor 1950 nur ganze fünf Studien die sich mit diesem
Thema befaßten. Erst seit den 70er Jahren, und besonders seit den
80er Jahren hat man begonnen, sich eingehender für dieses Thema zu
interessieren. In früheren Studien wurde die Rolle der Großeltern
eher negativ eingeschätzt. In den jüngeren Studien wird die Bedeutung
der Großeltern nun allerdings in einem positiven Licht gesehen. So
haben Großeltern angeblich große Bedeutung als "unterstützende
Faktoren" in gewissen Situationen. Ein Grund für diese Änderung
liegt darin, daß sich verschiedene Stereotype (z. B. unflexible Großeltern
mit veralteten, zu autoritären Einstellungen etc.), aber auch die
Rolle der Großeltern in der Familie geändert haben. Verschiedene
Studien aus den 50er Jahren zeigen, daß Großmütter im
allgemeinen tatsächlich strenger und autoritärer eingeschätzt
wurden als Mütter. Das kann damit zusammenhängen, daß sich
damals die Meinungen über "richtige Kindererziehung" sehr schnell
änderten. Im Laufe der 70er Jahre nahmen diese starken Differenzen
aber ab. Heute werden Großeltern im allgemeinen als nicht streng,
sondern eher verwöhnend eingeschätzt. In einer Studie von Stevens
(1984), der 101 Paare von Großmüttern und Müttern (®
deren Töchter) untersuchte, zeigte sich, daß Großmütter
im allgemeinen ihre Enkelkinder aufgeschlossener und weniger strafend behandeln
als deren Mütter. In einer anderen Studie (1980) zeigte sich, daß
sich im allgemeinen Großmütter und deren Töchter in ihrem
Erziehungsstil kaum unterscheiden, daß aber Großmütter
doch eher noch großzügiger, und nachsichtiger als ihre Töchter
sind.
Arten der Großelternschaft
Bei der Frage wovon nun die Beziehung zwischen Großeltern und
deren Enkel abhängt, muß man zunächst vier Arten von Großelternschaft
unterscheiden:
-
Großmütter mütterlicherseits
-
Großväter mütterlicherseits
-
Großmütter väterlicherseits
-
Großväter väterlicherseits
Sowohl das Geschlecht der Großeltern, sowie deren Erblinie ist für
die Beziehung zum Enkel von Bedeutung. So ergaben viele Studien, daß
Großmütter mütterlicherseits die engste Beziehung zu ihren
Enkeln (d.h. den Kindern ihrer Töchter) haben, gefolgt von den Großvätern
mütterlicherseits, den Großmüttern väterlicherseits
und schließlich den Großvätern väterlicherseits.
Dies läßt sich u. a. aus evolutionstheoretischer Sicht erklären:
Die natürliche Selektion hat Organismen hervorgebracht, die versuchen,
möglichst viele Kopien ihres genetischen Codes zu produzieren. Auch
wir Menschen sind bestrebt, uns fortzupflanzen, und möglichst viele
Nachkommen zu haben. Aus diesem Grund sind Frauen, wie auch andere weibliche
Säuger, sehr besorgt um das Wohl ihrer Kinder. Männer sind im
allgemeinen "elterlicher" als andere männliche Primaten. Es ist wahrscheinlich,
daß im Laufe der Evolution jene Männer selegiert wurden, die
engen Kontakt zu ihren Kindern hegten. Es gibt aber dennoch evolutionäre
Faktoren, aufgrund derer Männer etwas weniger elterlich sind als Frauen.
Einer dieser Faktoren ist die sogenannte "elterliche Ungewißheit".
Darunter versteht man, daß väterliche Elternschaft nur selten
100%ig sicher ist, da die Möglichkeit besteht, daß ihre Partnerin
von anderen Männern geschwängert wurde. (Der Mensch ist evolutionstheoretisch
gesehen polygam, nicht monogam!) Frauen allerdings haben stets die Gewißheit,
daß ihre Kinder tatsächlich die ihren sind, da sie sie selber
zur Welt bringen, sie säugen, etc. Aus diesem Grund schließen
nun Evolutionspsychologen daraus, daß Frauen elterlicher als Männer
sind. Die Großelternschaft ihrerseits hängt nicht so stark von
derartigen Faktoren ab. Es gibt aber Hinweise dafür, daß Großeltern
sich im allgemeinen mehr um die Kinder ihrer Töchter kümmern,
als um die ihrer Söhne. Wiederum haben sie in diesem Fall eine größere
Gewißheit, daß es sich dabei tatsächlich um ihre eigenen
Nachkommen handelt. Großmütter kümmern sich im allgemeinen
mehr als Großväter um ihre Enkelkinder, da sie wiederum ebenfalls
mehr Gewißheit haben als Großväter, daß es sich
bei dem Kind um ihre tatsächlichen Nachkommen handelt. Die Großmutter
kann sich sicher sein, daß sie die Mutter ihrer Tochter, und diese
wiederum die Mutter ihres Kindes ist. Großmütter väterlicherseits
sowie Großväter mütterlicherseits sorgen sich in etwa im
gleichen Ausmaß um ihre Enkelkinder. Denn bei beiden besteht etwa
eine gleich große Möglichkeit, daß ihr Enkel tatsächlich
gar nicht genetisch mit ihnen verwandt ist. Großväter väterlicherseits
schließlich sorgen sich am wenigsten um ihre Nachkommen, da sie weder
Sicherheit haben, daß sie tatsächlich Vater ihres Sohnes, und
dieser wiederum Vater seines Kindes ist.
Bedeutung der Großeltern für ihre Enkel
Großeltern können ihre Enkel sowohl direkt, wie indirekt
beeinflussen.
-
So ist z. B. die Beziehung zwischen Kind und Eltern u. a. davon abhängig,
wie die Eltern von ihren Eltern erzogen wurden, und welche Erfahrungen
sie in ihrer Kindheit machten. Eine Studie von Huesmann et al. (1984) ergab,
daß das Aggressionsausmaß eines 30jährigen Menschen u.
a. davon abhängt, wie streng er von seinen Eltern im Alter von 8 Jahren
diszipliniert wurde. Von der Aggressivität des 30jährigen wiederum
hängt auch die Aggressivität seines 8jährigen Kindes ab.
Es zeigt sich also, daß die Disziplinärmaßnahmen der Großeltern,
die sie vor 22 Jahren bei ihrem Kind einsetzten, auch Einfluß auf
ihr Enkelkind haben.
-
Einen weiteren indirekten Einfluß üben Großeltern z. B.
dann aus, wenn sie ihre Kinder, die bereits selber Eltern sind, finanziell
oder emotional unterstützen. Es gibt eindeutige Hinweise dafür,
daß die Eltern-Kind-Beziehung stark von Faktoren wie sozialer oder
wirtschaftlicher Unterstützung abhängt.
-
Sehr deutlichen, direkten Einfluß üben Großeltern natürlich
aus, wenn sie versuchen, ihren Enkeln die Eltern zu ersetzen; z. B. bei
Alleinerziehern, bei sehr früher Mutterschaft, wenn beide Eltern berufstätig
sind, etc.
-
Großeltern können für ihre Enkel zu sehr wichtigen Kameraden
werden, und die Kinder v. a. emotional unterstützen; z. B. bei partnerschaftlichen
Problemen der Eltern, etc.
Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln
Allgemein kann man heute sagen, daß die Beziehung zwischen Großeltern
und ihren Enkeln für beide Seiten positiv und wichtig ist. Studien
in Italien zeigten, daß Großelternschaft von den Betroffenen
allgemein als sehr positiv empfunden wird. Man sieht darin sozusagen eine
neue "Lebensaufgabe", bzw. eine neue Form der Mutter- bzw. Vaterschaft.
Die Geburt eines Enkelkindes wird von vielen älteren Menschen als
hoffnungsträchtig und ermutigend empfunden, da ihnen dadurch garantiert
ist, daß ein Teil von ihnen in ihrem Enkel weiterleben wird. Auch
in diesen Studien zeigten sich wiederum Unterschiede zwischen Großvätern
und Großmüttern und deren Beziehung zu ihren Enkeln: Großmütter
mütterlicherseits gaben an, daß sie stets sehr engen Kontakt
zu ihren Töchtern und deren Kindern hatten. Sie empfanden diese Situation
als sehr befriedigend. Großmütter väterlicherseits gaben
an, daß ihre Bindung nicht so eng sei, und begründeten das mit
der Anwesenheit der als Rivalin empfundenen Großmutter mütterlicherseits.
Großväter beiderseits gaben an, daß sie erst viel später
als die Großmütter eine Beziehung zu ihren Enkeln aufgebaut
hätten, und zwar erst etwa ab dem 2. Lebensjahr des Kindes. Zu diesem
Zeitpunkt war für sie die Interaktion mit dem Kind einfacher, und
sie wurden v. a. zum Spielkameraden.
Zusätzlich läßt sich noch sagen, daß die Bedeutung
der Großeltern für ihre Enkelkinder im Laufe ihrer Entwicklung
immer mehr abnimmt. Bis zum Alter von 5 Jahren gelten die Großeltern
für ihre Enkel als relevanter "Elternersatz". Sie werden zudem als
angenehmer, weil weniger streng und geduldiger, empfunden. Ab dem Schulalter
nimmt dann die Bedeutung der Großeltern ab, da das Kind beginnt,
sich mit seiner Außenwelt zu identifizieren.
Während der Pubertät beginnen die Jugendlichen dann allgemein
erwachsene Werte abzulehnen. Das führt konsequenterweise dazu, daß
auch die Großeltern "verachtet" (weil erwachsen) werden. Mit Einstieg
in das Erwachsenenalter wird dann der Lösungsprozeß von der
Familie erneut aktiviert. Das löst z.T. Angst und Unsicherheit aus,
was zu ambivalenten Gefühlen gegenüber den Eltern führt.
Die Großeltern werden nun von den Jugendlichen häufig als
alt und "unfähig" angesehen, ihnen bei ihren täglichen Problemen
zu helfen.
Zusammenfassend
läßt sich also sagen, daß die Beziehung zwischen Großeltern
und Enkelkindern im allgemeinen sehr positiv ist, v. a. eben mit Großmüttern
mütterlicherseits.
Die Beziehung änderst sich allerdings im Laufe der Entwicklung
des Kindes dorthin gehend, daß sowohl Großmütter wie väter
weniger positiv beurteilt werden.
Die Beziehung zu Großeltern mütterlicherseits wird aber allgemein
mit der Zeit enger als die zu Großeltern väterlicherseits, und
hängt v. a. mit Erfahrungen in der frühen Kindheit zusammen.
Kommentar
Der Grund weshalb ich mich für dieses Thema entschieden habe, ist
der, daß ich mich sehr dafür interessierte, einmal etwas aus
wissenschaftlicher Sicht über die Großelternschaft zu erfahren.
Ich persönlich interessiere mich, glaube ich, sehr für dieses
Thema, weil ich selber eine sehr enge und gute Beziehung zu meiner Großmutter
mütterlicherseits hatte. Aufgrund eines "Falles" in meinem Bekanntenkreis,
sehe ich aber auch, daß der Einfluß von Großeltern leider
nicht immer positiv für ein Kind sein muß, selbst wenn die Großeltern
alles nur Erdenkliche tun, damit es ihrem Enkel gut geht.
Als persönliche Stellungnahme möchte ich sagen, daß
ich mich z.T. mit den Aussagen des
Buches sehr wohl, mit anderen allerdings nicht identifizieren kann.
So gelten z. B. auch für mich meine Großeltern als Bezug
zur Vergangenheit. Es ist sehr interessant, mit ihnen über "früher"
zu sprechen, ihre Sicht der damaligen Situation (z. B. während des
Krieges, ...) zu überdenken, etc. Auch fand ich es jedesmal sehr "spannend",
wenn mir meine Großmutter von irgend welchen Verwandten und Bekannten,
die schon seit Jahrzehnten tot waren, erzählte. Was ich auch noch
aus persönlicher Erfahrung bestätigen kann, ist die Tatsache,
daß zumindest ich persönlich den engsten Kontakt zu meiner Großmutter
mütterlicherseits, die leider bereits verstorben ist, hegte.
Sehr interessant war es hier für mich die evolutionstheoretische
Erklärung, welche im Buch auf sehr anschauliche Weise angeführt
ist, zu lesen. In meinem Fall mag das allerdings auch damit zusammenhängen,
daß meine Großmutter während ihrer letzten Lebensjahre
aus gesundheitlichen Gründen bei uns zu Hause gelebt hat, und ich
aufgrund ihrer Krankheit und ihres Leidens eine sehr enge emotionale Beziehung
zu ihr aufgebaut habe.
Ergänzend muß ich allerdings sagen, daß meine Großmutter
väterlicherseits im Krankheitsfalle sicherlich von ihrer eigenen Tochter,
d.h. nicht von meiner Mutter, gepflegt werden würde.
Worüber ich auch mit dem Buch übereinstimme, ist die Annahme,
daß heutzutage Großeltern eher dazu neigen, ihre Enkelkinder
zu verwöhnen.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob und wie gut dieser Einfluß
für das Kind ist. V. a. wenn durch diese verwöhnende Art der
Großeltern für das Kind eine ambivalente Erziehungssituation
zwischen strengen Eltern und sehr milden Großeltern entsteht, könnte
sich das eher negativ auf das psychische Gleichgewicht des Kindes auswirken.
Dies gilt v. a. dann, wenn das Kind sehr viel Zeit mit seinen Großeltern
verbringt.
Eine Aussage des Buches, mit der ich mich persönlich allerdings
nicht identifizieren kann, ist jene, die besagt, daß Großeltern
während der Pubertät ihres Enkelkindes zu dessen "Rivalen" werden.
Im Gegenteil glaube ich, daß gerade in dieser für Jugendliche
und Eltern doch eher "schwierigen" Zeit gerade Großeltern eine sehr
große Stütze, sowohl für den pubertierenden Jugendlichen,
als auch für dessen Eltern, darstellen können.
Einerseits sind sie für den Jugendlichen, der sich von seinen Eltern
unverstanden und ungerecht behandelt fühlt, ein möglicher Zufluchtsort,
wo man u. a. Trost und Verständnis finden kann. Den Eltern wiederum
können sie Ratschläge erteilen, wie sie in dieser Zeit am besten
mit ihrem Kind umgehen, wie sie auf verschiedene Situationen reagieren
sollen, etc. Schließlich haben die Großeltern bereits mit ihren
eigenen Kindern einige Erfahrungen sammeln können. Hier könnte
natürlich eingewendet werden, daß die Großeltern nicht
mehr genügend Einblick in die heutigen Gegebenheiten haben, und somit
ihre Ratschläge nicht zielführend sein können. Ob und inwiefern
Großeltern den "modernen" Gegebenheiten angepaßt sind, wird
natürlich individuell verschieden sein. Allerdings sollte man nicht
vergessen, daß, wie auch in dem Buch erwähnt wird, Großeltern
heute nicht mehr "uralt" sein müssen. Und von einem ca. 55Jährigen
ist meiner Meinung nach sehr wohl noch ein gewisses Maß an "Modernheit"
zu erwarten.
Literaturverzeichnis
Smith, P. K. (1991). The Psychology of Granfparenthood. London:
Routledge.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
16) Beziehungen zwischen den Generationen (Barbara
Izay)
Einleitung
Der Begriff "Generation" wird in vieldeutiger Weise gebraucht: Unter
einer Generation kann eine zeitliche Abfolge von Menschen bezeichnet werden.
Gesellschafts- und sozialpolitisch gesehen erscheinen Generationen als
soziale Kategorie, die aufgrund der Gleichzeitigkeit des Aufwachsens oder
gemeinsam erfahrener gesellschaftlicher Ereignisse soziale Gemeinsamkeiten
aufweisen. Am häufigsten ist jedoch das anthropologische Konzept der
Generationen, das sich auf die zeitliche Abfolge von Familienangehörigen
bezieht (d.h. Enkelkinder-Kinder-Eltern-Großeltern).
Der Teil 1 dieser Seminararbeit beschäftigt sich mit Generationenbeziehungen
und -verhältnissen. Im zweiten Teil gehe ich auf die verschiedenen
Konfliktfelder zwischen den Generationen ein. Die Verantwortung der Generationen
zueinander aus rechtlicher Sicht wird im dritten Teil erläutert. Im
Teil 4 möchte ich kurz den Generationenvertrag beschreiben. Teil 5
und 6 handeln von dem kulturellen und emotionalen Transfer zwischen den
Generationen.
Teil 1: Generationenbeziehungen - Generationenverhältnisse
Die Bezeichnung Generationenbeziehungen beschränkt sich auf die
beobachtbaren Folgen sozialer Interaktionen zwischen Angehörigen verschiedener,
in der Regel familial definierter Generationen. Die Generationenverhältnisse
bezeichnet dagegen die für die Beteiligten nicht unmittelbar erfahrbaren,
im wesentlichen durch Institutionen des Sozialstaats vermittelten Zusammenhänge
zwischen den Lebenslagen und gemeinsamen Schicksalen unterschiedlicher
Altersklassen oder Kohorten. In modernen Gesellschaften sind familialverwandtschaftliche
Generationenbeziehungen und sozialpolitisch strukturierte Generationenverhältnisse
wechselseitig verknüpft. So bewirkt der Ausbau sozialstaatlicher Altersversorge
(ein sozialpolit. Generationenverhältnis) eine Entlastung familialer
Generationenbeziehungen (sozial und emotional) und dient einem Absinken
des familialen Generationskonfliktes. Anstelle der Betrachtung von Generationen
als soziale Gruppierungen werden seit den letzten Jahrzehnten in der Diskussion
der Generationen, Generationenbeziehungen und Generationenverhältnisse
als zentrale Aspekte der gesellschaftlichen Regelung von Zeitlichkeit konzipiert
(im Sinne von vorher/nachher, jünger/älter, ...). Das Generationenproblem
wird nun als Problem der kulturellen Regelung von Zeitlichkeit gesehen
(Fragen der lebenszeitlichen Asymmetrien von jünger/älter, früher/später;).
Eine wichtige Quelle für intergenerative Spannungen liegt in der fehlenden
Übereinstimmung der Lebenserfahrungen.
Es gibt 3 Modellvorstellungen bezüglich Generationenbeziehungen
und -verhältnissen.
Modell A: Negative Interdependenz (Generationenkonflikt)
Das Verhältnis zwischen verschiedenen Generationen ist durch einen
Interessenskonflikt charakterisiert, der mehr oder weniger ausgeprägt
ist. Jede Generation hat ihre eigenen Interessen, die mit den Interessen
anderer Generationen unvereinbar sind. Es handelt sich um ein sogenanntes
Nullsummenspiel, da jeder Gewinn für die Generation A ein Verlust
für B ist.
Modell B: Positive Interdependenz (Generationensolidarität)
Hier besteht die Annahme, daß alles was einer Generation zugute
kommt auch für die jeweiligen anderen Generationen positive Folgen
hat. Interessen älterer und jüngerer, nachkommender Generationen
sind nicht unvereinbar, sondern positiv verknüpft.
Modell C: Unabhängigkeit/Independenz (Koexistenz der Generationen)
Es wird angenommen, daß verschiedene Generationen relativ unabhängig
voneinander koexistieren. Jede Generation hat eigenen Interessen, welche
wechselseitig mehr oder weniger unabhängig sind.
Teil 2: Generationskonflikte
Eine Generation ist für viele Menschen - empirischen Untersuchungen
zufolge - eine Personengruppe, die circa in einem 7-8 Jahresintervall (älter
oder jünger) um das eigene Alter liegen. Dieser Generationenintervall
wurde mit der Zeit kleiner. Ursachen liegen möglicherweise in der
schnellen Veränderungsrate unserer Zeit (schneller Wechsel von Moden
- Kleidung, Musik, Sportarten ...). Es bestehen intergenerativ unterschiedliche
Grundauffassungen bezüglich politischer, basaler Werthaltungen: diese
müssen jedoch nicht automatisch zu Konflikten führen (im innerfamilären
Bereich werden sie kaum angesprochen, in der öffentlichen Diskussion
führen unterschiedliche Werthaltungen jedoch zu entsprechenden Differenzen).
Untersuchungen zeigten jedoch, daß die Differenzen zwischen Älteren
und Jüngeren nicht wirklich drastisch sind.
Konfliktfelder, die für den Alltag mehr oder weniger charakteristisch
sind: Konkrete Konflikte setzen konkrete Kontakte voraus - abgesehen
von Kontakten im Familienverband sind diese relativ gering: ca. die Hälfte
der Bevölkerung hat kaum Kontakt mit viel jüngeren Personen;
ca. 2/3 der Bevölkerung haben kaum Kontakt mit deutlich älteren
Personen. Es zeigt sich also, daß die Kontakte, abgesehen vom Familienverband,
hauptsächlich innerhalb der eigenen Alterskohorte gefunden werden
und kaum Berührungspunkte mit Angehörigen anderer Generationen
gesucht werden, zumindest nicht regelmäßig. Das reduziert die
Chancen für Verständnis, aber auch die Chancen für die Entwicklung
von Konflikten.
1. Konflikte innerhalb der Familie: Die intergenerativen Kontakte
sind hier sehr häufig (wo Kontakt ist, steigt auch die Konfliktmöglichkeit).
In der Familie gibt es einerseits Konflikte, andererseits wechselseitige
Hilfe. Ein von vielen Menschen angestrebtes Ideal (unabhängig von
der Generation) ist ein "harmonisches Familienleben" (möglicherweise
gehört der intergenerative Konflikt bis zu einem bestimmten Grad zur
angestrebten emotionalen Atmosphäre einer Familie). Konflikte in der
Familie werden besonders häufig von den relativ jungen Eltern (20-40jährige)
wahrgenommen. Häufig erfahren diese konfliktfähige Berührungen
mit ihrer Kindergeneration, Elterngeneration und möglicherweise der
Großelterngeneration. Die Ältesten der Gesellschaft nennen familiäre
Konflikte verhältnismäßig selten. Einerseits, da sie tatsächlich
nicht mehr involviert sind, andererseits wollen sie den Kindern nicht auf
die Nerven gehen bzw. zur Last fallen. Die wechselseitige Hilfe, häufig
durch Betreuung der Enkel/Urenkel, Mithilfe im Haushalt, regelmäßige
finanzielle Unterstützung, ist oft ein Auslöser für Konflikte.
2. Konflikte in der Berufswelt: Angehörige aller Altersstufen
berichten von Konflikten mit älteren bzw. jüngeren Personen in
der Arbeitswelt. Die Arten der Konflikte konnten in bisherigen Untersuchungen
jedoch nicht ergründet werden. Konflikte werden nämlich seltener
als Generationenkonflikte wahrgenommen und gedeutet - sondern eher als
Konkurrenz um Führungspositionen verstanden (z. B. jüngere Personen,
die sich durchaus schon qualifiziert fühlen, sehen ihre Plätze
durch Ältere besetzt und damit den eigenen Aufstieg behindert).
3. Konflikte im öffentlichen Bereich (anonym): Intergenerative
Konflikte werden hier in der österreichischen Bevölkerung selten
gesehen (Straßenverkehr, Einkaufen...). Jedoch treten in diesem Bereich
Konflikte eher im großstädtischen Bereich auf (z. B. Wien).
In einer Untersuchung aus Bamberg (1990) wurden drei Generationen bezüglich
der Frage in welchen Bereichen sie am ehesten Konflikte zwischen den Generationen
sehen, befragt (jeweils aus der Sicht der Generation). Erstens zeigte sich,
daß es keine hundertprozentige Übereinstimmung in den Konfliktfeldern
gibt: die Generationen erleben unterschiedliche Konfliktfelder, zweitens
kennt die Großelterngeneration kaum die Meinungen der Enkel. Aus
der Sicht der Kinder liegen Meinungsunterschiede vor allem im Bereich der
Freizeitgestaltung, Gesellschaft und Politik, Ordnung und Geldverwendung;
weniger in bezug auf Kleidung. Aus der Sicht der Eltern ist ein Hauptproblem
die Ordnung, danach Kleidung und Geldverwendung; nicht aber Gesellschaft
und Politik. Meinungsunterschiede zwischen Eltern und Großeltern
werden von Elternseite in den Themenbereichen Religion, Ordnung und Freizeit
geäußert; von Großelternseite zu Politik und Kleidung.
Teil 3: Verantwortung zwischen den Generationen aus
rechtlicher Sicht
Im Bereich der Verantwortlichkeit zwischen den Generationen ist gut
zu beobachten, daß das Recht permanenten Veränderungen unterworfen
ist. Heute wird die Verantwortung, die früher allein durch die Familie
getragen wurde, zum Teil vom Staat übernommen.
Gegenseitige Verantwortung umfaßt einerseits finanzielle Aspekte
(Unterhalt, Aussteuer) aber auch persönliche Aspekte (Pflege, Erziehung,
gegenseitiges "sich kümmern und sich sorgen").
1. Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern
Heute sind beide Elternteile verpflichtet ihrem Kind sowohl Unterhalt zu
gewähren, als auch es zu pflegen und zu erziehen (früher: z.
B. im letzten Jahrhundert wurde die finanzielle Verantwortung für
den
Unterhalt der [ehelichen] Kinder dem Vater übertragen, die Pflege
und Erziehung der Mutter). Eine Aufteilung der Pflichten nach dem Geschlecht
findet nicht mehr statt. Verpflichtung der Pflege und Erziehung, sowie
die gesetzliche Vertretung und Vermögensverwaltung (Obsorge der Eltern)
endet mit der Volljährigkeit des Kindes, die Unterhaltspflicht mit
der Selbsterhaltungsfähigkeit. Die öffentliche Hand - der Staat,
die Länder und die Gemeinden - unterstützt sie dabei auf drei
verschiedenen Ebenen: Unterstützung für alle (z. B. Obsorge:
öffentlich geförderte Kindergärten; Unterhalt: Familienbeihilfe);
Unterstützung bei Bedarf (z. B.: Obsorge: Mutter-Kind-Beratung, Erziehungsberatung;
Unterhalt: Stipendium); staatlicher Eingriff bei Gefährdung der Obsorge
bezw. des Unterhalts (z. B.: Obsorge: Fremdunterbringung des Kindes im
Heim/Pflegefamilie; Unterhalt: Kontrolle der Höhe des Unterhaltes
bei Scheidung).
2. Verantwortung der Kinder gegenüber ihren Eltern (Großeltern)
Die (erwachsenen) Kinder sind gesetzlich verpflichtet auch ihren Eltern
(und Großeltern) Unterhalt zu gewähren, wenn diese sich nicht
selbst erhalten können. Nur wenn die Eltern gegenüber den Kindern
die Unterhaltspflicht verletzt haben, erlischt die Verpflichtung der Kinder,
die Eltern zu unterstützen. Die gegenseitige Unterhaltspflicht des
Eltern-Paares hat dabei Vorrang. Es gibt einerseits die Absicherung der
Berufstätigkeit (durch unser derzeitiges Sozialversicherungssystem
weitgehend gegeben), andererseits die Unterstützung bei Bedarf (Sozialhilfe).
Teil 4: Der Generationenvertrag
Der Generationenvertrag ist ein Lösungsversuch für das Problem,
daß Gesellschaften darauf angewiesen sind, zur Sicherung ihres eigenen
Fortbestands auch die Frage des Älterwerdens in ihnen zu lösen.
Der wohlfahrtsstaatlich gedachte Generationenvertrag (öffentliche
Sphäre) und die familialen Verhältnisse (private Sphäre)
stellen verschiedene Ausdrucksformen im Generationenverhältnis dar:
öffentliche Seite des Generationenvertrages: Die Pensionsversicherung
schließt einen gewissermaßen künstlichen Vertrag zwischen
der Generation, die im Erwerbsleben steht, und jener, die aus diesem bereits
entlassen wurde. Vertragsinhalt ist die Zuweisung eines angemessenen Anteils
vom Arbeitseinkommen der Erwerbstätigen an die "ältere Generation",
der dort die Funktion des "Einkommensersatzes" hat.
Elemente der privaten Seite: Zur intergenerativen Solidarität
wird international mindestens zwischen 3 Niveaus gegenseitiger Unterstützung
unterschieden:
1. Niveau und Ausmaß der materiellen Unterstützung,
die erwachsene Kinder ihren Eltern zukommen lassen. Mehr als 70% der über
65jährigen erhalten Hilfe von Familienmitgliedern (hauptsächlich
sind Gattinnen, Töchter und Schwiegertöchter die wichtigsten
Träger von Hilfeleistungen, Zuwendung, sowie emotionaler und psychischer
Stützung).
2. Art der Leistung, die beide Generationen wechselseitig erbringen.
Die in Tauschbeziehungen investierten Güter betreffen meist Zeit und
Geld. Die Älteren verfügen über mehr Zeit und akkumuliertes
Vermögen, jedoch nur im geringeren Maß über aktuelles Einkommen.
Im Vergleich dazu sind bei den Jüngeren/Kindern die Zeitreserven kleiner
(Erwerbstätigkeit und Kindererziehung), jedoch verfügen sie über
ein besseres aktuelles Einkommen. Die erwachsenen Kinder tendieren dazu,
die alten Eltern im Krankheitsfall durch Pflege, weniger durch Geldleistungen
zu unterstützen; über 1/3 der Älteren unterstützt die
Kinder nachhaltig in materiellen Dingen (vor allem bei der Wohnraumbeschaffung).
3. Einfluß dieser Aktivität auf die Zufriedenheit der
Älteren: Der wechselseitige Austausch scheint wichtiger als einseitiges
Geben oder Empfangen. Familiale Solidarität trägt weniger zu
Zufriedenheit und Wohlbefinden bei als vielmehr zur Verhinderung von Einsamkeitsgefühlen.
Teil 5: Kultureller Transfer zwischen den Generationen
Kontakte zwischen den 3 Generationen: Großeltern, Eltern und Kinder
kommen vor. Kontakte zwischen Eltern und Kindgeneration sind meist dicht,
vielleicht in einzelnen Phasen dichter zur Mutter als zum Vater, dichter
zum biologischen Elternteil als zu den Stiefeltern, und zu den Großeltern
weniger. Die Qualität der jeweiligen Kontakte ist jedoch unklar.
Welche Muster zwischen den Generationen übertragen werden, sind
nur vereinzelt erhaltbar. Am häufigsten liegt die Konzentration (der
Studien) auf den Eltern-Kind-Beziehungen oder man geht den Inhalten der
Beziehungen nach. So ergab sich in einigen Studien, daß die Einstellungsunterschiede
zwischen den benachbarten Generationen sehr gering sind. In der Regel lassen
sich auch die Einstellungen der Kinder aus den Einstellungen der Eltern
verhersagen. Durch Schulbildung und Beruf können die Einstellungen
und Werthaltungen des Elternhauses zwar modifiziert werden, doch findet
meist kein deutlicher Bruch statt (Glassen, Bengston & Chorm, 1986).
Es wurde auch gezeigt, daß der Einfluß der Kindereinstellungen
in der jungen Erwachsenenzeit auf die Eltern besonders hoch ist. Die Familie
wirkt zwar einerseits stabilisierend auf Grundhaltungen (in politischen
und religiösen Werten
ist der Einfluß der Elterneinstellungen höher als bei den
Geschlechtsrollenvorstellungen), andererseits stellt sie auch einen Rahmen
dar, in dem Kinder auf ihre Eltern Einfluß nehmen und dadurch Wertmodifikationen
in der Erwachsenenwelt bewirken können. Es ist zu sagen, daß
intensive Kontakte und gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Familie
die kulturelle wechselseitige Beeinflussung verstärken. Die Frage,
wie Kultur im Sozialisierungsprozeß zwischen den Generationen transferiert
wird, bedarf einer tiefergehenden mikroskopischen Betrachtung. Zahlreiche
Möglichkeiten liegen vor allem in Vergleichen im verbalen Bereich
(Wortwahl) und im nonverbalen Bereich (Bereich der symbolischen Präsentation
von Einstellungen im Alltag; z. B. Wohnungseinrichtung, Kleidung, körperliche
Bewegungsmuster, ...).
Teil 6: Emotionaler Transfer zwischen den Generationen
Der unmittelbare emotionale Transfer, die Erfahrungswerte, die ein Kind
durch primär kindliche Objektbeziehungen (Mutter-Kind-Beziehung) in
der frühen Kindheit vermittelt bekommt, standen lange Zeit in der
Mitte der Analyse von Persönlichkeitsmerkmalen sowie Störungsbildern
des psychischen Erlebens. Weniger betrachtet wurde der Beziehungsaspekt
aus der Mehrgenerationenperspektive. Es gibt Grundstrukturen eines Familiensystems,
die konkrete Handlungsweisen oder Riten als familiäre Traditionen
mehrerer Generationen erkennen lassen (z. B. Opferangebote, Betonen der
Familienehre, Rachegefühle zwischen Familien) alle Familienmitglieder
eines familiären Systems sind bestimmten Riten unterworfen. So ergeben
sich dann Codes, um die jeweiligen Verdienste, Guthaben, Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten im generativen System gegeneinander werten zu
können. Unsichtbare Bindungen und Loyalitätsverpflichtungen summieren
sich. Je stärker ein Kind mit Loyalitätsverpflichtungen an die
Eltern gefesselt ist, um so schwerer wird es für den Heranwachsenden,
die alten Bande durch das Eingehen einer neuen Bindung zu ersetzen. Oft
entdeckt der Erwachsene erst dann, wenn er selbst Vater oder Mutter geworden
ist, seinen Groll über die seinerzeit erlittene Verlassenheit, Ungerechtigkeit
oder den Erwartungsdruck, usw. Symptome bei einem Kind sind daher zugleich
auch repräsentativ für versteckte und ungelöste Konflikte
zwischen mehreren Generationen derselben Familie oder zwischen beiden Herkunftsfamilien.
Ein Beispiel für emotionalen Transfer ist die Gewalt in der Familie.
In einer Analyse von 400 Mutter-Vater-Paaren (Wimmer-Puchinger et al.,
1991) über Gewalt in der Familie konnte festgestellt werden, daß
unter allen gewalthaften Eltern, Vätern wie Müttern, eine Kontinuität
von 40% bestand. Es konnte also gezeigt werden, daß gewalthaft erlebte
Erziehung weitergegeben wird. Insgesamt hatten 80% der Eltern als Kinder
Ohrfeigen am eigenen Leib verspürt. Das bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit,
daß Eltern, die gewalthaft auf ihre Kinder reagieren, selbst Gewalt
von ihren Eltern erleben mußten, sehr groß ist. Das heißt
jedoch nicht, daß jedes geschlagene Kind selbst diesen Mechanismus
weitergeben muß. Umstiegs- und Veränderungspotentiale sind gegeben.
Bei dieser Analyse waren sie eher bei Frauen als bei Männern gegeben
und korrelierten hoch mit Selbstreflexion, Einbekenntnis der Wut, Scham,
Kränkung und Verletzung sowie Abgrenzung und Auseinandersetzung mit
den eigenen Eltern. (Der Aspekt wurde bis jetzt über längere
Generationen hinweg nicht untersucht.)
Persönliche Stellungnahme
Dort, wo Menschen aufeinandertreffen, sei es im Beruf, in der Familie,
..., kommt es zu Interaktionen zwischen den verschiedenen Generationen.
Diese Interaktionen können sich im Austausch von Ressourcen wiederspiegeln,
aber auch in Konflikten. Bei den häufig bestehenden Unterschieden
zwischen den Generationen finde ich ist vor allem Toleranz und Akzeptanz
wichtig.
Ich mache derzeit mein Psychologiepraktikum in einem geriatrischen Tageszentrum.
Dort bin ich mit dem Generationsunterschied direkt konfrontiert. Soweit
hatte ich damit keine Probleme. Natürlich werden die Unterschiede
oft deutlich, doch sobald mir bewußt wird, daß die Menschen,
mit denen ich arbeite, aus einer "anderen Zeit", aus einer anderen Geschichte
und Tradition kommen, kann ich die Unstimmigkeiten verstehen und mit ihnen
umgehen.
Literaturverzeichnis
Badelt, C. (Hrsg.). (1997). Beziehungen zwischen Generationen -
Ergebnisse der wissenschaftlichen Tagung der ÖGIF im November 1995
in Linz, Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung,
Nr. 4.
[Alle anderen in dieser Seminararbeit zitierten Studien und Personen wurden
ebenfalls aus der oben genannten Literatur genommen.]
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
17) Familie und Arbeitswelt (Barbara
Reithofer)
Einleitung
In der folgenden Abhandlung wird die Wechselbeziehung zwischen Familien-
und Arbeitswelt näher beschrieben. Vor allem für Kinder erwerbstätiger
Eltern hat die elterliche Berufsarbeit Auswirkungen. Weiters werden Probleme
und dazugehörige Lösungsansätze welche bei der Vereinbarkeit
von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit auftreten können, diskutiert.
Die Wechselbeziehungen zwischen Beruf und Familie
Beruf und Familie stellen die zentralen Lebensbereiche des Erwachsenen
dar. In den westlichen industriellen Gesellschaften ist das Verhältnis
dieser beiden Bereiche durch räumliche Trennung sowie durch unterschiedliche
gesellschaftliche Funktionen gekennzeichnet.
Der Beruf ist auf fremden Bedarf ausgerichtet und dient zur Sicherung
des Lebensunterhaltes. Dagegen ist Hausarbeit keine Leistung für Geld,
sondern für die unmittelbaren, emotionalen Bedürfnisse von Personen,
die vertraut und einander nahestehend sind. Einen weiteren Gegensatz stellt
die Tatsache dar, daß im Beruf Freizeit institutionalisiert ist,
während bei der Hausarbeit keine klar abgegrenzte Freizeit vorhanden
ist. Diese Gegenüberstellung zeigt auf, wie Berufs- und Hausarbeit
einander entgegensetzen, sich dabei aber gegenseitig bedingen und bestimmen.
Eine Familie ist von der Berufswelt ökonomisch abhängig, d.
h. sie ist auf das Erwerbseinkommen eines oder mehrerer Familienmitglieder
angewiesen. Durch Arbeitslosigkeit, unzureichendes Erwerbseinkommen sowie
Arbeitsplatzunsicherheit wird die ökonomische Lage der Familie unmittelbar
beeinflußt. Direkt und indirekt gestaltet die Erwerbsarbeit das Familienleben
mit.
Die in der Familie erbrachte Arbeit hat andererseits für die Berufswelt
eine große Bedeutung, da die Familie zentrale Sozialisationsaufgaben
übernimmt und für die Berufsarbeit wichtige Normen und Werte
vermittelt. Weiters wird die Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Erwerbsarbeit
von familialen Faktoren eingeschränkt.
Da sich die familialen Leistungen auf die Berufswelt längerfristig
auswirken als die ökonomische Abhängigkeit der Familie von der
Berufswelt, ergibt sich eine scheinbare Asymmetrie. Dies hat zur Folge,
daß sich zumeist die Familien an die sich verändernden Arbeits-
und Berufsbedingungen anpassen und nicht umgekehrt.
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit eine
Aufgabe der Frauen ?
In der Praxis stellt sich für Frauen (obwohl in den letzten Jahrzehnten
ein Wandel der Geschlechterrollen stattgefunden hat) wesentlich öfter
die Frage nach der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit. Zwar ist
allgemein die Einstellung zur familiären Arbeitsteilung partnerschaftlicher
geworden, und immer mehr Frauen integrieren sich in den Arbeitsmarkt, doch
führt der Übergang zur Elternschaft meist zur Rückkehr zur
traditionellen Aufgabenteilung innerhalb der Familie. Nicht zuletzt deswegen,
da Väter erst seit 1990 die Möglichkeit haben Karenz- oder Erziehungsurlaub
in Anspruch zu nehmen.
Bis in die siebziger Jahre hat nur eine Minderheit der Mütter von
Volkschulkindern gearbeitet. Die generell negative Einstellung der Öffentlichkeit
gegenüber berufstätigen Müttern führte zu enormen Schuldgefühlen
der Frauen. Jahrelang herrschte in der allgemeinen Presse eine mißbilligende
Haltung gegenüber mütterlicher Erwerbstätigkeit. Vernachlässigung
der Kinder, Vernachlässigung des Ehemannes und Vernachlässigung
des Haushaltes waren die Hauptvorwürfe. Die Individualität der
Mütter wurde dabei außer acht gelassen.
Heute wird die Aufopferung für die Vollzeit- Kindererziehung (die
einmal erwartet und anerkannt wurde) weniger respektiert, was die Bezeichnung
der "Nur- Hausfrau" verdeutlicht. Die eigene berufliche Identität
und das eigene Geld haben der Frau eine höhere Stellung innerhalb
der sozialen Struktur ermöglicht. Andererseits wird sie aber für
das persönliche Wohlbefinden ihrer Kinder verantwortlich gemacht.
Die Mutterrolle dürfte durch diese intensiven beruflichen und familialen
Verpflichtungen belastet sein wie nie zuvor.
Im Gegensatz zu den meisten Männern weisen die Berufsverläufe
der Frauen keine kontinuierliche Normalbiographie auf. Um Beruf und Familie
zu vereinbaren, erbringen sie die vielfältigsten beruflichen und/oder
familialen Anpassungsleistungen. Weibliche Erwerbsverläufe sind von
einer hohen Variationsbreite gekennzeichnet, die Ausdruck des Bemühens
sind, Erwerbs- und Familienarbeit zu vereinbaren. Als Gründe für
Unterbrechung oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit werden von den Frauen
an erster Stelle Kinder angegeben.
Die Entscheidung der Mutter für oder gegen Erwerbstätigkeit
wird von der Anzahl und dem Alter der Kinder, aber auch von der Tatsache
beeinflußt, ob sie mit einem Partner zusammenlebt oder nicht. Bei
Müttern in Einelternfamilien ist die Erwerbstätigkeit schon alleine
aus finanziellen Gründen meist unumgänglich.
Doch auch das Bildungsniveau nimmt auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen
Einfluß. Unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, sind
Frauen mit höherer Schulbildung öfter erwerbstätig. Allgemein
sind jedoch Frauen mit Kindern seltener berufstätig als Frauen ohne
Kinder.
Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die
Kinder
Seit Jahrzehnten wird die Auswirkung der Erwerbstätigkeit der Mutter
thematisiert. Lange wurden Forschungsarbeiten zu diesem Thema unter negativem
Aspekt durchgeführt. Wenige Forscher fragten, welche Nutzen Töchter
und Söhne von einem höheren Familieneinkommen, einem höheren
Selbstbewußtsein der Mutter, einer weniger scharfen Rollentrennung
zwischen Mutter und Vater etc., für ihr späteres Leben haben.
Auch Männer scheinen die alte Rollenverteilung (der Mann ist für
Politik, Wirtschaft und Geld zuständig; die Frau für Familie
und Kinder) zunehmend als Einschränkung ihrer Entwicklung zu empfinden.
Vor allem in der Kinderbetreuung gewinnen partnerschaftlichere Formen der
Aufgabenteilung an Bedeutung. Männer beschäftigen sich deutlich
mehr mit ihren Kindern als die Väter der späten sechziger Generation,
im Haushalt arbeiten sie jedoch nicht wesentlich mehr als damals.
Neuere Studien zeigen, daß die entsprechenden Rahmenbedingungen
und nicht die Erwerbstätigkeit an sich mitbestimmen, in welchem Ausmaß
sich positive oder negative Entwicklungsanreize für das Kind ergeben.
Zu diesen Rahmenbedingungen zählen unter anderem die Einstellung der
Eltern bzw. der Kinder zur Erwerbstätigkeit, die Gestaltung der erwerbsfreien
Zeit in der Familie etc.
Ein Forschungsprojekt von Lois Hoffmann (1983) ergab, daß Töchter
berufstätiger Mütter selbstsicherer waren, höhere Schulabschlüsse
aufwiesen und mit höherer Wahrscheinlichkeit eine eigene Berufslaufbahn
einschlugen. Er resümierte, daß Töchter in vielen Dingen
tatsächlich davon profitieren, daß sie das " Modell einer kompetenten
Frau" in der Familie haben. Söhne dagegen hatten diesen Vorteil nicht,
da sie bereits das Modell eines berufstätigen Vaters hatten, egal
ob die Mutter arbeitete oder nicht.
Gemeinsame Zeit in der Familie
Allgemein wird angenommen, daß Mütter zu Hause viel Zeit
damit verbringen, ihre Kinder geistig zu fördern. In einer Studie
bezüglich Zeiteinteilung fanden Hoffmann und Ziegel heraus, daß
Mütter die zu Hause sind, die meiste Zeit mit dem Haushalt beschäftigt
sind. Die Untersuchung ergab weiters, daß berufstätige Frauen
genauso viel Zeit in direkter Interaktion mit ihrem Kind verbringen wie
nicht erwerbstätige Frauen.
Männer berufstätiger Frauen und mit Vorschulkindern verbringen
täglich nur zwanzig Minuten mehr im Haushalt als Ehemänner, deren
Frauen ganztags zu Hause sind (Cowan, 1983). Berufstätige Mütter
arbeiten dagegen durchschnittlich fünfunddreißig Stunden in
der Woche im Haushalt.
In einer Gesellschaft, die durch das Vorherrschen einer rationellen
Zeitorganisation gekennzeichnet ist, ist Zeit in der Familie zum Miteinander
zu finden, vielfach zum Problem geworden. Die Tatsache, daß die Bedürfnisse
von Kindern nicht planbar sind, stellt an die Eltern die Anforderung, ihre
Zeit flexibel zu handhaben. Sie müssen die Wünsche und Bedürfnisse
ihrer Kinder erkennen und sich auf ihr Tempo einlassen. Dies ist durch
die durchgeplante Zeitstruktur des Arbeitsbereiches aber nur sehr beschränkt
möglich. Berufsarbeit ist nach dem Prinzip der Zeit- und Kostenökonomie
organisiert, während Zeit im Rahmen der Familienarbeit naturgebunden
ist.
Vor allem die zeitliche Lage der Erwerbsarbeitszeit ist für den
Einfluß auf das Familienleben ausschlaggebend. Nacht-, Turnus- und
Schichtarbeit sowie selbständige Erwerbsätikeit wirken in die
Organisation des Familienalltages hinein.
Eine österreichische Studie 10-jähriger Kinder, welche von
Wilk und Bacher, 1994 durchgeführt, wurde ergab, daß Mütter,
auch wenn sie vollerwerbstätig sind, ihren Kindern in einem höheren
Ausmaß vermitteln, daß sie auch unter der Woche Zeit für
sie haben, als dies ihre Väter tun. Jedes dritte Kind hat demnach
den Eindruck, daß sein Vater ihm auch wochentags zur Verfügung
steht.
Familienleben und Berufsanforderungen
Berufliche Überlastung, Streß aber auch berufliche Zufriedenheit
fließen in den familialen Alltag ein. Die Berufstätigkeit kann
sich aber auch positiv auf die psychische Verfassung auswirken, was natürlich
auch die Familie positiv beeinflußt. Einer Studie zufolge sind erwerbstätige
Mütter anpassungsfähiger, glücklicher und sie neigen weniger
zu Depressionen als Vollzeit- Mütter.
Umgekehrt tangieren Zufriedenheit in der Familie, aber auch familiale
Konflikte die berufliche Leistung. Vor allem bei Paaren, die Familie und
Beruf gleichermaßen hoch bewerten (sogenannte "dual-career" Familien),
ist die Gefahr von Doppelbelastungen sehr groß. Oft entscheiden sich
Paare aus beruflichen Gründen für eine gewisse Zeit an getrennten
Wohnorten zu leben, und eine "Wochenend- Ehe" zu führen, da die beruflichen
Anforderungen auch geographische Mobilität erfordern. Weiters verfügen
diese Familien aus Zeitknappheit vielfach nur über wenige außerfamiliale
Sozialkontakte. Vorliegende Studien zeigen weiters, daß die Aufteilung
der Haus- und Familienarbeit in "dual-career" Familien partnerschaftlicher
ist, die geschlechtsspezifische Zuordnung von Familien- und Hausarbeit
aber nicht aufgehoben ist.
Probleme, welche bei der Vereinbarkeit von Familienarbeit
und Erwerbstätigkeit auftreten können und zugehörige Lösungsansätze
1) Geschlechtsspezifische Diskriminierung
Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern blieben trotz
Angleichung des Bildungsniveaus erhalten. Frauen werden oft schon bei der
Einstellung benachteiligt, indem sie nahezu generell finanziell niedriger
eingestuft werden als Männer. Dies geschieht aufgrund der fälschlichen
Annahme, daß Frauen weniger aufs Geld angewiesen sind und sie den
Beruf weniger wichtig nehmen.
Männern, die gegen die sozialen Erwartungen ihre Erwerbstätigkeit
reduzieren oder unterbrechen, um sich der Familienarbeit zu widmen, wird
dagegen noch immer mangelnde Leistungsbereitschaft unterstellt. Oft sehen
sie sich auch mit dem Vorurteil konfrontiert, daß sie gar nicht in
der Lage wären Haushalt und Kinder gut zu versorgen. Gesellschaftliche
Normen, verfestigte traditionelle Rollenverteilungen der Ehepartner und
soziokulturelle Rahmenbedingungen erschweren die partnerschaftliche Aufteilung
der Familienarbeit.
Das internationale Jahr der Frauen 1975 war in Österreich Anlaß
Aktionen zu setzten, welche den Abbau geschlechtsspezifischer Sozialisation
unterstützen. Berufsinformation in der Schule, Lehrbuchänderungen,
Veränderungen des Frauenbildes in den Medien, interministerielle Arbeitsgruppen
und einiges mehr, sollten die Chancengleichheit und Gleichbehandlung der
Frauen fördern.
2) Kinderbetreuung
Vielfach sind es die mangelnden Kinderbetreuungsplätze bzw. deren
Öffnungszeiten, die eine Erwerbstätigkeit beider Elternteile
unmöglich machen oder zumindest erschweren. Vor allem Alleinerzieher
stehen vor dem Problem der guten und zeitgerechten Betreuung ihrer Kinder,
während sie arbeiten. Auch die für die Betreuung anfallenden
Kosten können zum Problem werden. Die meisten Kinder unter drei Jahren
werden privat (von Tagesmüttern, privaten Kinderbetreuungsstätten
etc.) betreut. Der Vorteil darin besteht in der flexibleren Zeiteinteilung,
da keine starren Öffnungszeiten vorliegen.
Um eine Wahlmöglichkeit zwischen den unterschiedlichen Betreuungsformen
zu ermöglichen, ist der rasche Ausbau von Formen der Kindertagesbetreuung
notwendig. Eine gute Betreuung bedeutet, daß Kinder ihr eigenes Selbst
entwickeln dürfen. "Die früheren Behauptungen, daß eine
angemessene Fürsorge nur dann möglich sei, wenn die Mutter nicht
arbeiten ginge, und daß die Inanspruchnahme von Tageskrippen ...
eine ernstzunehmende und auf Dauer schädliche Auswirkung auf die psychische
Verfassung hätte, haben sich nicht nur als verfrüht, sondern
auch als falsch erwiesen" (Rutter, 1982, S.3).
Aber nicht nur Kinderbetreuungsplätze, sondern auch flexible Arbeitszeitformen
müssen vermehrt geschaffen werden. Damit der Wechsel der traditionellen
Rollen überhaupt stattfinden kann, sind familienpolitische und gesellschaftliche
Maßnahmen notwendig.
Vor allem Teilzeitarbeit entspricht dem Wunsch vieler Frauen, da diese
als legitimste Form der Erwerbstätigkeit für Mütter gilt.
Der Nachteil der Teilzeitarbeit besteht in der geringen Bezahlung, geringer
sozialen Sicherung und beruflichen Nachteilen, da die Aufstiegschancen
sehr gering sind. Jobsharing, Gleitzeit, flexible Wochen- bzw. Jahresarbeitszeit
wären andere Möglichkeiten von den starren Arbeitszeiten abzuweichen.
Tatsache ist aber, daß sich viele Frauen (um eine Balance zwischen
Familie und Beruf zu schaffen) entschließen, Abstriche von ihren
beruflichen Plänen zu machen.
Persönliche Stellungnahme
Bei der Bearbeitung des Themas Familie und Arbeitswelt fiel mir schon
bei der Literatursuche auf, daß diese Vereinbarkeit fast ausschließlich
Thema der Mütter zu sein scheint. Lange Zeit wurden und werden Rollenklischees
in der Gesellschaft aufrecht erhalten. Ich bin aber der Meinung, daß
diese sicher nur langsam abgebaut werden können. Bis in die siebziger
Jahre war die Aufgabe des Mannes auf die Familienerhaltung beschränkt,
während die Frau Haus und Kinder versorgte. Diese starre Rollenteilung
hat sich seither sowohl von seiten der Frauen als auch der Männer
stark verändert. Durch die Tatsache, daß Frauen schlechter bezahlt
werden als Männer, und daß nicht genügend Kinderbetreuungsplätze
vorhanden sind, wird es Paaren auch nicht leicht gemacht, von den traditionellen
Rollenbildern abzuweichen. Arbeitgeber und Verwandte von Vätern, die
ihren Karenzanspruch wahr nehmen, um zu Hause bei den Kindern zu bleiben,
reagieren oft mit Verwunderung und Unverständnis. Wahrscheinlich ist
es aber nur eine Frage der Zeit, bis die väterliche Kinderbetreuung
als Selbstverständlichkeit angesehen wird.
Ich glaube, daß das Wichtigste Zufriedenheit aller Beteiligten
ist. Jede Familie und jedes Familienmitglied muß individuell Bedürfnisse
und Notwendigkeiten vereinbaren.
Literaturverzeichnis
Badelt, C. (1995). Die ökonomische Situation von Familien. In
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (Hrsg.),
Familie
und Arbeitswelt (S. 83- 96). Wien: Bundesministerium für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten.
Beham, M. & Schramm, B. (1995). Familie und Beruf - eine ungleiche
Wechselbeziehung? In Bundesministerium für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten (Hrsg.), Familie und Arbeitswelt (S. 1-10). Wien:
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.
Deutsch-Stix, G., & Janik, H. (1993). Hauptberuflich Vater. Paare
brechen mit Traditionen. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik.
Scarr, S. (1987). Wenn Mütter arbeiten: Wie Kinder und Beruf
sich verbinden lassen. München: Beck.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
18) Beruf Familie Freizeit / Zeitbudgeterhebungen
(Karin
Mayer)
Einleitung
1) Allgemeines
1192 lebten 7,9 Millionen Personen in Österreich, 52 % davon Frauen.
Allerdings überwiegt in den jüngeren Jahrgängen der Männeranteil.
Dafür sind 62 % der über-60-jährigen Frauen und 38 % Männer.
50er - 60er Jahre: "Familie" war die Gemeinschaft von Vater, Mutter
und Kind(er).
In der Zwischenzeit wurde der Familienbegriff neu definiert: "Familie"
= dauerhaft zusammenlebende Paare mit oder ohne Trauschein, mit oder ohne
Kinder und Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern.
1992: 840.000 Ein-Personen-Haushalte (55 % davon sind über 60 Jahre):
570.000 Frauen und 270.000 Männer.
2) Durchschnitt
In Österreich 1992 : Erwerbstätigkeit: 4Stunden pro Tag; unbezahlte
Arbeit: 3,5 h / Tag; Körperpflege, etc.: 2, 5 h / Tag; Freizeit: 5h
/ Tag; Schlaf: 1/3 des Tages
Hierbei ist zu erwähnen, daß es große Unterschiede
zwischen verschiedenen Gruppen, z. B. zwischen Frauen und Männern
gibt.
| |
Männer
|
Frauen
|
| Erwerbstätigkeit |
4,75 h / Tag
|
2,25 h / Tag
|
| unbezahlte Arbeit |
2h / Tag
|
5h / Tag
|
| Freizeit |
5,5 h / Tag
|
4,75 h / Tag
|
D.h. Männer verbringen mehr Zeit bei bezahlter Arbeit und der Freizeit,
verglichen mit den Frauen.
Vergleich mit letzten 10 Jahren: Kaum ein Unterschied: 1992: 20 Min.
mehr für Erwerbsarbeit und Ausbildung (fast zur Gänze durch Frauen),
20 Min. weniger Freizeit und 15 Min. mehr Zeit für Betreuung von Kindern
und Hilfsbedürftigen (Männer arbeiten durchschnittlich 0,5 h
/ Tag länger in Familie und Haushalt als 1981, trotzdem trennen noch
3h 20 Min. Arbeit in Haushalt, bei Kindern und Pflege den Mann von der
Frau).
3) Beschäftigungszeiten
Nach Beschäftigungszeiten werden 3 große Gruppen unterschieden:
-
Vollzeit-Erwerbstätige
-
Teilzeit-Erwerbstätige
-
Nicht-Erwerbstätige
| |
Vollzeit
|
Teilzeit
|
Nicht-Erwerbstätige
|
| |
Männer
|
Frauen
|
Frauen
|
Hausfr.*
|
Pen.**
|
Schüler1
|
Studenten2
|
| bezahlte Arbeit |
7h 10 Min
|
6h
|
3,75 h
|
0,5 h
|
0,5 h
|
0,5 h
|
1h
|
| Haushalte |
1,5 h
|
3,5 h
|
5,5 h
|
8h
|
4,25 h
|
1h
|
1h
|
| Freizeit |
4,75 h
|
3,75 h
|
3,75 h
|
4,25 h
|
6,5 h
|
5,75 h
|
5,75 h
|
| Persönliches |
10,5 h
|
10,5 h
|
10,5 h
|
11,25 h
|
12,75 h
|
11,5 h
|
10,25 h
|
| Schule/ Lernen |
|
|
|
|
|
5,25 h
|
6h
|
* Hausfr. = Hausfrauen
* * Pen. = Pensionisten
1 Schüler = 10-15-Jährige
2 Studenten = 15-20-Jjährige
Bei "Arbeiten" für Schüler und Studenten ist hauptsächlich
Babysitten und Nachhilfe geben gemeint.
4) Unbezahlte versus bezahlte Arbeit
Herr und Frau Österreicher/in investieren von ihrer Gesamtarbeitszeit
51 % in unbezahlte und 49 % in bezahlte Arbeit.
Erwerbstätige Frauen: 9,75 h Arbeit allg. / Tag
Erwerbstätige Männer: 8,75 h Arbeit allg. / Tag
Durchschnitt: Beruf : Familie à
bei Frauen 31 : 69; bei Männern 70 : 30
Karrierezeit (40-44 Jahre) à bei
Frauen 40 : 60; bei Männern 79 : 21
50 59-Jährige à bei Frauen
18 : 82; bei Männern 61 : 39
unbezahlte Arbeit:
Der Mann hilft beim Haushalt durchschnittlich 2 Stunden, egal ob die
Frau vollzeit-, teilzeit- oder nicht erwerbstätig ist.
Familien mit mind. 1 Kind unter 15 Jahren:
| |
Frau: Vollzeit
|
Frau: Teilzeit
|
Frau: Nicht-erwerbstätig
|
| |
Frau
|
Mann
|
Frau
|
Mann
|
Frau
|
Mann
|
| Haushalt |
4;24h
|
1h
|
4;54h
|
1h
|
6,11 h
|
1h
|
| Werkzeug |
3 Min
|
0,5 h
|
6 Min
|
0,5 h
|
4 Min
|
23 Min
|
| Kinder |
1,25 h
|
0,5 h
|
1,25 h
|
0,5 h
|
2,5 h
|
0,5 h
|
| Pflege Hilfsbedürftiger |
1 Min
|
1 Min
|
2 Min
|
2 Min
|
4 Min
|
2 Min
|
5) Aufteilung der Arbeit im Haushalt
Aufteilung der Arbeiten im Haushalt zwischen Männern, vollzeit-erwerbstätigen
Frauen (v), teilzeit-erwerbstätigen Frauen (t) und nicht-erwerbstätigen
Frauen (n):
| |
Männer
|
Frauen (v)
|
Frauen (t)
|
Frauen (n)
|
| Kochen |
10 Min
|
1,25 h
|
1h 20 Min
|
1h 50 Min
|
| Reinigung der Wohnung |
10 Min
|
1h
|
1,25 h
|
1,5 h
|
| Pflege der Kleidung |
1 Min
|
0,5 h
|
50 Min
|
1h
|
| Einkaufen |
0,25h
|
25 Min
|
0,5 h
|
0,5 h
|
| Gartenarbeit |
10 Min
|
10 Min
|
6 Min
|
0,25 h
|
Männer lassen sich hierbei von der Erwerbstätigkeit der Frau
kaum in der Beteiligung an der Hausarbeit beeinflussen. Veränderungen
bewegen sich im Minutenbereich.
6) Aufteilung der Kinderarbeit zwischen Männern und Frauen
Männer widmen der Kinderarbeit ca. 0,5 h pro Tag und legen den
Schwerpunkt der Kinderbetreuung im Bereich "Spielen", d.h. in Dinge, die
Spaß machen, während die Frauen das Versorgen, Betreuen und
Beaufsichtigen der Kinder übernehmen.
-
Vollzeit-erwerbstätige Frauen verbringen gezielt 1,25 h / Tag,
-
teilzeit-erwerbstätige Frauen einige Minuten mehr als Vollzeit-Erwerbstätige
und
-
nicht-erwerbstätige Frauen 2h 25 Minuten mit ihren Kindern.
7) Alleinerzieherinnen
86 % der Alleinerziehenden sind Frauen, von denen fast die Hälfte
mindestens ein Kind unter 15 Jahren hat. Der überwiegende Teil ist
erwerbstätig (das sind 80 %). Zum Vergleich: Frauen in einer Partnerschaft
sind zu 60 % erwerbstätig.
| |
Alleinerzieherin
|
Frau mit Partner
|
|
Vollzeit
|
bezahlte Arbeit |
5,25 h
|
4,75 h
|
| Haushalt |
4h 40 Min
|
5h 40 Min
|
|
Teilzeit
|
bezahlte Arbeit |
3h 50 Min
|
3,5 h
|
| Haushalt |
5,5 h
|
6,25 h
|
Kinder: Für die Versorgung der Kinder mit Füttern, Baden,
ins Bett bringen usw. brauchen die Alleinerzieherinnen ein paar Minuten
weniger (1,25 h) als Frauen, die in einer Partnerschaft leben. Sie setzen
sie dann bei Spiel, Sport und Kultur ein. Alleinerzieherinnen, die einer
Teilzeit-Arbeit nachgehen, investieren die gewonnene Zeit von 0,25 h pro
Tag in ihre Kinder.
Nicht-erwerbstätige Alleinerzieherinnen verbringen 2,75 h pro Tag
mit ihren Kindern, das sind also 1,5 h mehr als vollzeit-erwerbstätige
Alleinerzieherinnen.
(Die Daten betreffen Mütter mit mind. einem Kind unter 15 Jahren.)
Arbeitsfreie Zeit: Im Wochenschnitt gönnen sich Alleinerzieherinnen
4,25 h pro Tag, an denen sie nicht arbeiten. 1,75 h dieser Zeit verbringen
sie vor dem Fernseher, 0,25 h verwenden sie, um mit Freunden und Verwandten
Kontakt zu halten und etwa 0,5 h dient dem Sport.
Allerdings ist zu berücksichtigen, daß
-
vollzeit-erwerbstätige Alleinerzieherinnen nur 3,25 h,
-
teilzeit-erwerbstätige Alleinerzieherinnen 3,75 h und
-
nicht-erwerbstätige Alleinerzieherinnen 5,25 h arbeitsfreie Zeit pro
Tag haben.
8) Verhalten der Kinder
Die Zeiteinteilung der unter 20-Jährigen ähnelt der von Erwachsenen:
| |
10-15-Jährige
|
15-20-Jährige
|
| |
Buben
|
Mädchen
|
Buben
|
Mädchen
|
| Familienarbeit |
48 Min
|
57 Min
|
45 Min
|
1,5 h
|
| Freizeitanteil |
6,25 h
|
5,5 h
|
5,75 h
|
5h
|
| Persönliches |
12,25 h
|
12,25 h
|
11h
|
11,25 h
|
| Erwerbstätigkeit |
7 Min
|
3 Min
|
3,5 h
|
3h
|
| Aus- und Weiterbildung |
4,75 h
|
5,5 h
|
3,25 h
|
3,5 h
|
| Fernsehen, Video |
2h
|
1,75 h
|
1,75 h
|
1,5 h
|
| Sport |
1,25 h
|
0,75 h
|
0,75 h
|
0,5 h
|
| Hobbies, Spiele |
1,25 h
|
1h
|
0,5 h
|
0,25 h
|
| soziale Kontakte |
0,75 h
|
1h
|
1,75 h
|
1,5 h
|
9) Freizeit
Wenn man vom Wochendurchschnitt ausgeht, nehmen sich Männer 5,5
h pro Tag Zeit für sich selbst, Frauen nur 4,75 h.
| |
Männer
|
Frauen
|
| Fernsehen |
2h
|
1,75 h
|
| soziale Kontakte |
1,20h
|
1,10h
|
| Bewegung im Freien |
0,75 h
|
0,5 h
|
| Sport |
0,75 h
|
0,5 h
|
| Hobbies, Spiele |
19 Min
|
22 Min
|
Samstag: Es wird aufgearbeitet, was unter der Woche liegengeblieben
ist. Männer: fast 3h für Haushalt, Kinder und Pflege. Das ist
eine gute Stunde mehr als unter der Woche. Für die Freizeit sind noch
6,5 h vorhanden. Frauen: Im Haushalt sind sie 20 Minuten mehr tätig,
d.h. 5h 22 Min., die der Ordnung und Sauberkeit zugute kommen. Die Freizeit
beläuft sich auf 5,5 h.
Sonntag:
| |
Männer
|
Frauen
|
| Berufliches (inkl. Aus- und Weiterbildung) |
1h 20 Min
|
50 Min
|
| Haushalt |
1h 40 Min
|
3h 50 Min
|
| Freizeit |
8,5 h
|
6h 50 Min
|
| Persönliches |
12,5 h
|
12,5 h
|
Gesellschaft:
Männer begeben sich mehr in Gesellschaft, da Frauen mehr mit dem
Haushalt beschäftigt sind. Freizeit in Gesellschaft: Männer
3,5 h; Frauen 2,75 h;
Männer bis 45 verbringen ihre Zeit mehr mit anderen, ab 45 (wenn
sie sich mehr an der Familienarbeit beteiligen) überwiegt die Tätigkeit
ohne andere. Frauen ab 30 (Familienarbeit hat den größte Teil
ihrer Tätigkeit), arbeiten häufiger alleine (= eine unfreiwillige
Einsamkeit, was man daran sieht, daß sie in ihrer Freizeit die Gesellschaft
suchen).
Pensionisten: Über-80-Jährige verbringen weniger Zeit in Gesellschaft
als 60-Jährige. Alleinlebende bemühen sich mehr als Paare darum,
mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Alleinlebende zeigen auch mehr
Bereitschaft Kontakte aktiv zu gestalten.
Männer und Frauen in Partnerschaft: wichtigste Ansprechpartner
sind
Familienmitglieder und Verwandte. Bei Alleinlebenden sind dies Freunde.
10) Abschluß
Veränderungen können nur vorgenommen werden, wenn man bei
sich selber anfängt. Notwendig ist eine chancengleichere Rollenaufteilung
von Mann und Frau in Familie und Erwerbsleben. Gewichte müssen in
der Gesellschaft gleich verteilt werden, das heißt Erwerbsarbeit
und Familienarbeit als gleichwertig anerkannt werden. Dazu zählen
u. a. flexible Arbeitsformen, Ausbau der Kinderbetreuung, Anreize, daß
auch Männer Teilzeit arbeiten und Abbau des unterschiedlichen Lohnniveaus.
Der Trend geht sicher in Richtung Gleichstellung von Familien- und Erwerbsarbeit
und man kann auch vor allen bei jungen Familien erkennen, daß bezahlte
und unbezahlte Arbeit zwischen Mann und Frau aufgeteilt wird. Sicher ist
allerdings auch, daß sich ein solcher Prozeß nicht von heute
auf morgen vollziehen kann.
Literaturverzeichnis
Österreichisches Statistisches Zentralamt (Hrsg.). (1992). Wo
kommt unsere Zeit hin? Wien: Bundesministerium für Jugend und
Familie.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
19) Familienpolitik (Melanie
Peham)
Einleitung
Familienpolitik hat einen ordnungspolitischen Charakter. Sie soll Rahmenbedingungen
für Familien schaffen, ohne dabei eine bestimmte Lebensform zu forcieren.
Ein weiteres Ziel besteht in einem Lastenausgleich zwischen kinderbetreuenden
und kinderlosen Haushalten. Familienpolitik hat auch einen Einfluß
auf die Geschlechterrollen, so ist ein ausreichendes Angebot an Betreuungseinrichtungen
eine wichtige Voraussetzung damit Mütter arbeiten gehen können.
Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel eine noch höhere finanzielle
Unterstützung, welche bewirken könnte, daß Frauen zu Hause
bleiben und erst später in die Arbeitswelt zurückkehren, was
auch ein Problem aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktlage darstellt.
In Österreich gibt es 7 Ansatzpunkte zur Familienförderung,
diese sind:
1. Transfereinkommen
1.1. laufende Transfers, wie z. B. die Familienbeihilfe
1.2. ereignisbezogene Transfers, wie z. B. Geburtenbeihilfe (bis 1996)
oder Karenzgeld
1.3. zielgruppenspezifische Transfers, wie z. B. erhöhte Familienbeihilfe
für behinderte Kinder oder die Sondernotstandshilfe für Alleinerzieherinnen
2. Erwerbseinkommen - Besteuerung
2.1. Steuerbegünstigungen für Eltern mit Kindern, wie z. B.
Kinderabsetzbeträge
2.2. auf spezifische Lebenslagen bezogene Steuerbegünstigungen,
wie z. B. Alleinverdienerabsetzbetrag
3. Versicherungsschutz
3.1. beitraglose Mitversicherung von Angehörigen
3.2. Berücksichtigung von Zeiten der Kindererziehung in der Altersversicherung
der Frauen
3.3. Unfallversicherungschutz von Schülern und Studenten bei Schul-
u. schulbezogenen Veranstaltungen
3.4. Berücksichtigung der familiären Situation bei Transferzahlungen,
wie z. B. Notstandshilfe für Arbeitslose
4. Arbeitsrechtliche Ansprüche
4.1. Kündigungsschutz für Schwangere, Mutterschutz, Karenzurlaub
4.2. Anspruch auf Karenzurlaub und Pflegefreistellung
5. Sozialrechtliche Ansprüche
5.1. Berücksichtigung der familiären Situation im sozialen
Wohnbau und bei der Wohnbauförderung
5.2. Berücksichtigung der familiären Situation bei der Bemessung
von Sozialhilfe
5.3. Familienhärteausgleich
6. Infrastruktur- u. Sachleistungen
6.1. unentgeltliche medizinische Versorgung für Schwangere, Mütter,
Kleinkinder, wie z. B. unentgeltliche Entbindung oder der Mutter-Kind-Paß
6.2. Beratungsdienste, wie z. B. Mutterberatung, Familienberatung, Frauenberatung,
Erziehungsberatung
6.3. institutionelle Kinderbetreuung, wie z. B. subventionierte Kinderbetreuungsangebote
7. Leistungen für Schüler, Lehrlinge, Studenten
7.1. unentgeltlicher Besuch aller öffentlichen Schulen und Hochschulen
7.2. Schülerförderung
7.3. Familientarife bei öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen
öffentlichen Einrichtungen
Im internationalen Vergleich schneidet Österreich sehr gut ab. Laut
OECD, die 1990 eine Untersuchung durchführte, liegt unser Land im
Bereich der Direktzahlungen, also der Familienbeihilfe, an der Spitze,
und wird nur von Belgien überboten. So liegt der Transfer in Österreich,
gemessen am durchschnittlichen Bruttoeinkommen eines Industriearbeiters,
bei 14,2%. In anderen Ländern liegen die Werte zwischen 5-7%, in Norwegen
bei 10,2%. Bei den Steuerbegünstigungen hingegen liegt Österreich
im Schlußfeld. 1990 betrug die Quote nur 3,7%, seit 1993 liegt sie
bei 3,75%. Andere Länder haben in diesem Bereich höhere Steuerbegünstigungen,
wie z. B. die BRD mit 9,4% oder Belgien mit 11,7%. Aber allgemein gesehen
ist die Familienförderung in Österreich großzügig.
Im weiteren gehe ich nun auf familienpolitisch motivierte Transfereinkommen
und arbeitsrechtliche Regelungen für Schwangere, Mütter und Väter
ein.
Die Familienbeihilfe ist eine laufende Direktzahlung an Eltern
mit minderjährigen bzw. noch unterhaltsberechtigten Kinder bis 27
Jahre. Sie wird seit 1950 ausbezahlt und von 1979 bis 1991 um 69% erhöht.
1955 wurde das Familienlastenausgleichsgesetz, welches Transferzahlungen
für alle Bevölkerungsgruppen vorsieht, geschaffen. 1967 trat
das Gesetz über den "Ausgleichsfond für Familienbeihilfe" in
Kraft, welches bis heute gültig ist. Aus diesem Fond wird die Familienbeihilfe
finanziert. Er besteht aus lohnsummenbezogenen Dienstgeberbeiträgen,
allgemeinen Steuermitteln und Beiträgen der Länder. Der Grundbetrag
der Familienbeihilfe bis 10 Jahre beträgt 1300 ÖS pro Monat,
ab 10 Jahre 1550 ÖS und ab 19 Jahre 1850 ÖS. Für erheblich
behinderte Kinder gibt es eine erhöhte Familienbeihilfe ohne Altersgrenze.
Seit 1992 ist die Familienbeihilfe für den Elternteil bestimmt,
der überwiegend den Haushalt führt, bei Verzicht wird er dem
anderen Elternteil ausbezahlt. Lebt das Kind nicht bei den Eltern, dann
wird die Familienbeihilfe jenem Elternteil zugestanden, welcher die Unterhaltskosten
trägt. Ausländer bekommen die Familienbeihilfe entweder, wenn
sie legal beschäftigt sind oder wenn sie nicht beschäftigt, aber
fünf Jahre in Österreich sind. Für im Ausland lebende Kinder
gibt es eine gekürzte Familienbeihilfe. Anerkannte Flüchtlinge
sind den Österreichern gleichgestellt. Die Auszahlung erfolgt über
die Finanzämter.
Die Geburtenbeihilfe wurde 1955 eingeführt und seit 1974
wurden bewußt gesundheitspolitische Ziele, wie die Reduzierung der
Säuglings- und Müttersterblichkeit, verfolgt. So wurde auch der
Mutter-Kind-Paß
eingeführt
und so die medizinische Betreuung für Schwangere, Säuglinge und
Kleinkinder gewährleistet. Heute (ab Jänner 1997) gibt es aufgrund
von Sparmaßnahmen keine Geburtenbeihilfe mehr, aber man erhält
für einen vollständigen Mutter-Kind-Paß 2000 ÖS.
Eine weitere Leistung der Familienpolitik ist der Mutterschutz.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Frau schwanger ist bis vier Monate nach der
Entbindung tritt ein Kündigungsschutz in Kraft. Wird der Karenzurlaub
in Anspruch genommen, so endet der Kündigungsschutz vier Wochen nach
Ende des Karenzurlaubes. Während der Schwangerschaft sind bestimmte
Tätigkeiten, die die Gesundheit der Mutter oder des Ungeborenen gefährden
könnten, nicht auszuführen. Weiters sind Überstunden verboten.
Ebenso gilt das Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot. Das absolute
Beschäftigungsverbot, die Schutzfrist, beginnt acht Wochen vor der
Geburt und endet acht Wochen nach der Geburt. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten
und Kaiserschnitt wird die Schutzfrist auf zwölf Wochen nachher verlängert.
Bei Frühgeburten, bei denen eben die acht Wochen Schutzfrist vorher
verkürzt wurde, wird sie um diese Zeit nachher verlängert, jedoch
maximal auf 16 Wochen. Im Einzelfall, zum Beispiel bei Risikoschwangerschaften,
gilt das absolute Beschäftigungsverbot ab dem Zeitpunkt der ärztlichen
Diagnose. Arbeitet die Mutter während der Stillperiode mehr als 4,5
Stunden am Tag, so muß ihr der Arbeitgeber Zeit zum Stillen gewähren.
Weitere Leistungen der Familienpolitik sind das Wochengeld und die Betriebshilfe.
Das Wochengeld ist die Lohnfortzahlung während des Mutterschutzes
für unselbständig erwerbstätige Frauen. Die Berechnung erfolgt
nach dem Durchschnittseinkommen der letzten drei Monate und ist eine Leistung
der Krankenversicherung.
Gewerblich selbständige Frauen und Bäuerinnen erhalten während
der Schutzfrist eine Betriebshilfe, die zur Beschäftigung von
Hilfskräften gedacht ist. Sie ist eine Leistung der Sozialversicherung
der jeweiligen Berufsgruppe.
Eine große Errungenschaft stellt der Karenzurlaub dar.
Er wurde geschaffen, um erstens die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und
Beruf zu ermöglichen und zweitens um Arbeitslosigkeit zu verhindern.
1957 gab es erstmals nach der Novellierung des Mutterschutzgesetzes einen
sechsmonatigen Karenzurlaub. 1961 wurde er auf ein Jahr verlängert.
Seit 1990 können auch Väter den Karenzurlaub in Anspruch nehmen,
wobei auch sie einen Kündigungsschutz haben. Leider nehmen zur Zeit
nur 3% der anspruchsberechtigten Väter dieses Angebot an. 1992 wurde
der Karenzurlaub auf zwei Jahre verlängert, was jedoch bald wieder
auf eineinhalb Jahre verkürzt wurde, wobei er zwei Jahre beträgt,
wenn der andere Elternteil das letzte halbe Jahr in Anspruch nimmt. Es
ist auch eine Teilung zwischen den Eltern möglich. Allerdings ist
nur ein einmaliger Wechsel möglich und ein Elternteil muß mindestens
drei Monate Karenzurlaub beanspruchen.
Das Karenzurlaubsgeld ist von 1979 bis 1991 um 486% gestiegen.
Die Gründe dafür sind die Inflationsrate und die steigende Anzahl
der Karenzurlaubsgeldbezieherinnen. Bis Ende 1995 gab es drei Sätze
des Karenzurlaubsgeldes. Der Regelsatz war für Verheiratete mit ausreichendem
Einkommen bestimmt. Der zweite Satz, 150% des Regelsatzes, war für
Alleinstehende oder in Lebensgemeinschaft lebende und Verheiratete ohne
oder mit geringem Einkommen bestimmt. Der dritte Satz war eine Mischform
für Verheiratete oder in Lebensgemeinschaft lebende mit niedrigem
Einkommen. Die Auszahlung erfolgt über die Arbeitsämter. Die
Finanzierung erfolgt zu 70% aus dem Familienlastenausgleich und zu 30%
aus der Arbeitslosenversicherung.
Ab 1996 gibt es ein erhöhtes Karenzurlaubsgeld nur, wenn der Vater
des Kindes bekannt ist und wenn das gemeinsame Einkommen weniger als 11.000
ÖS brutto beträgt. Die Differenz zwischen normalem und erhöhtem
Karenzurlaubsgeld wird nur mehr als Vorschuß ausbezahlt und wird
später vom Vater oder von der Mutter wieder eingefordert, wenn ihr
Einkommen über einer bestimmten Grenze liegt. Der Regelsatz lautet
5.439 S, die Differenz ist 2.500 S, das erhöhte Karenzurlaubsgeld
beträgt also 7.939 S. Ist die Mutter erwerbstätig, aber noch
nicht lange genug, so bekommt sie eine Beihilfe, die maximal 50%
des Karenzurlaubsgeldes betragen kann.
Statt das Karenzjahr ganz zu beanspruchen, kann die Mutter oder der
Vater Teilzeit arbeiten und so Teilkarenzgeld beziehen. Es können
entweder beide Elternteile im zweiten Jahr, oder einer bis zum vierten
Geburtstag des Kindes teilzeitbeschäftigt sein um das Teilkarenzgeld
zu beziehen. Die Höhe orientiert sich nach der Reduktion der Arbeitszeit,
kann aber maximal 50% des Karenzurlaubsgeldes betragen. Das Problem dabei
ist, daß kein rechtlicher Anspruch auf diesen Teilkarenzurlaub besteht
und so nur mit Einverständnis des Arbeitgebers erfolgen kann.
Die Sondernotstandshilfe wurde 1974 für alleinstehende Mütter
im Anschluß an den Karenzurlaub bis zum dritten Geburtstag des Kindes
eingeführt. Seit 1990 dürfen auch Verheiratete und in Lebensgemeinschaft
lebende mit niedrigem oder ohne Einkommen diese Hilfe in Anspruch nehmen.
Seit1992 kann auch der Vater dieses Recht in Anspruch nehmen, wenn die
Mutter keinen Anspruch geltend macht. Voraussetzung ist, daß keine
andere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist und daher die Mutter oder
der Vater nicht berufstätig sein kann. Die Sondernotstandshilfe ist
eine Leistung der Arbeitslosenversicherung. Die Höhe richtet sich
nach dem letzten Erwerbseinkommen, kann aber nicht höher als das erhöhte
Karenzurlaubsgeld sein und wird längstens bis zum dritten Geburtstag
vom Arbeitsamt ausbezahlt.
Die Pflegefreistellung wurde 1975 verankert, um unselbständig
erwerbstätige Frauen und Männer die Pflege erkrankter, im Haushalt
lebende Angehörige (Kinder, Ehepartner, Lebensgefährte/in, eigene
Eltern) zu ermöglichen. Dieses Recht gilt für eine Woche im Jahr
und wurde 1993 für Kinder unter 12 Jahren auf eine weitere Woche verlängert.
Während dieser Freistellung wird der Lohn in voller Höhe ausbezahlt.
Wenn die zum Unterhalt verpflichtete Person (meist der leibliche Vater)
ihrer Verpflichtung nicht nachkommt, dann besteht die Möglichkeit
des Unterhaltvorschußes. Minderjährige inländische
und staatenlose Kinder haben Anspruch darauf. Die Kinder müssen in
Österreich leben, dürfen aber nicht im selben Haushalt wie der
zum Unterhalt Verpflichtete wohnen. Der Vorschuß wird für drei
Jahre gewährt. Danach wird die Situation neu geprüft. Die Finanzierung
erfolgt durch den Familienlastenausgleich. Gleichzeitig wird natürlich
versucht, das Geld vom säumigen Zahler einzutreiben.
Der Familienhärteausgleich ist für unverschuldet in
Not Geratene, Alleinerzieher/innen und Schwangere. Es kann ein Antrag auf
direkte Geldzuwendungen und Hilfe bei der Kreditrückzahlung gestellt
werden. Allerdings muß der Antragsteller die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen, staatenlos oder anerkannter Flüchtling
sein.
Der nächste Teil bezieht sich auf die steuerlichen Begünstigungen
für Familienerhalter. Es sei gleich vorgemerkt, daß
dies der kleinere Teil der Familiepolitik in Österreich ist, wie bereits
erwähnt wurde.
Den Kinderabsetzbetrag bekommt jeder, der Familienbeihilfe bezieht.
Es ist ein monatlicher Fixbetrag, der bei mehreren Kindern höher wird.
Wer für ein Kind Unterhalt bezahlt, das nicht im eigenen Haushalt
lebt, und keine Familienbeihilfe bezieht, der bekommt den Unterhaltsabsetzbetrag.
Die Auszahlung erfolgt aber erst beim Jahresausgleich und nicht monatlich.
Bei Familien, in denen der Unterhalt von einem Elternteil überwiegend
oder ganz bestritten wird, kommt es ebenso zu einer Verringerung der Steuerschuld
um einen Fixbetrag, dem sogenannten Alleinverdienerabsetzbetrag.
Eine solche steuerliche Begünstigung gibt es auch für Alleinerzieher,
das ist der Alleinerzieherabsetzbetrag. Das bedeutet, es kommt zu
einer Reduzierung von Lohn und Einkommenssteuer. Da dies bei einem kleinen
Einkommen nicht möglich ist, wird dies als Negativsteuer betrachtet
und direkt ausbezahlt.
Im Bereich der institutionellen Kinderbetreuung gibt es zur Zeit einige
Vorschläge von seiten der Regierungs- bzw. Oppositionsparteien. So
tritt die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ für einen Kinderbetreuungsscheck
ein. Diese Änderung würde laut SPÖ wesentliche negative
Konsequenzen mit sich bringen. Der Scheck würde nicht pro Kind sondern
pro Familie ausbezahlt werden und etwa 5000 bis 6000 ÖS betragen.
Davon müßten Kosten wie Sozialversicherungsbeträge oder
Kinderbetreuung selbst bezahlt werden. Das würde die Preise für
Kindergartenplätze deutlich erhöhen. Es gibt sicher auch einige
Vorteile dieses Kinderbetreuungsschecks, aber es ist ganz sicher noch nicht
das letzte Wort gesprochen.
Ein weiteres Kapitel meiner Arbeit beschäftigt sich mit der Kenntnis
familienpolitischer Maßnahmen in Österreich. Dabei zeigt
sich, daß neun von zehn Österreicher/inne/n die Familienbeihilfe
nennen. Für 11% ist die Familienbeihilfe die einzige Form von Familienpolitik.
Die Geburtenbeihilfe wurde von 31% genannt. Das Karenzurlaubsgeld wird
von 28% genannt, wobei 34% der Frauen und 22% der Männer diese Nennung
machten. Nur ein Viertel der Österreicher nannten überhaupt gesetzliche
Regelungen zur Erleichterung der Kinderbetreuung für erwerbstätige
Mütter oder Väter. So wurde der Karenzurlaub nur von 24%, die
Teilzeitarbeit von 23% und der Pflegeurlaub von 7% genannt.
Es zeigte sich, daß, je niedriger das Einkommen, desto eher wurde
die Familienpolitik als familienfördernd empfunden. Bei einem Einkommen
unter 12.000 ÖS stimmten 30% dieser Behauptung zu, während bei
einem Einkommen über 30.000 ÖS nur mehr 22% zustimmten.
Die Kenntnis hängt natürlich auch vom Bildungsniveau ab. Je
höher die Schulbildung ist, desto eher werden Maßnahmen wie
Steuerbegünstigung, Mitversicherung, Fahrtenermäßigung,
Studienbeihilfe und Wohnbauförderung genannt. Auch regionale Unterschiede
spielen eine Rolle. So ist in Salzburg die Kenntnis über familienpolitische
Maßnahmen höher als in Kärnten.
Der nächste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Bewertung
der derzeitigen Familienpolitik. Wie schätzen die Österreicher
die Auswirkungen der derzeitigen Familienpolitik in Österreich ein?
Sieben von zehn Österreichern, das sind 69%, finden, daß die
Familienpolitik die Lebenssituation und Entwicklungsmöglichkeiten
der Kinder verbessert. Für 56% bewirkt sie eine Erleichterung des
Lebens für Eltern mit Kindern. 65% sagen, Mütter haben nun mehr
Zeit für die Kindererziehung. Die Behauptung, Familienpolitik schaffe
eine Chancengleichheit von Frauen und Männern, unterstützen 60%
der Bevölkerung. 46% meinen, sie ermöglicht Paaren die gewünschte
Anzahl an Kindern großzuziehen. 45% sind der Meinung, daß die
Stellung von Ehe und Familie gestärkt wird. Nur 18% sehen durch die
Familienpolitik eine Erhöhung der Geburtenrate. Immerhin 30% der Österreicher
meinen, es sind keine Auswirkungen der Familienpolitik zu sehen.
Die gesehenen Auswirkungen variieren mit der Parteipräferenz. Das
positivste Bild der Familienförderung haben die Anhänger der
SPÖ. Am meisten skeptisch sind die Grünanhänger.
Bei der allgemeinen Beurteilung der derzeitigen Familienpolitik
sind 29% völlig zufrieden, 11% teilweise zufrieden, 41% meinen sie
sei nicht großzügig genug und 13%, sie sei insgesamt zu verschwenderisch.
Die Zufriedenheit hängt von der familiären Situation, von der
Parteisympathie und von regionalen Unterschieden ab. So sind die Anhänger
der Oppositionsparteien unzufriedener als die Anhänger der Regierungsparteien.
Die Anhänger der FPÖ meinen, die derzeitige Familienpolitik sei
zu verschwenderisch. Weiters findet sich in Kärnten eine Zufriedenheit
von 39%, während die Zufriedenheit in Tirol nur mehr bei 22% liegt.
Bei der Ausweitung familienpolitischer Maßnahmen und der
Nennung konkreter Maßnahmen zeigt sich folgende Prioritätenliste.
An erster Stelle stehen finanzielle Maßnahmen, wie vor allem:
die Familienbeihilfe nach dem Einkommen zu staffeln oder Steuererleichterungen.
An zweiter Stelle stehen erwerbsbezogene Maßnahmen wie flexible
Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit oder Verlängerung des Pflegeurlaubs.
An vierter Stelle steht die Kinderbetreuung, wobei hier besonders
auf die Betreuung der 3-6-Jährigen hingewiesen wird. An vierter und
letzter Stelle steht die Wohnsituation bzw. die Verbesserung der
Wohnsituation für Leute mit Kindern. Unterschiede in der Prioritäten-Reihenfolge
ergeben sich aufgrund des Bildungsniveaus, des Einkommens, des Alters,
dem Familienstand und der Parteisympathie.
Bevorzugte Formen der Familienbeihilfe sind nach Alter,
Einkommen oder Kinderanzahl gestaffelt. Die Staffelung nach
Alter wird in Städten bevorzugt. Die einkommensabhängige Staffelung
wird von Männern bevorzugt. Die Staffelung nach der Kinderanzahl wird
ab drei Kindern eher von Männern bevorzugt.
Addressat der Familienbeihilfe soll nach Meinung der Österreicher/innen
die Mutter (mit 57%), der Vater mit 20% oder beide mit 19% sein.
Der erwartete Einfluß der Familienpolitik auf die Kinderanzahl
ist eher gering, aber einige würden es sich bei einem Ausbau der familienpolitischer
Maßnahmen noch einmal überlegen. So würde ein Erziehungsgeld
nach Ende des Karenzurlaubs, flexible Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeit
nach Meinung der Bevölkerung die Kindererziehung sehr erleichtern.
Zusammenfassung
Ich habe nun einen Großteil der familienpolitischen Maßnahmen
näher vorgestellt. Es waren dies zum Beispiel Transfereinkommen, Besteuerung,
Versicherungsschutz, arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Ansprüche,
Infrastruktur und Sachleistungen und Leistungen für Schüler,
Lehrlinge und Studenten. Durch Sparmaßnahmen wurden einige Vergünstigungen,
wie zum Beispiel die Geburtenbeihilfe, gestrichen. Einige Veränderungen
sind zur Zeit im Gespräch, wie zum Beispiel der Kinderbetreuungsscheck
oder die Familienbesteuerung. Im großen und ganzen hat Österreich
ein gut ausgebautes familienpolitisches System.
Meine persönliche Meinung ist, daß wir in Österreich
ein gutes familienpolitisches System haben, daß es aber trotzdem
noch einiger Änderungen bedürfte. So wäre die Erhöhung
der Steuerbegünstigungen vorteilhaft. Ein großes Problem, welches
es zu lösen gilt, stellen die Alleinerzieherinnen dar, denn die meisten
der im Notstand lebenden Familien in Österreich sind Alleinerzieherinnen-Familien.
Hier würden Änderungen in der Arbeitswelt einiges bewirken können.
Ich glaube, Österreich ist in einigen Bereichen noch sehr schwerfällig,
zum Beispiel was den Bereich der Teilzeitarbeit oder die flexiblen Arbeitszeiten
betrifft. Aber ich hoffe, daß sich das bald ändern wird. Auch
die Wohnumgebung spielt eine große Rolle in der Erziehung der Kinder.
So ist klar, daß sogenannte Wohnsilos nicht gerade eine kindgerechte
Umwelt sind. Hier entstehen Aggressionen, die nicht verarbeitet werden
können und so in Gewalt enden. Solche, fast unscheinbaren "Kleinigkeiten"
dürfen nicht übersehen werden. Ich bin der Meinung, daß
die Familie das wichtigste Subsystem im großen System "Staat" darstellt.
Sie ist sozusagen die "Keimzelle" aus der alles weitere erwächst.
Sie entscheidet meistens über die weitere Zukunft der Kinder und dabei
braucht sie die Unterstützung des Staates. Ich finde, im Bereich der
Familienpolitik sollte man nicht sparen, oder zumindest nicht am falschen
Fleck.
Literaturverzeichnis
Gisser, R., Holzer, W., Münz, R. & Nebenfuhr, E. (1995). Familie
und Familienpolitik in Österreich. Wissen, Einstellungen, offene Wünsche,
internationaler Vergleich. Wien: Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie.
Neues Niederösterreich Bild, Nr. 41, Seite 4.
J
 Band
2: Reader zur Lehrveranstaltung "Familienpsychologie II" (SS 1998)
Band
2: Reader zur Lehrveranstaltung "Familienpsychologie II" (SS 1998)
zurück zur Homepage
von Harald Werneck