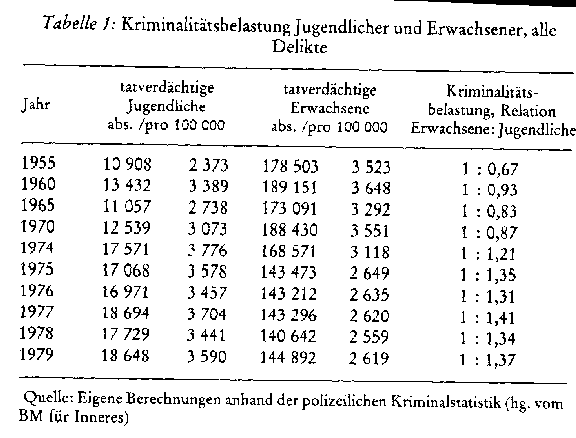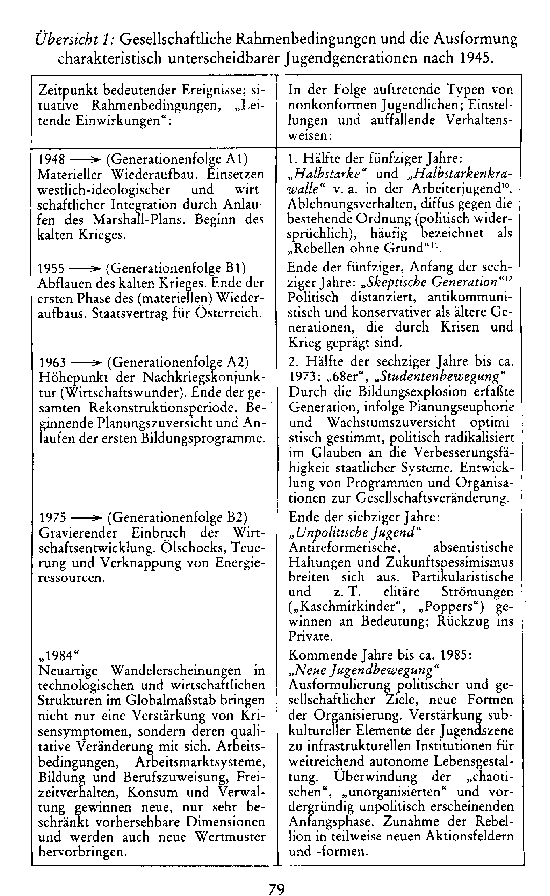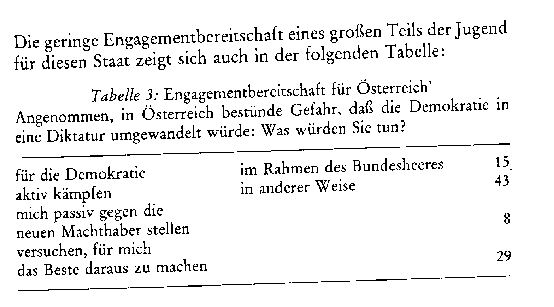Reader
zur Lehrveranstaltung
"Entwicklungspsychologie für Lehramtsstudierende"
606 152, anrechenbar als Allg. LA §3(2)1)e
Sommersemester 1997
(Blockveranstaltung vom 9. und 10. Mai 1997)
Lehrveranstaltungsleiter und Herausgeber
Univ.-Lektor Mag. Dr. Harald WERNECK
Abteilung für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie
des
Instituts für Psychologie der Universität Wien
Wien, Juni 1997

Vorwort
Der vorliegende Reader beinhaltet die gesammelten schriftlichen Berichte,
die von Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung "Entwicklungspsychologie
für Lehramtsstudierende" (am Institut für Psychologie der Universität
Wien) verfaßt wurden.
Behandelt werden dabei verschiedene ausgewählte Themenbereiche
aus der Entwicklungspsychologie, die für die Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung
- angehende Lehrerinnen und Lehrer an höheren Schulen - auch im Berufsalltag
von praktischer Relevanz sind.
Aufgrund der gemeinsamen theoretischen Ausgangsperspektive der einzelnen
Themen, eben der Entwicklungspsychologie, kommt es gelegentlich zu gewissen
Überschneidungen zwischen den einzelnen Beiträgen, was das gedankliche
Spektrum aber durchaus auch erweitern kann.
Die Berichte wurden nahezu unverändert (von den jeweiligen Diskettenversionen)
übernommen - abgesehen von gewissen Veränderungen im Layout bzw.
Korrekturen, betreffend die Rechtschreibung.
Auf eine inhaltliche Überarbeitung bzw. eine komplette Vereinheitlichung
des Layouts, aber auch beispielsweise der Literaturverzeichnisse mußte
aus Zeitgründen verzichtet werden.
Die inhaltliche Verantwortung bleibt dementsprechend bei den einzelnen
Autoren bzw. Autorinnen.
Dieser Reader versteht sich in erster Linie als Service für die
Teilnehmenden an der ihm zugrundeliegenden Lehrveranstaltung, aber auch
als Basisinformation bzw. Anregung für (aus verschiedenen Gründen)
am Thema Interessierte.
Wien, Juni 1997 Univ.-Lektor Mag. Dr. Harald Werneck

INHALTSVERZEICHNIS
-
Eriksons Modell der psychosozialen Entwicklung
(Julia Lanzdorf)
-
Körperliche und psychosexuelle Entwicklung
in der Pubertät (Elke Hollarek)
-
Koedukation - pro und kontra (Birgit Wodaczek)
-
Werthaltungen der heutigen Jugend (Markus Gonaus)
-
Sekten und Schule (Thomas Pleyer)
-
Kognitive Psychologie (Barbara Achammer)
-
Sprachentwicklung, Sprach- und Sprechstörungen
(Andrea Köck)
-
Motivationspsychologie (Birgit Wolf)
-
Kreativität (Elisabeth Breier)
-
Hochbegabung (Manuela Slany)
-
Verhaltensauffälligkeiten und psychosom.
Störungen im Jugendalter (Veronika Markl)
-
Drogen (Michael Tichacek)

 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1) Eriksons Modell der psychosozialen Entwicklung
(Julia Lanzdorf)
Einleitung
Erik H. Erikson hat zur psychosozialen Entwicklung ein Modell entworfen,
in welchem er das menschliche Leben in acht Phasen unterteilt. Es sollen
Urvertrauen, Autonomie, Initiative, Leistung, Identität, Intimität,
Zeugende Fähigkeit und Ich-Integrität aufgebaut werden, um Hoffnung,
Willenskraft, Zweckhaftigkeit, Können, Treue, Liebe Fürsorge
und Weisheit zu ermöglichen.
Die acht Phasen des Menschen
1. Vertrauen gegen Ur-Mißtrauen
Der früheste Beweis für das Vertrauen des Kindes zur Gesellschaft
ist das Fehlen von Ernährungsschwierigkeiten, Schlafstörungen
und Spannungszuständen im Verdauungstrakt. Die Abenteuer, die durch
die Sinne vermittelt werden, erwecken im Kind immer mehr das Gefühl
des Vertrauten und der Koinzidenz mit etwas das sich im Inneren gut anfühlt.
Zustände des Wohlbehagens und die damit in Beziehung stehenden Personen
werden ihm ebenso vertraut wie die nagenden Unlustgefühle in seinen
Verdauungsorganen. Daher kann man es als die erste soziale Leistung des
Kindes bezeichnen, wenn es die Mutter aus seinem Gesichtsfeld entlassen
kann, ohne übermäßige Wut oder Angst zu äußern,
weil die Mutter inzwischen zu einer inneren Gewißheit geworden ist.
Das Erleben des Konstanten, Kontinuierlichen und Gleichartigen der Erscheinungen
liefert dem Kind ein rudimentäres Gefühl von Ich-Identität
: das Kind "weiß" eine innere Welt erinnerter und voraussehbarer
Empfindungen in fester Korrelation mit der äußeren Welt vertrauter,
zuverlässig wiedererscheinender Dinge und Personen.
Die feste Prägung dauerhafter Verhaltensformen ist die erste Aufgabe
des Ich und daher auch die vornehmste pflegerische Aufgabe der Mutter.
Dazu muß gesagt werden, daß die Summe von Vertrauen, die das
Kind seinen frühesten Erfahrungen entnimmt, nicht absolut von der
Quantität an Nahrung und Liebesbezeugungen, sondern eher von der Qualität
der Mutter-Kind-Beziehung abhängt.
2. Autonomie gegen Scham und Zweifel
Die Reifung des muskulären Systems setzt ein neues Erprobungsstadium
ein, das gleichzeitig zwei soziale Modalitäten erfaßt, nämlich
das Festhalten und das Loslassen. Das Festhalten kann zu einem zerstörenden
Besitz- und Zwangsverhalten, aber auch zu einem vorgeprägten Verhalten
von Sorge und Fürsorge führen. Auch das Loslassen kann zum böswilligen
Freisetzen zerstörerischer Kräfte werden, oder es wird zum entspannten
Gehen-Lassen und Sein-Lassen.
Die Erziehung in diesem Stadium muß fest und sicherheitsgebend
sein. Das Kleinkind muß das Gefühl haben, daß sein Urvertrauen
zu sich selber und der Welt nicht dadurch in Frage gestellt wird, daß
es sich fordernd etwas aneignen oder eigensinnig etwas abweisen will. Die
äußere Lenkung soll ihm dabei helfen zu lernen, mit dem richtigen
Kraftaufwand festzuhalten und loszulassen. Und wenn man es ermutigt "auf
seinen eigenen Füßen zu stehen", muß man es zugleich gegen
sinnlose Erlebnisse von Scham und frühem Zweifel schützen.
Wird dem Kind die Autonomie der freien Wahl vorenthalten, so kehrt es
seinen Erkenntnisdrang gegen sich selbst: Es wird sich übermäßig
mit sich selber beschäftigen, ein frühreifes Gewissen entwickeln.
Statt die Welt der Dinge in Besitz zu nehmen und sie in zielbewußter
Wiederholung auszuprobieren, konzentriert sich das Kind zwanghaft auf seine
eigenen, sich wiederholenden Körpervorgänge. Durch seine Selbstbezogenheit
lernt es dann natürlich, seine Umgebung erneut auf sich zu lenken
und durch eigensinnige Forderung pünktlicher Beachtung dort eine Macht
auszuüben, wo es die größere wechselseitige Regulierung
nicht erreichen konnte.
Diese Phase wird daher entscheidend für das Verhältnis von
Liebe und Haß, Zusammenarbeit und Eigensinn, Freiheit der Selbstentfaltung
und ihrer Unterdrückung. Aus dem Gefühl der Herrschaft über
sich selbst ohne Verlust der Selbstachtung stammt ein dauerhaftes Gefühl
des guten Willens und des Stolzes; aus dem Gefühl verlorener Selbstkontrolle
und fremder Oberherrschaft erwächst ein dauernder Hang zu Zweifel
und Scham.
3. Initiative gegen Schuldgefühl
Die Initiative fügt zur Autonomie die Qualität des Unternehmens,
Planens und "Angreifens" einer Aufgabe um der Aktivität und der Beweglichkeit
willen hinzu. Das "Machen" und zwar in dem Sinne des "Sich-an-etwas-Heranmachens"
kommt in dieser Phase der freien Fortbewegung und der infantilen Genitalität
beim Knaben in phallisch-eindringenden Verhaltensweisen, beim Mädchen
mehr in Verhaltensweisen des Bekommens, und zwar entweder in der aggressiven
Form des Wegnehmens und eifersüchtiger in Besitznahme oder in der
milderen Form des Schmeichelns und Sich-Liebkind-Machens, zum Ausdruck.
Das Kind neigt jetzt dazu, sich selbst zu lenken, allmählich ein
Gefühl elterlicher Verantwortlichkeit zu entwickeln, ersten Einblick
in Institutionen, Funktionen und Rollen zu gewinnen und wird sich daher
gern mit sinnvollen Spielzeugen, Werkzeugen und mit der Fürsorge für
kleinere Kinder beschäftigen.
Die Gefahr dieser Phase ist das Schuldgefühl in bezug auf Unternehmungen,
die die Leistungsfähigkeit von Körper und Geist weit übersteigen
und daher der Initiative ein energisches Halt entgegensetzen. Während
ein Kind in der Autonomie-Phase auf seine jüngeren Geschwister eifersüchtig
sein mag, sieht es in der neuen Phase seine Rivalen in denjenigen, die
schon vorher da waren und dadurch das Feld, auf das sich seine eigene Initiative
richtet, mit überlegenen Kräften besetzt halten. Es kämpft
um die Vorrangstellung im Herzen der Mutter. Die unvermeidliche Niederlage
führt zu Resignation Schuldgefühlen und Angst. Dies ist die Phase
des "Kastrationskomplexes", der Furcht, zur Strafe für die mit den
genitalen Erregungen verknüpften Phantasien die Genitalien zu verlieren.
4. Leistung gegen Minderwertigkeitsgefühl
Das Leben muß erst einmal Schulleben sein, sei die Schule nun
der Acker, der Dschungel oder das Klassenzimmer. Ehe das Kind, das psychologisch
schon ein rudimentärer Vater oder eine rudimentäre Mutter ist,
auch biologisch in diese Rolle hineinwachsen kann, muß es noch lernen
auch in der Arbeitswelt und als potentieller Ernährer seinen Platz
zu finden. Mit Herannahen der Latenzperiode vergißt es den Drang,
die anderen Menschen seiner Umwelt durch direkten Kontakt zu erobern oder
jetzt auf der Stelle Papa oder Mama zu werden; stattdessen lernt es sich
Anerkennung zu verschaffen, indem es etwas leistet.
Die Gefahr dieser Phase liegt darin, daß sich ein Gefühl
der Unzulänglichkeit und der Minderwertigkeit bilden kann. Wenn das
Kind verzweifelt, weil es mit den Werkzeugen und Handfertigkeiten nicht
zurechtkommt oder weil es unter den seinen Werk-Gefährten keinen eigenen
Stand finden kann, so kann es die Hoffnung aufgeben, sich schon mit den
Großen identifizieren zu können, die sich im gleichen allgemeinen
Rahmen der Werkzeugwelt betätigen. Wenn das Kind die Hoffnung auf
so eine "werkmäßige" Anlehnung verliert, so wird es auf die
isolierte, weniger werkzeugbewußte, familiäre Rivalität
der ödipalen Periode zurückfallen. Das Kind verliert so das Vertrauen
sowohl zu seinen Fähigkeiten in der Werkzeugwelt wie in der Anatomie
und glaubt sich zur Mittelmäßigkeit oder zu einem Krüppeldasein
verdammt.
5. Identität gegen Rollenkonfusion
Mit der Aufrichtung eines guten Verhältnisses zur Welt der Handfertigkeiten
und Werkzeuge und mit Eintritt der sexuellen Reife ist die eigentliche
Kindheit zu Ende. Die Jugendzeit beginnt. Aber das rasche Körperwachstum,
das fast dem der frühen Kindheit gleichkommt, und das völlig
neue Hinzutreten der körperlichen Geschlechtsreife stellen alle vorher
schon als zuverlässig empfundenen Werte der Gleichheit und Kontinuität
in Frage. Die Jugendlichen sind angesichts der psychischen Revolution in
sich selber vor allem daran interessiert, wie sie in den Augen anderer
erscheinen, verglichen mit ihrem eigenen Gefühl, das sie von sich
haben. Sie suchen, wie sie ihre früher geübten Rollen und Geschicklichkeiten
mit den augenblicklich herrschenden Idealtypen in Verbindung setzen können.
Auf der Suche nach einem neuen Kontinuitäts- und Gleichheitsgefühl
muß der Jugendliche viele Kämpfe der früheren Jahre noch
einmal durchkämpfen.
Die Gefahr dieses Stadiums liegt in der Rollenkonfusion. Es ist hauptsächlich
die Unfähigkeit, sich für eine berufsmäßige Identität
zu entscheiden, was die jungen Menschen beunruhigt. Um sich selbst zusammenzuhalten,
überidentifizieren sie sich zeitweise scheinbar bis zum völligen
Identitätsverlust mit den Cliquen- und Massen-Helden. Damit treten
sie in die Phase der "Schwärmerei", was keineswegs ganz oder auch
nur vorwiegend etwas Sexuelles ist. Die Liebe des Jugendlichen ist weitgehend
ein Versuch, zu einer klaren Definition seiner Identität zu gelangen,
indem er seine diffusen Ich-Bilder auf einen anderen Menschen projiziert
und sie in der Spiegelung allmählich klarer sieht. Darum besteht junge
Liebe so weitgehend aus Gesprächen.
6. Intimität gegen Isolierung
Jeweils die Stärke, die in der vorhergehenden Phase besonders verletzlich
kostbar war, muß in der nächsten eingesetzt und riskiert werden.
Aus der Suche nach - und aus dem Beharren auf - seiner Identität geht
ein junger Erwachsener hervor, der nun bereit ist, seine Identität
mit der anderer zu verschmelzen. Er ist bereit zu Intimität, d. h.
er ist fähig, sich echten Bindungen und Partnerschaften hinzugeben
und die Kraft zu entwickeln, seinen Verpflichtungen treu zu bleiben, selbst
wenn sie gewichtige Opfer und Kompromisse fordern. Körper und Ich
müssen nun ohne Furcht vor einem Ich-Verlust Situationen begegnen
können, die Hingabe verlangen : in Orgasmus und geschlechtlicher Vereinigung,
in enger Freundschaft und physischem Kampf, in Erlebnissen der Inspiration
durch Lehrer und der Intuition aus der Tiefe des Selbst. Wenn der junge
Mensch aus Furcht vor dem Ich-Verlust diesen Erlebnissen ausweicht, so
führt dies zum Gefühl tiefster Vereinsamung und schließlich
zu einer
gänzlichen Beschäftigung mit sich selbst, zu einem Verlust
der Umwelt.
Die Gefahr dieses Stadiums ist die Isolierung, d.h. die Vermeidung von
Kontakten, die zur Intimität führen. Andererseits gibt es Bindungen,
die zu einer Isolierung zu zweit werden und beide Partner vor der Notwendigkeit
bewahren, der nächsten kritischen Entwicklungsphase entgegenzugehen
- der zeugenden Fähigkeit.
7. Zeugende Fähigkeit gegen Stagnation
Die zeugende Fähigkeit ist in erster Linie das Interesse an der
Stiftung und der Erziehung der nächsten Generation und schließt
auch Produktivität und Schöpfertum ein. Sie ist eine wesentliche
Phase des psychosexuellen wie des psychosozialen Entwicklungsplans. Wo
diese Bereicherung völlig entfällt, tritt eine Regression zu
einem zwanghaften Bedürfnis nach Pseudointimität ein, oft verbunden
mit einem übermächtigen Gefühl der Stagnation und Persönlichkeitsverarmung.
Die Individuen beginnen dann oft, sich selbst zu verwöhnen, als wären
sie ihr eigenes - oder eines anderen - einziges Kind. Die bloße Tatsache,
Kinder zu haben oder sogar sie sich zu wünschen, reicht aber nicht
dazu aus, zeugende Fähigkeiten zu "erlangen". Tatsächlich scheinen
manche junge Eltern unter der Retardierung der Fähigkeit zu leiden,
dieses Stadium zu entwickeln. Gründe dafür können exzessive
Eigenliebe oder das Fehlen eines "Vertrauens in die menschliche Spezies"
sein, das ein Kind als ein willkommenes Pfand der Gemeinschaft erscheinen
läßt.
8. Ich-Integrität gegen Verzweiflung
"Ich-Integrität" ist die wachsende Sicherheit des Ichs hinsichtlich
seiner natürlichen Neigung zu Ordnung und Sinnerfülltheit. Es
bedeutet die Hinnahme dieses unseres einmaligen und einzigartigen Lebensweges
als etwas Notwendigem und Unersetzlichem. Obwohl der integere Mensch sich
der Relativität all der vielen verschiedenen Lebensformen bewußt
ist, die dem menschlichen Streben einen Sinn verleihen, ist er bereit die
Würde seiner eigenen Lebensform gegen alle physischen und wirtschaftlichen
Bedrohungen zu verteidigen.
Mangel oder Verlust dieser gewachsenen Ich-Integrität ist durch
Todesfurcht gekennzeichnet : der einzige, einmalige Lebenslauf wird nicht
als die ultima ratio des Lebens anerkannt. Verzweiflung entspricht einem
Gefühl, daß die Zeit zu kurz ist, zu kurz für den Versuch,
ein anderes Leben zu beginnen und andere Wege der Integrität zu suchen.
Zusammenfassung
Die Beziehung zwischen Integrität der Erwachsenen und dem Vertrauen
des Kindes läßt sich am besten ausdrücken, indem man sagt,
daß gesunde Kinder das Leben nicht fürchten, wenn ihre Eltern
genug Integrität besitzen, den Tod nicht zu fürchten.
Persönliche Stellungnahme
Meiner Meinung nach ist das richtige Durchlaufen dieser psychosozialen
Phasen für die gesunde Entwicklung eines menschlichen Individuums
von größter Bedeutung. Trotz dieser Einsicht sehe ich mich jedoch
nicht imstande die nötigen Maßnahmen zu finden, wenn in einer
persönlichen Entwicklung diese positiven Gefühle als die der
jeweiligen Phase entsprechenden Errungenschaften nicht realisiert werden
können.
Literatur
Erikson, E.H. (1979). Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart :
Klett
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
2) Körperliche und psychosexuelle Entwicklung
in der Pubertät (Elke Hollarek)
Einleitung:
In welcher schwierigen Situation sich ein Schüler befindet, der
gerade die Pubertät durchlebt, zeigt uns ein sich erst vor kurzen
ereigneter tragischer Zwischenfall, bei dem eine Lehrerin tödlich
und eine zweite schwer verletzt wurde.
Grund dafür, so vermutet man, war eine zu starke Überbelastung
in dieser Zeit.
Jugendliche sollen lernen Verantwortung zu tragen, sich mit der Umwelt
auseinanderzusetzen und seinen Körper, der sich gerade besonders schnell
entwickelt, zu akzeptieren und mit diesen umzugehen.
Dies sind nur einige markante Merkmale der Pubertät, die es für
einen Jugendlichen besonders schwer machen, sich in seinem "neuen" Leben
zurechtzufinden.
Die Familie, Freunde und auch die Pädagogen können den Jugendlichen
bei diesem schwierigen Schritt helfen. Voraussetzung dafür, ist das
Wiederentdecken oder das Kennenlernen dieser Zeit, sowohl die körperliche
wie auch die psychosexuelle Entwicklung.
1. Die körperliche Entwicklung:
In der Physiologie wird unter den Begriff Pubertät die Reifung
zur Fortpflanzungstätigkeit verstanden. Über das Signal für
den Beginn der Pubertät ist noch sehr wenig bekannt. Schon beim Neugeborenen
sind Hormone der Hypophyse, die angeregt werden durch Hormone des Hypothalamus,
meßbar. Dadurch wird auch die Tätigkeit der Gonaden und der
Geschlechtsdrüsen angeregt. Diese Sekretion des Hormons vom Hypothalamus
hört beim Säugling bald auf, und dadurch sinkt der Spiegel der
Hormone der Hypophyse in den ersten 3 bis 6 Lebensmonaten auf fast nicht
mehr meßbare Werte ab.
Erst mit Beginn der Pubertät (bei Mädchen zwischen 8 und 10
Jahren, bei Jungen zwischen 9 und 11 Jahren) fangen die hypothalamischen
Neurone wieder an, synchronisiert und phasisch aktiv zu werden. Diese Aktivierung
erfolgt zunächst schlafabhängig innerhalb der Tiefschlafphasen.
Damit ist die Gonadotropinsekretion (= Hormone der Hypophyse) nächtlich
erhöht und regt die gonadale Tätigkeit und die Tätigkeit
der Geschlechtsdrüsen an. Damit kann das Wachstum reifer Samen beim
Mann sowie reifer Eizellen bei der Frau beginnen. Mit fortschreitender
Pubertät wird die Sekretion des Hormons vom Hypothalamus unabhängig
von den Schlafphasen und werden in zunehmenden Maße auch tagsüber
beobachtet. Das entspricht dem Erwachsenenzustand.
Hormon des Hypothalamus
Hormone der Hypophyse (LH und FSH)
Burschen: Androgen (Testosteron - Hormon der Nebennierenrinde)
Mädchen: Östrogen
Tab. 1: Entstehung und Stimulierung der Hormone kurz, vereinfacht aufgezeigt
1.1. Männliche Pubertät:
Die Einschätzung des pubertären Entwicklungsstandes bei Jungen
orientiert sich in den meisten Studien an den äußerlichen wahrnehmbaren
körperlichen Veränderungen; Wachstum des Penis und der Hoden,
Wachstum der Scham- und Axillarbehaarung, Entwicklung des Bartwuchses,
Stimmveränderungen und Längenwachstumsschub.
Der Beginn der Sekretion der Hormone im Hypothalamus des männlichen
Kindes bewirkt eine langsame Erhöhung der Gonadotropine LH und FSH
(= Hormone der Hypophyse). Durch FSH wird die Reifung der Samen, durch
LH die Produktion der Androgene (= männliche Geschlechtshormone) stimuliert.
Testosteron ist das häufigste und bekannteste Hormon mit anaboler
Wirkung. Die Androgene (werden in der Nebenniere produziert) maskulinisieren
das Individuum psychisch und somatisch. Die vermehrt ausgeschütteten
Androgene bewirken in der Pubertät die Entwicklung des Jungen zum
Mann.
Die erste äußere Veränderung ist das Wachstum der Hoden.
Es beginnt mit 11.6 Jahren (Variationsbreite des Beginns 9.5 bis 13.5 Jahre)
und hat etwa nach vier Jahren das erwachsene Entwicklungsstadium erreicht.
Das Wachstum der Schambehaarung beginnt kurze Zeit nach dem Beginn der
Veränderung der Hoden und zieht sich auch etwa über vier Jahre
hin. Das Wachstum des Penis beginnt etwa ein Jahr nach dem Beginn des Hodenwachstums
und dauert etwa zwei Jahre bis das erwachsene Stadium erreicht ist.
Ganz global wirken alle Androgene eiweißanabol, d.h. sie stimulieren
die Eiweißsynthese. Deshalb ist auch nach der Pubertät der Habitus
eines Mannes in der Regel größer und muskulöser ausgeprägt
als der weibliche. Androgene bewirken durch Stimulation der Eiweißmatrix
eine verstärkte Knochenbildung. Auch die Muskelmasse ist durch Androgene
stimulierbar. Diese beiden Effekte werden durch Muskeltraining besonders
deutlich. Im Blut zirkulierendes Testosteron wird in vielen Anhangsorganen
der Haut umgeformt. dieses ist dann für den maskulinen Behaarungstyp
(Bartwuchs,...) und die vermehrte Fettproduktion und -sekretion der Haut
verantwortlich.
Die intrapubertär vermehrt gebildeten Androgene bewirken auch einen
Schub des Längenwachstums. Die vermehrte Androgenproduktion bewirkt
aber nach diesem Wachstumsschub, daß die für das Längenwachstum
wichtigen Wachstumszonen (Epiphysen) der Röhrenknochen verknöchern.
Damit ist ein weiteres Längenwachstum unmöglich gemacht.
Durch den Wachstum des Kehlkopfes werden die Stimmbänder länger
und die Stimme sinkt um ca. eine Oktave.
1.2. Weibliche Pubertät:
Die frühpubertierende Phase beginnt gleich wie beim Jungen, nur
bilden Frauen zum Teil andere Hormone, z.B. Östrogen, aus als Männer.
Die zunächst nur nächtlich vermehrt produzierten Östrogene
bewirken die somatische Differenzierung des Mädchens zur jungen Frau.
Mit fortschreitender Pubertät funktioniert dieser Regelkreislauf auch
tagsüber, was schließlich zu den regelmäßigen Menstruationszyklen
führt.
In diesem Zusammenhang sei auf die Gefahr der Anabolika hingewiesen,
die für androgene Nebenwirkungen bekannt sind. Die vor allem im Sportbereich
verwendeten Dopingmittel führen nicht nur zu dem erwünschten
Muskelaufbau, sondern üben tiefgreifende Einflüsse auf den ganzen
Hormonregelkreislauf bei Mann und vor allem bei Frau aus.
Die Östrogene sind wichtig für die Ausbildung der sekundären
Geschlechtsorgane, die sich bei der Frau in Form von Behaarung und Brüsten
zeigen. Beim Mädchen ist die gering ausgebildete eiweißanabole
Wirkung der Östrogene wichtig für den milden Wachstumsschub und
die anschließende Verknöcherung der Epiphysen, so daß
gegen Ende der Pubertät das Längenwachstum abgeschlossen ist.
(Siehe Schmidt/Thews, Physiologie des Menschen, 1995, S. 370-389)
1.3. Der pubertäre Wachstumsschub:
Bei Mädchen ist das erste Zeichen des Eintritts in die Pubertät
der Wachstumsschub, während bei Jungen dieses Nachaußen sichtbare
Zeichen der Reifezeit erst später auftritt; an einem Punkt, an dem
sie schon einige Zeit die für andere nicht direkt sichtbare Wachstum
der Genitalien und der Schambehaarung erlebt haben. (Siehe Kracke, Probleme
und Problemverhalten bei Jungen, 1993, S.7)
Der Beginn, die Intensität und die Dauer ist jedoch von Kind zu
Kind verschieden, da das Alter in dem die ersten Anzeichen der Pubertät
auftreten, sowohl familiär als auch rassisch bedingte Unterschiede
aufweist. Der individuelle Beginn und die Dauer der Pubertät hängt
von Erbfaktoren, Umweltbedingungen, wie beispielsweise dem Grad der Urbanisierung,
der Ernährung und von der individuellen Lebensgeschichte ab.
Bei den Knaben kann der Wachstumsschub schon mit 10.5 Jahren oder auch
erst mit 16 Jahren einsetzen. Der Junge wächst ungefähr 20 Zentimeter
(zwischen 10 und 30 cm) und wiegt schlußendlich zirka 20 kg (zwischen
7 und 30 kg) mehr als vor dem pubertären
Wachstumsschub. Am Punkt der höchsten Wachstumsgeschwindigkeit
wachsen Jungen zirka 9.3 cm pro Jahr.
Bei den Mädchen setzt der Wachstumsschub zirka zwei Jahre früher
ein. Der Wachstumsschub ist bei ihnen meistens weniger stark ausgeprägt.
In dieser Phase nehmen die Mädchen zirka 16 cm an Größe
und 16 kg an Gewicht zu.
An dieser Stelle soll erwähnt werden, daß die Angaben und
Untersuchungen längere Zeit zurückliegen. Im Zuge der Akzeleration
ist anzunehmen, daß sich das Alter vorverlegt hat, d.h. das Jugendliche
immer früher in die Pubertät kommen. Eine Untersuchung über
das Menarchealter für Westeuropa zeigt, daß sich das Menarchealter
alle 10 Jahre um zirka 4-5 Monate zeitlich vorverschiebt. Daraus kann man
schließen, das sich der Wachstumsschub sowohl bei Knaben als auch
bei Mädchen 12 - 15 Monate früher anzusetzen sein wird.
Am Wachstumsschub sind praktisch alle Skelett- und Muskelpartien, so
wie auch die inneren Organe beteiligt. Die einzelnen Körperteile beginnen
in einer genau festgelegten Ordnung zu unterschiedlichen Zeiten zu wachsen
und deren Wachstumsverläufe vollziehen sich außerdem mit unterschiedlicher
Geschwindigkeiten. Zu Beginn des pubertären Wachstumsschubes vergrößern
sich bei beiden Geschlechtern die unteren Extremitäten. Bereits drei
Monate nach Beginn des Wachstumsschubes wird die höchste Wachstumsgeschwindigkeit
der Füße erreicht. Die Waden und Schenkel erreichen sechs Monate
später das Maximum der Wachstumsgeschwindigkeit und nach weiteren
4 Monaten ist es für das Breitenwachstum von Hüften und Brustkorb,
gefolgt von den Schultern ausgestanden. Am schnellsten wachsen der Kopf,
die Hände und die Füße, deshalb scheint es verständlich,
daß diese Körperteile auch als erstes den Erwachsenenstand erreichen.
Die Folge der nicht synchron ablaufenden Wachstumsprozesse einzelner
Körperteile ist, daß der Körper den Eindruck einer somatischen
Disharmonie erweckt. Für die Jugendlichen stellt diese Phase unter
anderem eine Zeit der körperlichen Umstellung dar. Sie müssen
die neuen Körperdimensionen erst motorisch beherrschen und koordinieren
lernen und deshalb wirken ihre Bewegungen oft ungeschickt und eckig. (Siehe
Winkler-Hermaden, Die Sexualität als pädagogische Herausforderung,
1994, ab S.40)
Jungen sind mit dem Einsetzen der körperlichen Veränderung
zum großen Teil sehr zufrieden. So haben Jungen, die bereits die
pubertären Veränderungen erfahren, ein positives Körperbild
als Jungen, die noch nicht in der Pubertät sind. Sie sind auch zufriedener
mit ihrer Körperkraft und Leistungsfähigkeit als präpubertäre
Jungen. (Siehe Kracke, Pubertät und Problemverhalten bei Jungen, 1993,
S.10)
Zur Frage, was Jugendliche an sich selbst nicht mögen, wurden,
bei einer anderen Befragung, die körperlichen Merkmale weit vor intellektuelle
Fähigkeiten und sozialen Verhaltensweisen genannt. Anscheinend spielt
für das Selbstwertgefühl die äußere Erscheinung eine
zunehmend wichtige Rolle.
Jungen werden neben der Kleinwüchsigkeit auch noch durch zu klein
empfundene Geschlechtsteile, spärlich beunruhigt. Bei Mädchen
wird eine Beunruhigung neben der durch Übergewicht, noch durch einen
stämmigen Körperbau, große Hände und Füße,
wenig entwickelte Brüste, Magerkeit, starke Behaarung an Beinen und
Armen hervorgerufen. Daß eine Körperbehinderung in dieser Entwicklungsstufe
zu bedeutenden psychischen Begleiterscheinung führen kann, läßt
sich der obigen Darstellung leicht Schlußfolgern. (Siehe Winkler-Hermaden,
Die Sexualität als pädagogische Herausforderung, 1994, ab S.
47)
2. Psychosexuelle Entwicklung:
2.1. Sexuelles Verhalten und die Beziehung zum anderen Geschlecht
Die Pubertät ist eine Zeit des Lernens. Die Jugendzeit in höherentwickelten
Kulturen ist ein Lebensbschnitt des Suchens und Vorbereitens auf die Erwachsenenwelt.
Dies gilt natürlich auch für das psychosexuelle Verhalten
In der Pubertät erlangt die Sexualität eine neue Dimension,
da die Jugendlichen biologisch gesehen geschlechtsreif geworden sind und
sie damit den Erwerb der vollen sexuellen Funktionsfähigkeit erlangt
haben. In vielen Kulturen spricht man erst dann von einer reifen Sexualität,
wenn der soziale Bezug des Sexualität hergestellt wird, da die Sexualität
ein intimes soziales Verhalten zwischen zwei Personen darstellt.
Es gibt im Jugendalter eine Vielzahl von sexuellen Praktiken, wobei
die Masturbation (Selbstbefriedigung) bei den Jugendlichen weit verbreitet
ist. Masturbation leitet sich vom lateinischen Zeitwort "masturbare" ab.
Darunter wird nicht nur eine manuelle Stimulation bei Mann oder Frau verstanden,
sondern vielmehr jede bewußte körperliche Selbststimulierung,
die eine sexuelle Reaktion hervorruft.
Für den Jugendlichen ist die Masturbation meisten die erste bewußte
erlebte sexuelle Praktik.
Trotz des Normenwandels ist die masturbatorische Betätigung noch
immer mit Schuldgefühlen verbunden. Man kann es darauf zurückführen,
daß die Masturbation noch immer tabuisiert wird. 57% der Mädchen
und 45% der Jungen geben an aufgrund der Masturbation Schuldgefühle
zu haben. An dieser Entwicklung sind die Familie, die Schule und das weitere
sozialisierende Umfeld wesentlich beteiligt.
Untersuchungen zeigen, daß Burschen mit 14 Jahren mindestens zu
60% und mit 16 Jahren zu 90% Masturbationserfahrung haben.
Mädchen masturbieren seltener. Im Alter von 16 Jahren gaben nur
50% der Mädchen an, masturbiert zu haben.
Heterosexuelle Beziehungen bauen sich stufenweise auf. In einer Untersuchung
wird folgende Einteilung für die psychosexuelle Entwicklung getroffen:
-) erstes Mal verliebt sein
-) die erste Verabredung
-) die/der erste/r Freund/in
-) das erste Petting
-) das erste homosexuelle Petting
-) der erste Geschlechtsverkehr
Die Jugendlichen wurden dazu befragt, wobei in Geschlecht, Bildung und
Schulart unterschieden wurde. 44% sind Burschen, 56% Mädchen. 39%
der befragten Jugendlichen besuchen die AHS, 36% eine BHS und zirka 25%
sind Lehrlinge.
|
Psychosexuelle Entwicklungsstufen
|
%
|
Alter
|
| 1. Mal Verliebtsein |
94
|
12.9 (14)
|
| 1. Verabredung |
91
|
13.1 (14)
|
| 1. Kuß |
89
|
13.1 (14)
|
| 1. fester Freund |
72
|
14.3 (14)
|
| 1. Petting |
62
|
14.9 (15)
|
| 1. homosexuelles Petting |
4
|
13.4 (13)
|
| 1. Geschlechtsverkehr (heterosexuelle Partner |
43
|
15.5 (16)
|
Tab. 2: Psychosexuelle Entwicklungsstufen (siehe Ebenda, S. 74)
Die erste Verabredung ist ein einschneidendes Erlebnis für die
Jugendlichen. Die Jugendlichen, die sich bis jetzt vorwiegend im gleichgeschlechtlichen
Bekannten- und Freundeskreis aufgehalten haben, beginnen, aufgrund der
Zunahme des sexuellen Interesses und dem sozialen Druck, sich mit einer
gegengeschlechtlichen Person zu treffen. Mit Hilfe der Verabredung kann
der Umgang mit dem anderen Geschlecht erprobt und erlernt werden.
Der Kuß ist bei den meisten Heranwachsenden der erste spezifische
sexuelle Kontakt. Dieser sexuelle Kontakt wird im allgemeinen von den meisten
Leuten in der Öffentlichkeit akzeptiert oder zumindest geduldet. Deshalb
scheuen sich die Jugendlichen auch nicht, sich in der Öffentlichkeit
zu küssen.
Sexuelle Verhaltensformen, die oft nur einen kleinen Schritt vom Koitus
entfernt sind, werden als Petting bezeichnet. Der Geschlechtsverkehr wird
dabei nicht vollzogen. In der Literatur wird zwischen aktiven und passiven
Petting unterschieden.
Aktives Petting bedeutet, das Streicheln der Genitalien von einer anderen
Person, und das passive bedeutet das Gestreicheltwerden der Geschlechtsteile
durch eine andere Person.
Jugendliche betätigen sich mit zunehmenden Alter immer mehr sexuell.
Dies beruht auf des sexuellen Veränderungen im physischen Reifezustand
unmittelbar nach der Pubertät.
Das durchschnittliche Alter für den ersten Geschlechtsverkehr beträgt
15 Jahre. Als häufigster wurde 16 Jahre angegeben
|
Alter
|
gesamt
|
Mädchen
|
Burschen
|
|
13 oder jünger
|
3.5
|
4
|
3
|
|
14
|
14
|
15
|
13
|
|
15
|
28
|
31
|
27
|
|
16
|
34
|
32.5
|
36
|
|
17
|
14
|
15
|
14
|
|
18
|
4
|
2
|
6
|
Tab. 3: Altersverteilung beim ersten Geschlechtsverkehr (siehe Ebenda,
S .78)
2.2. Jugendliche Partnerschaftsbeziehung
Man muß den festen Bindungscharakter jugendlicher Partnerschaft
betonen. Die meisten Jugendlichen sprechen von Liebe in der Partnerschaft
und beurteilen diese als sehr stabil. Dennoch würde nur ein kleiner
Teil der Jugendlichen etwas wirklich Unangenehmes auf sich nehmen, um den
Partner zu halten. (Siehe Ebenda ab S. 80)
2.3. Das sexuelle Erleben der Jugendlichen:
Um die emotionale Seite des Erlebnisses, zum ersten Mal mit einem Partner
zu schlafen, im Detail zu erfassen, wurden die Jugendlichen noch einmal
gesondert zu ihren Gefühlen gefragt.
| Gefühle beim ersten Mal |
gesamt
|
Burschen
|
Mädchen
|
| war nicht besonderes |
23
|
19
|
26
|
| machte Spaß |
34
|
43
|
27
|
| hatte ein schlechtes Gewissen |
8
|
8
|
10
|
| tut es nur dem Partner zuliebe |
3
|
3
|
4
|
| war lustvoll und befriedigt |
31
|
40
|
24
|
| hoffentlich war Partner zufrieden |
15
|
19
|
12
|
| war angenehm |
9
|
7
|
11
|
| war glücklich |
46
|
47
|
45
|
| bedauerte, es getan zu haben |
8
|
7
|
10
|
| wollte es bald wieder machen |
31
|
39
|
24
|
| fand es widerlich |
2
|
2
|
1
|
| war besorgt, mich ungeschickt angestellt
zu haben |
19
|
23
|
16
|
| konnte Partner danach nicht mehr leiden |
4
|
4
|
4
|
| fühlte mich als Mann/Frau bestätigt |
5
|
6
|
4
|
| hat weh getan |
25
|
16
|
33
|
| war ein großes Ereignis |
36
|
36
|
36
|
Tab. 4: Das "erste Mal" (siehe Ebenda S. 84)
Prinzipiell läßt sich sagen, daß Sexualität von
den Jugendlichen als etwas Positives empfunden wird. Bei des meisten stehen
Gefühle, wie Liebe oder für andere Zeit haben, im Vordergrund.
Der Großteil der Jugendlichen möchte in einer festen Partnerschaft
leben.
3. Schule und Pubertät:
"Die Schule müßte ein Bildungswesen für Adoleszente
sein. Sie Müßte Jugendliche auf dem Wege ihrer Identitätsfindung
begleiten und könnte durch abgestimmte Bildungsangebote diese persönlichen
Entwicklungswege bereichern" (siehe Fend, 1994, S.8)
Die Pubertät beschäftigt zwar sehr viele Lehrerinnen und Lehrer.
Und vieles, was die Schul-Arbeit in all ihren Facetten gerade in den "wilden
Jahren" so herausfordernd macht, wir - zumindest begrifflich - mit "der
Pubertät" in Verbindung gebracht.
Dennoch ist es eher so, daß die Pubertät als biographische
"Katastrophenphase" angesehen Wird, als Naturereignis, das man halt hinnehmen
muß, durch das man "durch" muß, das den Ansprüchen der
Schule aber eher ablenkt, anstatt daß die Schule auf einen pubertätsadäquaten
Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum hinlenkt (siehe Aschoff, Pubertät,
1996, ab S. 77).
Die Sexualerziehung ist eine Geschlechtserziehung. Der Begriff Sexualerziehung
beschränkt sich meist nur auf die Beschreibung und Benennung der Geschlechtsorgane,
sowie deren Funktion und gewisser Themenkreise.
Geschlechtserziehung umfaßt sowohl das oben genannte, soll aber
auch die Förderung von Liebes- und Genußfähigkeit beinhalten,
wie auch eine positive Einstellung zum anderen Geschlecht fördern.
Das Kind soll Kreativität und Phantasie entwickeln und einen anderen
vertrauen lernen. Ein weiterer Punkt der Geschlechtserziehung stellt die
Förderung der Kommunikationsfähigkeit dar. Die Geschlechtserziehung
ist verantwortlich für die Entwicklung menschlicher und moralischer
Einstellungen.
Das sexuelle Verhalten eines jungen Menschen ist das Produkt seiner
ganzen Erziehung.
Riccabona beschreibt eine der bedeutendsten Aufgaben der Sexualerziehung
und die Möglichkeit, diese zu lösen folgendermaßen: " Mehr
noch als in anderen Erziehungsbereichen besteht eine wesentliche Aufgabe
der Sexualerziehung darin, junge Menschen zur Achtung vor dem Du des Mitmenschen
zu führen. Einen anderen Menschen achten, schätzen, lieben kann
nur, wer diese Gefühle an sich selbst erfahren hat."
Daraus würde folgen, daß die Familie den größten
Teil der geschlechtserziehenden Aufgabe zu erfüllen hat. Ihre Aufgabe
beschränkt sich nicht nur auf die sexuelle Aufklärung, sondern
muß vielmehr auch die Vermittlung von Liebesfähigkeit, Genußfähigkeit,
Leibfreundlichkeit, eigene und fremde Bedürfniserkennung und -befriedigung
usw. als Ziel anstreben. Da die Geschlechtserziehung einen Teil der Gesamterziehung
darstellt, und die Schule einen Bildungs- und Erziehungsauftrag hat, ist
die Geschlechtserziehung folglich auch eine Aufgabe der Schule. Um den
Schülern und Schülerinnen neue Denkanstöße zu bieten,
muß neben der sexuellen Aufklärung auch das Thema Sexualität
aus den Blickwinkeln verschiedener Sittenkodizes betrachtet werden. Die
schulische Geschlechtserziehung hat also eine die Eltern unterstützende
Funktion, ersetzen sie aber keineswegs (siehe Winkler-Hermaden, Die Sexualität
Pubertierender als pädagogische Herausforderung, 1994, ab S. 89).
Zusammenfassung:
Um die Probleme, Sorgen und auch Freuden unserer Schüler zu verstehen,
ist es besonders wichtig, sich mental in die Zeit unserer Pubertät
zurückversetzen zu können. Dadurch werden manche Reaktionen der
Jugendlichen viel leichter verständlich. Diese Zeit stellt ja nicht
nur für den Schüler eine schwierige Zeit dar, sondern auch für
den Lehrer, der die Launen und Ansichten manchmal nicht verstehen kann.
Deshalb ist es für einen Pädagogen unerläßlich,
sich mit der Pubertät als Thema auseinanderzusetzen. Sei es einerseits
physiologisch, d. h. die körperliche Entwicklung in den Grundzügen
zu verstehen, andrerseits emotional, darunter fällt auch die psychosexuelle
Entwicklung.
Persönliche Stellungnahme:
In meinem Lehramtsfach "Musikerziehung" muß man die Pubertät
besonders beobachten, da wie schon oben erklärt, sich im Zuge des
Längenwachstums natürlich auch die Stimmbänder und der Kehlkopf
mitverändern. Dem eigentlichen Stimmbruch (= Mutation), der deutlich
zu hören ist, geht die Prämutation voraus, wo die Stimme für
Überforderung im gesanglichen besonders empfindlich ist. Diese Phase
ist jedoch nur sehr schwer zu hören, da die Entwicklung individuell
verschieden ist.
In der gesamten Mutation muß man mit der Stimme sehr sorgsam umgehen,
um Spätfolgen, wie zum Beispiel funktionelle Stimmstörungen zu
vermeiden. Es stellt sich für den Musikpädagogen eine besonders
schwierige Aufgabe den Schülern die richtige Stimmhygiene beizubringen,
da sie mit ihren Körper so wenig wie möglich konfrontiert werden
möchten.
Die Pubertät bedeutet im Falle der Musik nicht nur für den
Schüler eine Einschränkung, sondern auch für den Lehrer,
der das große Thema "Singen im Unterricht" für ein bis zwei
Jahre ruhen lassen muß. Somit fällt ein wichtiger Teil des "
Aus-sich-Herausgehens" weg, den man in dieser Zeit vorwiegend durch Tänze
oder andere Bewegungen kompensieren sollte.
Diese Phase stellt für jeden Lehrer eine besondere Herausforderung
dar. Dabei sollte jeder Pädagoge versuchen, mit den Problemen der
Schüler umzugehen und sie gemeinsam mit ihnen zu bewältigen lernen.
Literaturverzeichnis:
-) Schmidt / Thews.(1995). Physiologie des Menschen. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg.
-) Kracke, B. (1993). Pubertät und Problemverhalten bei Jungen.
Weinheim :Beltz, Psychologie-Verlags-Union.
-) Winkler-Hermaden, S. (1994). Die Sexualität Pubertierender
als pädagogische Herausforderung. Universität Wien
-) Baacke, D. (1994). Die 13- bis 18 jährigen. Beltz Grüne
Reihe.
-) Aschoff, W.(1996). Pubertät. Zürich: Vandenhoeck
und Ruprecht.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
3) Koedukation - pro und kontra (Birgit
Wodaczek)
1. EINLEITUNG
Vorab möchte ich mit einem kurzen historischen Überblick die
Entwicklung der Erziehung/Schule hinsichtlich eines getrennten/gemeinsamen
Unterrichts darstellen. Aufgrund der verfügbaren Literatur erfolgt
dieser Rückblick in Anlehnung an die deutsche Entwicklung, die, wie
ich glaube, auch Parallelen mit dem hiesigen Verlauf aufweist.
Weithin bekannt ist die Tatsache, daß Bildung und wissenschaftliche
Belange die längste Zeit den männlichen Mitgliedern der Gesellschaft
vorbehalten waren, und nur wenige Frauen in diesen Bereich eindringen und
bestehen konnten.
Trotz der Einführung der allgemeinen Schulpflicht Ende des 18.
Jahrhunderts durch Maria Theresia wurde keine gleichwertige Bildung von
Mädchen und Jungen erreicht.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts machten Frauenbewegungen mobil gegen
den Ausschluß von den Universitäten, sie forderten freien Zugang
auch für Frauen.
Um die Zugangsbestimmungen erfüllen zu können war eine Reform
der Mädchenschulbildung, in Richtung wissenschaftlicher Unterricht
von Nöten, da in den damals gebräuchlichen höheren Töchterschulen
das Hauptaugenmerk noch auf Haus- und Handarbeit lag.
Die gewünschte Ausbildung erfolgte zu Beginn nur durch Männer,
da Frauen keine Studien- oder Lehrberechtigung erhalten konnten, was die
weiblichen Schüler wieder nicht zufrieden stellte und die Forderung
nach einer geeigneten Lehrerinnenbildung laut werden ließ.
Eine Forderung von Gertrude BÄUMER (1906.S 160) lautet:
Natürlich muß eines dazu kommen: Das Prinzip der gemischten
Schule darf nicht nur in Bezug auf die Schüler gelten, sondern muß
auch auf den Lehrkörper ausgedehnt werden. Soll die Schule ihr Vorbild,
die Familie, erreichen, so ist es selbstverständlich, daß das
männliche gleichwertig neben dem weiblichen Prinzip vertreten sein
muß, nur dadurch wird Einseitigkeit und die Schädigung einer
Hälfte zugunsten der anderen vermieden. (KREIENBAUM, 1992.S 15ff)
Es waren vorwiegend auf Gleichberechtigung beharrende Frauenrechtlerinnen,
die einen gemeinsamen Unterricht von Mädchen und Jungen anstrebten
um die Anerkennung der intellektuellen Gleichwertigkeit der Geschlechter
zu erreichen.
Um die Jahrhundertwende gab es dann auch die ersten Gymnasialkurse und
koedukative Reformschulen, deren Entwicklung jedoch durch die beiden Weltkriege
gestoppt und zum Teil rückgängig gemacht wurden.
Diese ersten Schritte in Richtung Koedukation basierten auf dem Leitmotiv
der pädagogischen Diskussion des Themas, auf der Ansicht, daß
beide Geschlechter voneinander lernen könnten.
Der gemeinsame Unterricht der komplementären Geschlechter wird
als Mittel betrachtet um die Andersartigkeit gegenseitig fruchtbar zu machen.
STOEHR (1985.S14) sah darin die "Koedukation als Instrument
gegenseitiger Korrektur"
Diese positiven Anfänge wurden jedoch durch den 2. Weltkrieg zunichte
gemacht, denn zur Zeit des Nationalsozialismus hatte Geschlechtertrennung
wieder oberste Priorität.
Der Weg zurück zur Koedukation nach Kriegsende dauerte einige Zeit,
wobei einige höhere Schulen zunehmend koedukativ geführt wurden.
Ende der Sechziger Jahre untersuchte DALE (1969/71) die Auswirkungen
der verschiedenen Schultypen auf die Leistung der Schüler, er fand
heraus, daß sowohl Mädchen als auch Jungen in geschlechtshomogenen
Schulen die besseren Ergebnisse erzielten, was eigentlich gegen die Fortführung
koedukativer Klassen sprechen würde. Jedoch ergaben seine Untersuchungen
auch, daß Jungen mehr von gemischtgeschlechtlichen Schulen profitieren
als Mädchen, welche aber positive zusätzliche soziale Erfahrungen
machten.(KREIENBAUM,1992.S 25)
Obwohl heute größtenteils koedukativ unterrichtet wird, lassen
Erhebungen wie diese die Diskussion um Vor- und Nachteile des gemeinsamen
Unterrichts wieder aufleben, auch heute sind Pädagogen der Ansicht,
daß "... die Verfechter eines undifferenziert-koedukativen Unterrichts
erkennen lassen, daß sie auch den Unterricht - bewußt oder
unbewußt- vorrangig in den Dienst einer Gesellschaftsveränderung
stellen. Dadurch werden die Schüler und ihre persönliche Entfaltung
unzulässigerweise zweitrangig eingestuft"(VkdL,1983.S 4).
Es gibt also auch wieder einen Trend Mädchen und Jungen in einer,
voneinander unberührten Umgebung zu bilden, um ihre Vorzüge und
Talente ungestört erfassen und fördern zu können, ohne Ablenkung
und Diskriminierung.
Ob diese Entwicklung Erfolg haben wird, oder die eisernen Vertreter
der Koedukation sich in allen Bereichen des Unterrichts (auch Leibeserziehung)
durchsetzen werden, ist noch nicht abzusehen.
Der folgende Überblick über Einflußfaktoren, sowie vor-
und nachteilige Entwicklungen aufgrund koedukativen Unterrichts, soll einen
Einblick in die Problematik des Themas vermitteln.
2. BEGRIFFSBESTIMMUNG
Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich den Begriff
Koedukation und vor allem seine Bedeutung klären. Zu diesem Zweck
habe ich Begriffserklärungen verschiedener Autoren herangezogen, sowie
ein Lexikon.
+) Wahrig-Fremdwörterlexikon.(1993).Gütersloh, Bertelsmann
Lexikon Verlag. S 376:
K. = gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen in Schulen und
Internaten;
= Gemeinschaftserziehung
+) Beyer, E.(Hg.)(1987).Wörterbuch der Sportwissenschaften.
Schorndorf, Hoffmann. S. 317:
K.= gemeinsame Erziehung beider Geschlechter
+) Söll, W.(1981).Betrachtungen zum Problem der Koedukation
im Sportunter-richt.Sportunterricht,30(1),S 267
"Ziel der Koedukation bestehe darin, das andere Geschlecht in seiner
Andersartigkeit zu verstehen und zu akzeptieren..."
+) Ricksal 1988 in: Redl, S.(Hg.)(1992).Sport in der Schule. Wien:
ÖBV.S 36.
"Koedukation liegt vor, wenn die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung
von Jungen und Mädchen mehr ist als eine bloße organisatorische
Maßnahme, wenn Lernziele und Lerninhalte, wenn Methoden und Unterrichtsstile
auf die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen eingehen, und ihre
je eigenen Entwicklungen, Prägungen, Defizite und Fähigkeiten
berücksichtigen. Der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen
kann eine Bereicherung sein, wenn er dazu beiträgt, das eigene und
das andere Geschlecht als anders, aber gleichwertig zu erkennen, wenn er
zu mehr Verständnis und Rücksichtnahme erzieht, wenn Einstellungen
korrigiert und verändert werden, wenn neue Verhältnisse erprobt
und erworben werden, wenn Jugendliche in ihrer Geschlechtsidentität
nicht verunsichert, sondern ihnen geholfen wird, zu einer eigenen Identität
zu finden."
Wenngleich sich die sachlich kurzen Erklärungen der Lexika nur
auf die gemeinsame Erziehung ganz allgemein beschränken, so ist aus
den anderen beiden Begriffserklärungen schon mehr zu erfahren.
Erstere bestätigt die natürliche Gegebenheit des Unterschiedes
und fordert aber gleichzeitig auf, diese anzunehmen und nicht die Unterschiede
zu betonen.
Rickal hingegen führt noch deutlicher aus wie er sich die Koedukation
vorstellt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die
gemeinsame Erziehung ganz erfolgreich zu machen, indem Jugendliche eine
eigene Identität erfahren, ohne andere auszuschließen.
3. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE VERHALTENSMUSTER
Ein Blick auf die gesellschaflich geprägten, und durch deren Entwicklung
veränderten Verhaltensmuster beider Geschlechter, ist meiner Ansicht
nach wichtig für das Verständnis der Probleme und Vorzüge
eines gemeinsamen Unterrichts.
Durch das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit kann gleiches
Verhalten unterschiedliche Bedeutung haben, beziehungsweise wird aufgrund
des Geschlechtes eine bestimmte Bedeutung angenommen. Wenngleich man darauf
hinweisen muß, daß es keine Verhaltensweise gibt, die monopolistisch
nur bei männlichen oder weiblichen Menschen vorkommt. Im folgenden
ist zu berücksichtigen, daß nur die auffälligsten Elemente
angeführt sind, die auf eine Vielzahl der Mitglieder einer Gruppe
zutreffen, jedoch Ausnahmen außer Acht lassen.
3.1. Mädchen
Das weibliche Geschlecht kämpft immer noch damit, aus dem stiefmütterlichen
Dasein im Schatten der Männerwelt auszubrechen und seine Qualitäten
ungehindert zur Schau stellen zu können. Mädchen werden von klein
auf, schon durch das Angebot an mädchen-spezifischem Spielzeug, an
die Frauenrolle herangeführt, es dominieren sozialerzieherische Spielwelten.
Auch hinsichtlich der Konfliktlösung und Aggression werden Mädchen
schon früh darauf hin trainiert Wutausbrüche zu unterdrücken
und Streit diplomatisch, verbal zu lösen.
Der Interaktionsstil der Mädchen ist bilateral, sie versuchen ihre
Interessen einzubringen und die gemeinsame Aktion aufrechtzuerhalten.
Die Taktik der Beeinflussung kann jedoch nur bis zum Schulalter mit
allen Spielkameraden erfolgreich eingesetzt werden, da ab dann vornehmlich
die männlichen Spielpartner seltener auf freundliche Vorschläge
eingehen, Mädchen ziehen sich aus Situationen, in denen sie sich nicht
durchsetzen können, zurück.(KREIENBAUM,1992.S 43 ff)
Dieses Verhalten zieht eine erste Distanzierung zum anderen Geschlecht
nach sich.
Aber auch von den Lehrern werden Schülerinnen durch geschlechtsstereotype
Vorstellungen beurteilt. Mädchen gelten als fleißig, ordentlich
und angepaßt, sowie diszipliniert im Verhalten. Durch diese eher
farblosen Eigenschaften, die ihnen zugeordnet werden, gelten sie nebenbei
noch als langweilig, und in gewissem Alter auch als typisch "zickig". (KREIENBAUM,1992.S
54 ff)
Sue Lees (1986) verweist auf die Ehrgeizigkeit der Mädchen, die
unter einer Zurücksetzung seitens der Lehrer leiden, aber dem nichts
entgegenzusetzen haben um ihre Leistung zu offenbaren. Sie ortet bei Mädchen
eine zunehmende Tendenz zur Aggression, und zum Versuch durch Hervorheben
der Weiblichkeit und Sexualität Aufmerksamkeit zu erregen.
Da sie erleben, daß ihre Interessen von Lehrern selten wahrgenommen
werden, verlieren viele bald das Interesse an dem Fach, da sie sich übergangen
fühlen, oder glauben ganz einfach keine Begabung auf diesem Gebiet
zu haben. Diese ungerechte Behandlung seitens der Lehrer vermittelt den
Mädchen immer wieder, daß sie weniger wert sind als die männlichen
Kollegen. Durch diese unterschwelligen Vorkommnisse, die zumeist unbewußt
erzeugt werden, leidet das Selbstbewußtsein und Mädchen suchen
daher nach SCHUCH/HOFMANN
(1979.S 18) folgende Gründe für Erfolg und Mißerfolg:
"Zur Aufrechterhaltung des Rollenstereotyps und der Weiblichkeit, haben
Mädchen eine Mißerfolgserwartung: erwartungskonsistente Ergebnisse
(Erfolg) werden variablen Größen zugeschrieben. Da aber nur
Fähigkeitsattribuierungen bei Erfolg, hinsichtlich zukünftiger
Leistungen die Erwartung in positivem Sinne verändert, bleibt das
Erwartungsniveau niedrig und wirkt stabilisierend auf das Selbstwertgefühl
ein."
Nur durch eine höhere Selbsteinschätzung kann jedoch die Wahrscheinlichkeit
zum Erfolg gesteigert werden.
Das Selbstbewußtsein fehlt vielen Mädchen auch in Bezug auf
Auseinandersetzungen mit Jungen, wobei sie oft Rückzieher machen,
da sie es selten gelernt haben einem kämpferischen Angriff zu widerstehen.
Diese Unterwerfung oder Flucht aus der Situation bedeutet eine erneute
Erniedrigung und Fügung in das vorgegebene Rollenbild.
Diese Vorgaben werden maßgeblich durch die "Sozialisatoren", Mutter,
Vater, später auch der Lehrer, geprägt, welche auch bei vorsätzlicher
Gleichbehandlung und Erziehung zur Durchsetzungsfähigkeit durch ihr
gelebtes Vorbild alle Bemühungen zunichte machen können.
Aus dieser Auflistung ist ersichtlich, daß immer noch der Mythos
vom "schwachen Geschlecht" vorherrscht und in der Gesellschaft tief verankert
ist, wenngleich ich einräumen möchte, daß seit der Generation
meiner Großmutter und der meinigen sich einiges zum positiven verändert
hat, und die Frauen und Mädchen heutzutage schon viel stärker
sein dürfen.
3.2. Jungen
Die Schulung der richtigen Verhaltensweisen beginnt auch bei männlichen
Kindern schon in jungen Jahren, wo ein "rough and tumble playstyle" sich
an Wettbewerb und Dominanz orientiert.(KREIENBAUM,1992.S 43)
Technikinteresse und -kompetenz wird mit dem passenden Spielzeug angeeignet,
ebenso die Streitkultur in fiktiven, abenteuerlichen Umgebungen, wo Gut
gegen Böse mit geeigneten Waffen kämpft, bis einer übrigbleibt.
Unter anderem bereiten diese Spiele die Jungen darauf vor auch in der Realität
mit allen möglichen kämpferischen Mitteln bis zur Entscheidung
zu gelangen, wobei sie dem gesellschaftlichen Zwang unterstehen gewinnen
zu müssen.
Sie lernen ihre Stellung in der Gesellschaft durch die Dominanz des
Männlichen in vielen Bereichen des Lebens kennen, und damit auch,
daß sie gewisse Vorrechte haben, aber auch Pflichten. Diesem "besser
sein müssen", zumindest gegenüber dem weiblichen Geschlecht,
aber auch durch die Konkurrenz im eigenen Lager, sind Jungen auch in der
Schule ausgesetzt, wo sie dadurch Nachdruck verleihen, daß sie Teilnahme
und Interesse der Mädchen am Unterricht stören, um den Mädchen
keine Chance zum Leistungsvergleich zu geben.
Vom Lehrer werden Jungen zunächst als klug, phantasievoll, kreativ,
aber auch faul und chaotisch gesehen. Auch ruhigere Jungen erlangen generell
früher die Aufmerksamkeit des Lehrers als Mädchen.
" Wenn Jungen nicht bekommen was sie wollen, dann neigen viele von ihnen
zu unkooperativem Verhalten, und in einer sexistischen Gesellschaft äußert
sich diese mangelnde Kooperation oft auf sexistische Weise. In einer Gesellschaft,
in der von Männern erwartet wird aggressiv, herrisch, energisch und
despotisch aufzutreten, tun Jungen gewissermaßen nur das, was von
ihnen erwartet wird, wenn sie ihre Proteste in aggressiver Weise vorbringen"
(SPENDER,1985.in:KREIENBAUM, 1992.S 42ff).
Aufgrund der vermehrten Aufmerksamkeit des Lehrers gelingt es den Jungen
auch mit Störaktionen das Unterrichtsgeschehen und die -inhalte zu
beeinflussen.
In Hinsicht auf die Leistungserwartung ist zu sagen, daß Jungen
Mißerfolge auf externale Faktoren zurückführen, Erfolge
aber ganz für sich verbuchen, in dem sie ihre Erwartungen in Richtung
Erfolg ausrichten und ihn der eigenen Intelligenz und ihren Fähigkeiten
zuschreiben.
Ganz allgemein gesehen stellen sich Jungen wesentlich selbstbewußter
dar als Mädchen, andererseits müssen sie ständig danach
trachten nicht in Stolz und Ehre verletzt zu werden, und daher Mittel und
Wege benutzen, die nicht allgemein förderlich sind.
3.3. LehrerInnen
Das Verhalten der LehrerInnen gegenüber der SchülerInnen kann
man auch nicht geschlechtsneutral bezeichnen, männliche Lehrer wirken
anders auf gleichgeschlechtliche Schüler wie auf Mädchen, und
umgekehrt kämpfen weibliche Lehrer bei Mädchen mit anderen Problemen
als bei Jungen.
Generell kann man sagen. daß von Seiten der LehrerInnen gleichermaßen
sogenannte "heimliche Lernziele der Geschlechtererziehung" oft unbewußt
verfolgt werden. Nach A.PRENGEL (1986. in: KREIENBAUM, 1992.S 27)stellen
sich diese folgendermaßen dar:
"Die im Unterricht und in den Pausen innerhalb institutioneller Lehrpläne
und Erlasse real stattfindenden Interaktionen, und die in den Lehrmitteln
neben offiziellen Themen und Stoffen "zwischen den Zeilen" transportierten
Botschaften, bilden zusammen das dichte und hochwirksame Geflecht einer
anderen Realität. Im heimlichen Lehrplan lernen Mädchen von Jungen
kognitiv, aber vor allem auch emotional und physisch durch die reale Prägung
des gelebten Schullebens, daß Frauen und Männer nicht gleichwertig
sind, sondern, daß ihr Verhalten ein von Unter- und Überordnung
geprägtes, hierarchisches Verhältnis ist."
Eine weitere Ungerechtigkeit widerfährt den, vor allem weiblichen
Schülern durch die ungleichmäßige Verteilung der Aufmerksamkeit
der Lehrer, wonach den Mädchen nur 1/3 der Zeit gewidmet wird im Gegensatz
zu den Jungen. Mädchen werden zu 15% weniger oft aufgerufen und nur
halb sooft gelobt wie Jungen. Ebenso erfolgt eine Rückmeldung zur
Leistung bei Mädchen seltener, und wenn überhaupt, dann häufiger
zu schlechten Beiträgen.
Jungen wird es auch leichter gemacht das Interesse der Lehrer zu wecken,
für Ansprüche der Schülerinnen sind LehrerInnen weniger
leicht zu interessieren.
Wie bereits erwähnt können Jungen durch ihr Verhalten während
des Unterrichts auch die Stoffauswahl und das Lerntempo beeinflussen, sie
stellen ihre Interessen in den Mittelpunkt und verhindern damit oft eine
"weiblichere" Sichtweise.
Auch für den zukünftigen Weg der SchülerInnen haben LehrerInnen
eine Prognose parat: während für Mädchen nicht allzu wichtige
Jobs und vor allem die Familiengründung vorausgesagt wird, sehen sie
die Jungen, je nach Leistung, in mehr oder weniger lukrativen Berufen und
führenden Positionen, ohne familiäre Verpflichtung.
Mit SchülerInnen wird ständig unter Ansehen des Geschlechtes
kommuniziert, die Unterschiede manifestieren sich auch schon in kleinen
Dingen wie geschlechtsgetrennten Namenslisten, oder unterschiedlichen LehrerInnen-Hilfsdiensten
wo Mädchen saubere Arbeiten wie das Führen des Klassenbuches
erhalten, und Jungen für Videogeräte und ähnliches zuständig
sind.
Diese ungleiche Behandlung kann nicht nur einem Geschlecht zugeordnet
werden, männliche, wie weibliche Lehrkräfte handeln hier größtenteils
unbewußt, auch kann man nicht davon ausgehen, daß dieses Verhalten
eine bestimmte Generation betrifft. Es wäre jedoch wünschenswert
sie darauf aufmerksam zu machen, und diese Mißstände zu beseitigen.
4. PRO KOEDUKATION
Für die Koedukation in der Schule spricht das Bestreben nach Gleichberechtigung
der Geschlechter in allen Bereichen, wobei zu beachten ist, daß angelernte
Verhaltensmuster von LehrerIn und SchülerIn auf die neue Situation
eingestellt, und zum Teil revidiert werden müssen.
Dieses Vorhaben verlangt ein gemeinsames Unterrichtskonzept, das Gemeinsamkeiten
wie Unterschiede von Mädchen und Jungen fruchtbar macht.
Der Grundgedanke der Koedukation ist auch heute noch darin begründet,
daß Mädchen und Jungen voneinander lernen sollen, jedes Geschlecht
Schwächen und Besonderheiten des anderen sinnvoll ergänzt. Nicht
das Gegeneinander, der Kampf um Anerkennung soll im Vordergrund stehen,
sondern das gemeinsame Lösen der gestellten Aufgaben unter Zuhilfenahme
aller Qualitäten ist das Ziel.
Dafür genügt es nicht Mädchen und Jungen nebeneinander,
koinstruktiv, zu unterrichten, sondern beide Gruppen müssen für
die jeweils andere sensibilisiert werden.
Um eine möglichst gute Basis für dieses Vorhaben zu schaffen,
ist ein früher Start der Koedukation wünschenswert, da jüngere
SchülerInnen noch weniger durch die Geschlechtsrollenentwicklung beeinflußt
sind.(K.KLEINER,1992.S 47)
Koedukation ermöglicht im gemeinsamen Unterricht von Mädchen
und Jungen, anders nicht erreichbare pädagogische Zielsetzungen zu
verwirklichen, die sich auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander,
und das geschlechtsspezifische Selbstverständnis beziehen.(BRODTMANN,1979.S
158)
Der SchülerIn muß sich durch Koedukation langfristigen gesellschaftlichen
Entwicklungen anpassen, dadurch wird es möglich Widersprüche
und Diskrepanzen zwischen dem schulischen und außerschulischen Leben
zu beseitigen. Die Kinder werden durch den täglichen Umgang mit Andersgeschlechtlichen,
im Umgang mit ihnen geschult und auf die Situation nach der Schule vorbereitet.
Es gilt auch nicht die Ausrede der LehrerInnen, daß eine dermaßen
inhomogene Klasse schwerer zu führen sei, da auch in geschlechtshomogenen
Klassen eine Leistungsheterogenität vorhanden ist, die durch einen
differenzierenden Unterricht ausgeglichen werden sollte.
Es muß für alle verständlich werden, daß die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen (außer den biologischen Faktoren)
eine Folge gesellschaftlicher Normen sind, und nicht natürlich gegeben.
Aber nicht nur in Bezug auf kognitiv orientierte Fächer ist Koedukation
wünschenswert, auch in der Leibeserziehung stehen nur wenige Hindernisse
im Weg. Die motorische Lernfähigkeit ist bei Mädchen und Jungen
gleich, lediglich die Beweglichkeit ist bei Mädchen besser ausgeprägt,
bei den Jungen steigt die Kraft in der Pubertät mehr an. Die Differenzen
der Leistungsfähigkeit sind demnach in der unterschiedlichen Sozialisation
zu suchen. (K.KLEINER,1992.S41)
5. CONTRA KOEDUKTION
Gegner des gemischtgeschlechtlichen Unterrichts sehen die jeweiligen
Vorzüge und Begabungen durch die Koedukation gefährdet.
Betrachtet man die Untersuchung von Dale Ende der sechziger Jahre,
so müßte man den Mädchenschulvertretern recht geben, andererseits
stellt sich die Frage, ob diese Abkapselung von der Realität wünschenswert
ist, und der Vorbereitung späterer gemeinsamer Arbeitsteilung und
Lebensgestaltung dienlich ist.
In geschlechtshomogenen Schulen können aber wiederum ungerechte
Verhaltensweisen der LehrerInnen minimiert werden, da sich zum Beispiel
bei einer Mädchenklasse die Aufmerksamkeit auf alle Schülerinnen
richtet, und diese nicht durch Störungen von Jungen beeinträchtigt
werden. Ist auch noch ein ausgewogenes Verhältnis im LehrerInnenkollegium
vorhanden, kann man annehmen, daß auch der Unterrichtsstoff von verschiedenen
Seiten beleuchtet wird.
Von Gegnern wird auch angeführt, daß Jungen und Mädchen
anders lernen, und sich in affektiven und emotionalen Bereichen unterscheiden.
Frauen sind demnach für Arbeiten, die besondere Geschicklichkeit,
Geduld und Konzentration erfordern besser geeignet als Männer. Frauen
kämen in koedukativem Unterricht zu kurz und würden nur lernen,
daß sie weniger wert seien als die männlichen Kollegen, sie
werden mit ihren Schwächen konfrontiert, Jungen mit ihren Stärken.
Durch die Aufhebung der geschlechtsspezifischen Differenzierung, zum
Beispiel im Sport, ist die Geschlechtsidentifikation gefährdet (moralisch
bedenklich), was möglicherweise die kindliche Entwicklung beeinträchtigt.
Außerdem wird von Gegnern des koedukativen Turnunterrichtes die
unterschiedliche Entwicklung der motorischen Grundeigenschaften und Bewegungsfertigkeiten
bei Mädchen und Jungen ins Treffen geführt, denen man im Rahmen
des Unterrichts gerecht werden muß.(Redl,S.1992.S 41)
Es ist also ersichtlich, daß hier die überzeugten Geschlechtshomogenitäts-Vertreter
auf die gesellschaftlichen Verhaltensmuster vertrauen und diese durch den
getrennten Unterricht weiterverfolgen und ausbauen wollen.
Eine Frage stellt sich aber doch auch in Bezug auf die Zukunft, wo ich
keine klare Aussage finden konnte, die das Leben nach der Schule beschreibt.
Es ist klar, daß die SchülerInnen nicht in einer völlig
geschützten Umgebung aufwachsen, und in ihrer Freizeit mitunter die
Erfahrungen machen können, die in der Schule fehlen, aber dennoch
passiert das unter anderen Bedingungen.
RESÜMEE
Ich möchte mich an dieser Stelle als Befürworterin der Koedukation
deklarieren, vornehmlich wegen dem Hauptargument, daß beide Geschlechter
voneinander lernen und profitieren können. Dieser Prozeß, der
sich durch die Aspekte des sozialen Lernens und der Sozialerziehung manifestiert
ist ein wichtiger Beitrag, der zu einem geänderten Wertverständnis
aller menschlichen Individuen führen könnte. Soziale Lernimpulse
sollen zum Erwerb sozialer Kompetenz, in Anbetracht auf andere Subjekte
bezogenes Handeln, führen.
Durch die ständige Konfrontation mit den jeweils anderen Verhaltensweisen
kann es, mit Hilfe des gleichbehandelnden Lehrers zu einem Ausgleich kommen.
Warum soll nicht auch ein Junge nähen lernen und Stoffe entwerfen,
ebenso wichtig wäre es, daß Mädchen mit Hammer und Zange
umgehen können.
Ich finde es wichtig möglichst jede Begabung zum Vorschein zu bringen
und zu unterstützen, bei beiden Geschlechtern, ungeachtet gesellschaftlicher
Normen und Wertvorstellungen. Aber auch Erfolge von Jungen und Mädchen
müssen gleich bewertet (nach Können) und anerkannt werden. Ich
trete nicht für eine vollständige Beseitigung der Unterschiede
zwischen Mann und Frau ein, denke aber, daß diese verständlich
und begreifbar gemacht werden sollten, und das am besten durch die Konfrontation
mit ihnen.
Literatur
BEYER, E. (1987).Wörterbuch der Sportwissenschaft. Schorndorf,
Hoffmann. S 317.
BRODTMANN,D. (1979).Sportunterricht und Schulsport. Heilbronn: Klinkhardt.
KLEINER, K. (1992).Koedukation im motorischen Unterrichtsfach. In: Sport
in der Schule. Wien: ÖBV.
KREIENBAUM, M.A. (1992). Erfahrungsfeld Schule: Koedukation als Kristallisationspunkt.
Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
REDL,S.(Hg.)(1992).Sport in der Schule. Wien: ÖBV.
RICKAL,E.(1988).in: Sport in der Schule.Wien,ÖBV.114.
SÖLL,W.(1981).Betrachtungen zum Problem der Koedukation im Sportunterricht.Sportunterricht,30(1),S
267.
WAHRIG-FREMDWÖRTERLEXIKON.(1993).Gütersloh, Bertelsmann. S
376.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
4) Werthaltungen der heutigen Jugend (Markus
Gonaus)
Einleitende Bemerkung:
Aktuelles Datenmaterial gibt es zwar, ist aber leider nicht in Buchform
zusammengefaßt und ausgewertet veröffentlicht. Zur Ausforschung
von aktuellen Daten in (Fach) Zeitschriften fehlte mir die Zeit. Da es
anders als in der Chemie z.B. die CA keinen Gesamtindex über sämtliche
Publikationen des Faches gibt ist die entsprechende Suche auch überproportional
aufwendig. Ich habe sie deshalb unterlassen.
Entsprechende Erhebungen werden zwar auch immer wieder in den diversen
Tageszeitungen bzw. politischen Wochenmagazinen veröffentlicht, aber
diese wollen genauso wie die Institute die professionell diese Datenerfassung
betreiben Geld - und das gar nicht so wenig - sehen bevor man die gut indizierten
Archive nutzen kann. Die Daten und Studien auf die ich mich beziehe sind
daher bereits ein wenig historisch, aber für das was ich hier in diesem
Referat vortragen möchte völlig ausreichend. Im wesentlichen
sind es folgende Punkte, die ich kurz ansprechen will.
-
Mögliche Bedeutung derartiger empirische Studien für in sozialen
Berufen Tätige (exemplarisch)
-
Für (meine) politische Arbeit interessante Aspekte
-
Was und über wen sagen solche Studien wirklich etwas aus
ad 1.) Immer wieder gibt es spektakuläre Fälle von Gewaltverbrechen,
ausgeführt von Jugendlichen, und mit schöner Regelmäßigkeit
fragt sich ganz Österreich, wird die Jugend gewalttätiger? Und
die einzig richtige Antwort auf diese Frage nicht zur Kenntnis nehmend,
sofort: Woran liegt es denn? Natürlich eignen sich solche spektakulären
Vorfälle zwar als spektakulärer Einstieg, aber für die Betrachtung,
was kann ich daraus für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen lernen,
völlig unbrauchbar.
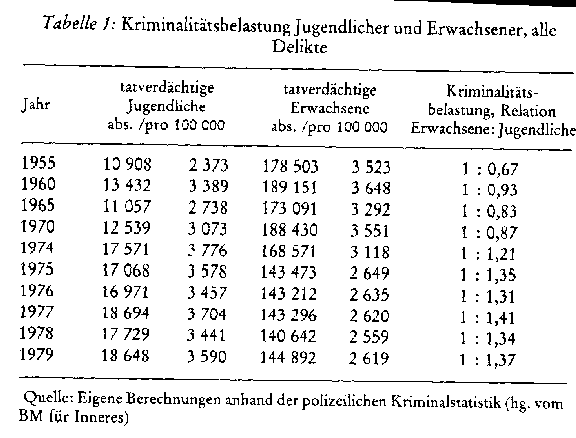
(Tabelle aus/Jugend zu Beginn der achtziger Jahre- Österr. Jugendbericht
1, Österr. Institut f. Jugendkunde, im J&V Verlag)
Was ist nun in so einer Datenreihe sichtbar. Zuerst einmal offensichtliches.
Durch die Jahrzehnte praktisch konstante Jugendkriminalität. Sinkende
Zahlen bei den Erwachsenen.
Auch die Schlußfolgerung, die man nach Aufgliederung nach Schwere
der Delikte gezogen wird, daß je näher man zur Gegenwart kommt
immer mehr Bagatelldelikte angezeigt werden, wird wohl in diesem Raum niemanden
wirklich neu vorkommen. Was aber durchaus interessant ist, und für
jemanden der einen sozialen Beruf anstrebt durchaus Bedeutend ist, ist
die Frage, wie hat man sich im Laufe dieser Zeit kriminelles Verhalten
erklärt, wie ist man damit umgegangen, und kann man das vielleicht
mit diesen oder anderen Zahlen korrelieren?
Bis zu den frühen fünfziger Jahren hat man Jugendkriminalität
vorwiegend als ein Mangelsymptom angesehen. Als in den späten 50ern
bei steigendem Wohlstand die Kriminalität konstant blieb, hat man
angefangen nach psychischen oder psychosozialen Besonderheiten bei den
Straffälligen zu suchen. In den sechziger Jahren begann dann einerseits
das Resozialisierungskonzept Platz zu greifen (Bewährungshilfe), andererseits
begann erstmals eine differenzierte Betrachtung des Phänomens der
Jugendkriminalität. Da nämlich die Zahl der Gewaltverbrechen
bei Jugendlichen stark sank, bei gleichzeitig steigender Zahl der Jugenddelinquenz,
kommt ein Konzept auf, daß Jugendkriminalität als eine normale
Entwicklungserscheinung ansieht, die mit den normalen Reifungsvorgängen
im Alter von 14 bis 25 in engem Zusammenhang steht. Eine Periode des sozialen
Experimentierens, wo es auch öfter zu fehlgriffen kommt. Bezeichnend
ist, daß diese Ansicht über 20 Jahre Reifezeit gebraucht hat,
bis sie in den praktischen Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen
Einzug gehalten hat. Der außergerichtliche Tatausgleich ist erst
vor wenigen Jahren eingeführt worden.
Was können wir daraus für unsere Arbeit mit Jugendlichen lernen?
In erster Linie beruhigendes. Wenn einer unserer Schüler eine kriminelle
Kariere einschlägt, so ist das nicht notwendigerweise unsere Verantwortlichkeit.
Zweitens: Wir sind gefordert, unseren Teil dazu beizutragen, daß
dieses soziale Experimentieren in einer Art und Weise stattfinden kann,
in der die Folgen tragbar bleiben.
Es gibt aber auch viel trivialere Daten, die im täglichen Berufsleben
eines Lehrers durchaus bedeutend sind.

(Tabellen aus/Jugend zu Beginn der achtziger Jahre- Österr. Jugendbericht
1, Österr. Institut f. Jugendkunde, im J&V Verlag)
Wenn man sich die Zahl der Zeitungsleser ansieht, hat man einen Eindruck
davon, von welchem Vorwissen man ausgehen kann, wenn man politische Bildung
(Unterrichtsprinzip) betreibt.
ad2) Wer hat nicht die berühmt gewordenen Ausdrücke von der
68er Generation, oder von der Generation-X gehört. Es ist - so finde
ich - durchaus wert einen Blick darauf zu werfen, was denn tatsächlich
hinter solchen Schlagworten steckt. Tatsächlich scheint es so etwas
wie eine Wellenförmige Entwicklung von angepaßter und revolutionärer
Jugend zu geben.
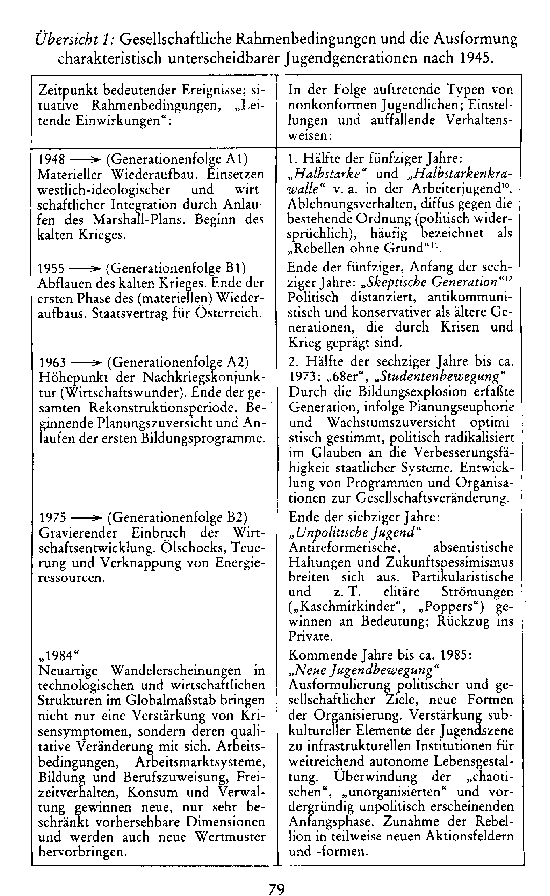
Tatsächlich scheint es so etwas wie eine Generationenfolge in der
Jugendkultur zu geben.
Generation als ein bestimmtes Verhältnis der Gleichzeitigkeit
von Individuen: Diejenigen, welche in den Jahren der Empfänglichkeit
dieselben leitenden Einwirkungen erfahren, machen eine Generation aus (Josef
Hochgerner Politik und politische Beteiligung/Jugend zu Beginn der achtziger
Jahre- Österr. Jugendbericht 1, Österr. Institut f. Jugendkunde,
im J&V Verlag)
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die oft gehörte
Behauptung, daß die Jugend generell gegen die Elterngeneration revoltiert,
es also eine Art tradierten Generationenkonflikt gibt, falsch ist. Ganz
im Gegenteil. Die politischen Grundwerte werden in überraschend hohem
Ausmaß von der Elterngeneration übernommen. Faktum ist, daß
diese Jugendgenerationen immer nur von einem relativ kleinen Teil (10 -
15%) der jugendl. Bevölkerung getragen wird.
Für mich als Funktionär einer Partei heißt das: Mein
Wählerpotential zu entwickeln oder zu verspielen, ist eine Aufgabe,
die mehrere Menschenleben dauert. Meine Aktivistinnen zu rekrutieren, da
muß ich aber in regelmäßigen Abständen meine Methoden
an die aktuellen Tendenzen anpassen. (eher über Vorfeldorganisationen
/ oder direkt als Partei)
ad3) Empirische Studien können fürchterlich manipulativ sein.
Das fangt an damit, daß praktisch immer exakte Angaben über
Grundgesamtheit, Art und Größe der Stichprobe, Varianz,... fehlen.
Daß sich damit nicht überprüfen läßt, welche
Relevanz derartige Studien und daraus gewonnene Aussagen sind, ist noch
das geringste was da passiert. Im folgenden ein paar schöne Beispiele.
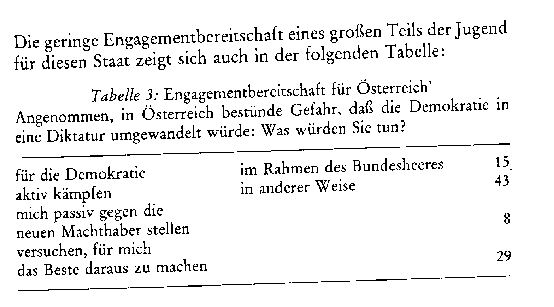
(Tabelle aus/Jugend zu Beginn der achtziger Jahre- Österr. Jugendbericht
1, Österr. Institut f. Jugendkunde, im J&V Verlag)
Was sagen uns solche Kommentare? Wohl doch mehr über die Geisteshaltung
des Autors, als über die Österreichische Jugend.
Zum Abschluß gebe ich hier noch die aktuellen Megatrends an, wie
sie einerseits regelmäßig in diversen Medien zu lesen sind,
andererseits im Buch "Wartezeit Studien zu den Lebensverhältnissen
Jugendlicher in Österreich, Herbert Janig, Bernhard Rathmayr 1994
Österreichischer Studienverlag" zusammengefaßt.
Jugend als Ausbildungssituation und Abhängigkeit von den Eltern
definiert, ist eine Lebensphase die sich zunehmend verlängert. Individualisierung
ist nach wie vor der vorherrschende Megatrend, d.h. Werte aus der Privatsphäre
(Familie, Freizeit, Freunde,...) stehen viel höher in der Gunst als
alle Institutionen (Religion, Politik,...). Die Lebenswelt von Jugendlichen
und Erwachsenen ist zwar nicht mehr räumlich getrennt, aber es ist
ein nebeneinander und kein miteinander, daraus resultieren Konflikte. Die
Emanzipation der Frauen beschränkt sich nach wie vor auf den Bildungsbereich,
Arbeitswelt oder gar privates Umfeld sind patriarchalisch wie eh und je....Bei
den Lehrlingen halten sich jene die Ausgebildet werden mit jenen die Ausgebeutet
werden die Waage. Trotz zunehmenden Angebotes bleibt der prozentuelle Anteil
der Drogenkonsumenten konstant - paradoxerweise übertitelt die Autorin
dieser Studie Irmgard Eisenbach Stangel dies als neue Nüchternheit.
Computer üben nach wie vor vorwiegend auf männliche Jugendliche
eine hohe Faszination aus, vorwiegend wird gespielt.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
5) Sekten und Schule (Thomas Pleyer)
Was sie über Sekten wissen sollten!
1. Hintergrund und rechtliche Situation
1.1 Was ist eine "Sekte"?
Der Begriff "Sekte" wird heute umgangssprachlich oft als Sammelbegriff
für religiöse und pseudo-religiöse Gruppen, Psychokulte
oder Guru-Bewegungen verwendet, die nicht zu den staatlich anerkannten
Religionsgemeinschaften gehören.
1.2. Wodurch lassen sich diese Gruppen
und Organisationen charakterisieren?
- die Geschlossenheit der Gesellschaft, die klaren Grenzen zwischen
Anhängern und Außenstehenden, die normierte Lebenspraxis im
Inneren;
- die abseitigen und/oder kulturell fremden Ideen, die nicht vermittelbaren
Glaubenswelten und Lebensorientierungen, die fanatisch vertreten werden;
- die Konflikte mit der Umwelt, vor allem persönliche Konflikte
mit Angehörigen von Mitgliedern und juristische Konflikte mit Behörden;
- die Abhängigkeit der Mitglieder von einer charismatischen Führungsfigur
bzw. von einer Hierarchie, die Lehre und Praxis autoritär bestimmen.
Die Merkmale sind aber nur dann relevant, wenn mehrere von ihnen zusammentreffen.
In der heutigen Zeit werden mit dem Negativ-Begriff "Sekte" oft vollkommen
unterschiedliche Gruppen als mehr oder minder gleich "gefährlich"
qualifiziert. Dieses Pauschalurteil ist natürlich unzutreffend, und
es ist eine differenziertere Betrachtungsweise notwendig. Deswegen spricht
man auch immer häufiger von "Weltanschauungsgruppen".
1.3. Rechtlicher Rahmen für Religionsgemeinschaften
Wichtige Grundlagen unserer staatlichen Rechtsordnung sind das demokratische
Prinzip und das Prinzip der religiösen Neutralität. Das demokratische
Prinzip bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die Rechtsstellung von
Kirchen von der staatlichen Rechtsordnung abzuleiten ist. Das Prinzip der
religiösen Neutralität verbietet es dem Staat, sich mit einer
oder mehreren bestimmten Kirchen oder Religionsgemeinschaften zu solidarisieren.
Im Artikel 15 des Staatsgrundgesetz steht geschrieben: "Jede gesetzlich
anerkannte Kirche und Religionsgemeinschaft hat das Recht der gemeinsamen
öffentlichen Religionsausübung, ordnet und verwaltet ihre inneren
Angelegenheiten selbständig, ... ist aber, wie jede Gesellschaft,
den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen. D. h.: Das Grundgesetz bezieht
sich nur auf die "gesetzlich anerkannten" Religionsgemeinschaften. Allen
anderen Gemeinschaften ist die sogenannte "häusliche Religionsausübung"
gestatten, "insoferne diese weder rechstwidrig noch sittenverletzend ist".
1.4. Wer als Religionsgemeinschaft
gesetzlich anerkannt ist
Eine Vereinigung, die gesetzlich anerkannt werden will, muß auf
Basis des Gesetzes verschiedene Kriterien wie folgt erfüllen:
- eine Mehrheit von Gläubigen, wobei die Praxis darunter mindestens
2000 Anhänger versteht
- einen positiven Gottesglauben
- eine definierte Glaubensquelle oder -lehre, die sich von bisher anerkannten
Gruppen unterscheiden muß
- eindeutige innere Regeln, eine "Verfassung", die nichts Gesetzwidriges
oder "sittlich Anstößiges" enthalten darf und
- die wirtschaftliche und personelle Fähigkeit, wenigstens eine
Kultusgemeinde zu errichten und zu erhalten.
Es gibt heute zwölf Kirchen und Religionsgemeinschaften, die
diese Kriterien erfüllen:
* die katholische Kirche * die evangelische Kirche
* die griechisch-orientalische Kirche * die altkatholische Kirche
* die armenisch-apostolische Kirche * die neuapostoliche Kirche
* die mormonische Kirche * die Methodistenkirche
* die israelitische Religionsgemeinschaft * die buddhistische Religionsgemeinschaft
* die mormonische Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
* der Islam
1.5. Was die staatliche Anerkennung
bedeutet
- Die staatliche Anerkennung bedeutet für Religionsgemeinschaften,
daß sie über einen verfassungsrechtlich geschützten Freiraum
innerer Autonomie verfügen. Sie erhalten dadurch die Freiheit, ihre
eigene Religion auch öffentlich und gemeinsam auszuüben.
- Sie bestimmen das Mitgliedschaftsrecht, die Bestellung der Seelsorger
oder die Glaubenslehre selbst.
- Weiters werden Anhänger einer anerkannten Religionsgemeinschaft
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zusammengeschlossen,
die im öffentlichen Interesse ihre Aufgaben erfüllen, und daher
nur dort steuerpflichtig sind, wo sie mit Wirtschaftsunternehmen in Konkurrenz
treten können.
- Nicht anerkannte Gruppierungen haben daher auch ein klares materielles
Interesse an ihrer Anerkennung: Wer etwa mit Seminaren, Kursen oder Zeitschriften
hohe Umsätze erzielt, kann im Fall einer Anerkennung auf seine religiöse
Tätigkeit hinweisen - und muß jene Steuern nicht zahlen, die
für eine gewerbliche Betätigung normalerweise zu zahlen wären.
- Die Absetzbarkeit der Mitglieds-(Kirche-)Beiträge bei der Lohn-
und Einkommenssteuer gilt nur für Mitglieder gesetzlich anerkannter
Religionsgemeinschaften.
- Weiters erhalten gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religionsgemeinschaften
leichter das Öffentlichkeitsrecht für ihre Privatschulen.
Organisationen, die nicht als gesetzliche Religionsgemeinschaften anerkannt
werden oder anerkannt werden wollen, haben sich als Vereine mit dem Anspruch
auf Gemeinnützigkeit konstituiert. Damit ist es auch für scheinreligiöse
Gruppen möglich, in der großen Zahl der gemeinnützigen
Vereine "unterzutauchen" und so z.B. ihre eigentlichen wirtschaftlichen
Interessen zu verschleiern.
Vorteil: Bei registrierten Vereinen ist es relativ leicht möglich,
über die Vereinsbehörden bei den Polizeidirektionen oder Bezirkshauptmannschaften
die Namen und Adressen der verantwortlichen Personen herauszufinden oder
in die Satzungen Einblick zu nehmen. Dies ist oft der erste Schritt dazu,
um Rechtsansprüche gegen "Sekten" oder sektenähnliche Vereinigungen
durchzusetzen.
1.6. Wer sich angesprochen fühlen
kann
Weit verbreitet ist zunächst die Ansicht, daß nur "schwache"
oder "labile" Menschen gefährdet sein könnten. In Wirklichkeit
ist dies aber anders, denn vor allem idealistische und reflektiert lebende
Menschen interessieren sich oftmals für neue Sinn-Anbieter.
Experten meinen, daß generell Menschen, die vor wichtigen Lebens-Entscheidungen
stehen, potentielle Adressaten dieser Gruppierungen sind. Personen, die
über eine gefestigte Lebenseinstellung verfügen, sind im Gegenzug
weniger "anfällig". Junge Menschen gelten deshalb als gefährdet,
weil sie in den Jahren der Pubertät und der Adoleszenz wichtige Weichen
für ihr Leben stellen müssen.
Interesse für solche Sinn-Anbieter können Menschen unterschiedlichen
Alters sein:
* Erwachsene, die hohen Anforderungen in Beruf und Privatleben ausgesetzt
sind;
* Menschen, die gesellschaftliche Gefahren wie Drogenmißbrauch,
Umweltzerstörung oder Gewalt nicht tatenlos hinnehmen wollen.
Ob und in welcher Form man diese Angebote wahrnimmt, hängt von
verschiedenen persönlichen und externen Umständen ab. Das können
z.B. folgende Faktoren sein:
- das Gefühl der Einsamkeit und das Bedürfnis nach Freunden
oder einer Gruppe, zu der man dazu gehören kann;
- Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben und das Gefühl, unbefriedigt
zu sein;
- das Leiden unter Mißerfolgen in Schule und Beruf;
- ein starker Leistungsdruck, den man auf Dauer nicht mehr auszuhalten
glaubt;
- das Gefühl, daß eigene Leistungen nicht anerkannt werden;
- der Wunsch nach (mehr) Zuwendung und Geborgenheit;
- Enttäuschung durch eine zerbrochene Bindung im privaten Bereich;
- das Problem, als Jugendlicher Schwierigkeiten mit der Ablösung
von den Eltern zu haben;
- der Wunsch nach einer neuen Elternfigur oder Bezugsperson;
- die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, die zum Wunsch
führt, diese Verantwortung auf eine Gruppe zu übertragen
- das Bedürfnis nach dem echten, tiefen Sinn des eigenen Lebens;
- die Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen, die die Oberflächlichkeit
der Realität übersteigen;
- der Wunsch nach möglichst perfekten Antworten auf persönliche
und gesellschaftliche Probleme;
- das Bedürfnis nach einer geistlichen Führung und nach Autorität;
- das Interesse an psychologischen Fragen und psychologischen Problemlösungen;
usw...
Alle diese Wünsche, Ziele und Sehnsüchte sind in jedem von
uns vorhanden. Vor allem in Zeiten persönlicher Krisen kommen sie
verstärkt zum Ausdruck. Wird man dann mit einem entsprechenden neuen
Sinn-Angebot konfrontiert, ist das Interesse gegenüber diesem Angebot
nicht verwunderlich. Dies auch nur unter der Voraussetzung, daß man
über die einzelnen Bewegungen nicht oder nur unzureichend informiert
ist.
2. Methoden und Praktiken
2.1. Praktiken und Einstellungen
Im folgenden möchte ich die Praktiken und Einstellungen der verschieden
Sekten kurz erläutern:
1) Der Wert des Lebens
In Einzelfällen scheint der Wert des Lebens dem Nutzen für
die jeweilige Organisation untergeordnet sein. So enthielten bis Ende der
60erJahre die internen Anweisungen von "Scientology"-Gründer Hubbard
folgende Passage: "Er (d.h. der Feind) darf seines Eigentums beraubt werden,
er darf auf jede Weise durch einen Scientologen geschädigt werden,
ohne Strafverfahren durch Scientologen. Man darf Streiche spielen, ihn
belügen, betrügen oder vernichten" (Hubbard Communication Office
Policy Letter, 18.10.1966).
Diese Art des "Fair Game" hat zu Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit
geführt und wurde schließlich durch den Hubbard Communication
Office Policy Letter vom 21.10.1968 aufgehoben. Äußerst problematische
Einstellungen zum Wert des Lebens zeigten die Massen(selbst)morde der Volktempel-Sekte
des Jim Jones (Jonestown/Guyana; 1978), der Davidianer-Sekte des David
Koresh (Waco/USA; 1993) oder der Sonnentempler (Cheryl/Schweiz; 1994).
Katastrophale Ausmaße erreichten die Terroranschläge der
Aum-Sekte des Aum Shinri Kyo in Tokio/Japan Dort wurden tausende völlig
Unbeteiligte und Unschuldige verletzt und einige sogar getötet.
Die meisten übrigen Gruppierungen lehnen Gewalt ab.
2) Gesundheit und Krankheit
Einzelne Gruppierungen vertreten eine grundsätzlich andere Sicht
von Gesundheit und Krankheit. Daraus folgt meist die strikte Ablehnung
der Schulmedizin. Einige Gruppen bieten sogar ohne entsprechende medizinische
Ausbildung alternative Behandlungsmethoden an:
Darunter fallen spezielle Meditationsübungen ("Sahaja Yoga") und
zum Teil auch eigene Präparate, für die es keinen wissenschaftlichen
Wirkungsnachweis gibt ("Fiat Lux").
Die "Zeugen Jehovas" und das "Universelle Leben " sprechen sich gegen
Bluttransfusionen aus.
3) Sexualität und Familie
Im Bereich der Sexualität finden sich bei einigen Gruppen oft Extremeinstellungen:
So wird von einzelnen Gruppen selbst in der Ehe sexuelle Enthaltsamkeit
gefordert ("Fiat Lux", "Brahma Kumaris"), während andere das offene
Ausleben von Sexualität propagieren ("Zentrum für experimentelle
Gesellschaftsgestaltung"). Im Extremfall führte dies sogar bis zum
sexuellen Mißbrauch von Kindern ("Kinder Gottes", "Aktionsanalytische
Organisation").
Tiefgreifende familiäre Konflikte treten meist dann auf, wenn sich
nur ein Familienmitglied einer derartigen Gruppierung zuwendet. Gelingt
die "Bekehrung" der restlichen Mitglieder nicht kommt es zur Scheidung.
4) Kinder und Erziehung
Die Methoden und Praktiken einer solchen Weltanschauungsgruppe kann
natürlich auch Konsequenzen für die Kinder ihrer Mitglieder haben.
So müssen Kinder eigene "Schulen" besuchen, wo sie nach den Methoden
dieser Gruppierung unterrichtet werden ("Scientology", "Hare-Krishna-Bewegung").
Besuchen Kinder von Mitgliedern eine öffentliche Schule, so können
erfahrungsgemäß Konflikte entstehen: Etwa im Bereich der Bekleidungsvorschrift
für den Turnunterricht ("Palmarianer") oder bei Verboten für
die Teilnahme von bestimmten Festen oder Feiern ("Zeugen Jehovas").
Problematisch wird es, wenn bereits Kleinkinder und Babys stundenlang
"meditieren" müssen ("Holo-sophische Gesellschaft") oder durch eine
sehr einseitige Ernährung in ihrer Entwicklung gefährdet werden
können ("Fiat Lux").
5) Arbeit und Finanzgebarung
Im Normalfall sind die Mitglieder solcher Bewegungen berufstätig.
Viele Gruppierungen versuchen Geld in erster Linie durch Spenden zu erhalten.
Weiter wird Geld durch Kursangebote eingenommen ("Scientology", "Landmark
Education"), was für die Teilnehmer oft die Zahlung vier- bis fünfstelliger
Beträge bedeutet. Auch durch Schenkungen und Erbschaften kann die
finanzielle Situation verbessert werden.
6) Transparenz und Identifizierbarkeit
Einige Gruppierungen treten öfters unter verschiedenen Bezeichnungen
auf. So ist die eigentliche Identität für Außenstehende
schwer festzustellen. Andere Organisationen haben eine Netz von Unterorganisationen
gegründet, die unterschiedliche Namen tragen, aber eben doch in einem
engen Naheverhältnis zur Mutterorganisation stehen.
Wichtig ist es, sich möglichst umfassend über die entsprechende
Organisation zu informieren wie z.B. Informationen über den Gründer,
die Glaubensinhalte, Lebenspraxis, Entwicklungstendenzen oder Erfahrungen
von Betroffenen und Mitgliedern.
Ist eine Person einmal Mitglied geworden, so werden verschiedene Methoden
angewendet, um die einzelnen Mitglieder zu kontrollieren. Im folgenden
die diversen Methoden kurz erläutert:
- Verhaltenskontrolle: Die Lebensordnung wird oft streng normiert.
D.h. zum Teil strikte Speise- und Bekleidungsvorschriften ("Fiat Lux")
oder entsprechende Anweisungen für Riten und Meditationen ("Hare-Krishna-Bewegung").
Der individuelle Lebensraum kann dadurch immer stärker beschnitten
werden.
- Gedankenkontrolle: Neue Mitglieder übernehmen oft kritiklos
und unreflektiert das Lehr- und Sprachsystem. Lektionen wie z.B. "Du bist
niemand, der Meister ist alles" ("Osho-Bewegung") gilt es zu lernen und
zu befolgen.
- Gefühlskontrolle: Mit der Erzeugung von Schuld- und Angstgefühlen
wird versucht, das einzelne Mitglied an die Gruppe zu binden ("Vereinigungsbewegung").
Dafür sind gerade sensible, idealistische Menschen sehr empfänglich.
Gründe, warum Menschen an solchen Gruppen immer wieder gefallen
finden, sind z.B. Zuwendung, die sie früher nicht bekommen haben und
jetzt im Überfluß bekommen ==> "Love-bombing". Das Gefühl,
endlich gebraucht zu werden und eine Heimat zu haben, ist ebenfalls sehr
wichtig für sie.
Verschiedene Organisationen bieten spezifische Konzept zur Erhaltung
der Gesundheit an und vertreten alternative Heilungsangebote, wobei die
Schulmedizin abgelehnt wird ("Fiat Lux").
Menschen, die an Zweifeln und an Unsicherheit leiden, fasziniert die
Sicherheit, die manche Gruppen versprechen.
3. Mögliche Konsequenzen für
Individuum und Gesellschaft
3.1. Mögliche Gefahren für
den einzelnen
- Einengung der Persönlichkeit auf wenige Bereiche der Lebensmöglichkeit
und -gestaltung
- Psychischer Rückschritt in kindliche Entwicklungsphasen
- Verlust der Berufsfähigkeit und Selbständigkeit
- Verlust lebensnotwendiger Finanzen und Eigentumswerte
- Verlust des Freundeskreises außerhalb der Organisation
usw.
3.2. Mögliche Gefahren für
die Gesellschaft
- Verfolgung gruppenegoistischer, gewinnorientierter oder totalitär
vereinnahmender Ziele
- Einschränkung der demokratischen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
- Ausbleiben einer soliden Berufsausbildung und damit in der Folge:
- Mangel bzw. Fehlen von sozialer Sicherheit (Versicherungsschutz, pensionsrechtliche
Regelungen fehlen häufig)
- bei Kindern, die isoliert, unausgebildet, desintegriert oder gar mißbraucht
in derartige Gruppen aufwachsen.
usw.
Selbstverständlich sind nicht alle Probleme bei allen Mitgliedern
jeder "Sekte" anzutreffen, doch schon die Existenz einiger dieser Faktoren
kann das Leben eines Menschen und sein soziales Umfeld nachhaltig beeinträchtigen
oder schädigen.
4. Sekten und Schule
4.1. Spezialfall Jugendliche
Zu einem Problem wird das Thema "Sekten", wenn Jugendliche betroffen
sind. Die Einfluß- und Veränderungsrate durch derartige Organisationen
sind bei Heranwachsenden potentiell größer als bei Erwachsenen,
die über eine mehr oder minder gefestigte Lebenseinstellung verfügen.
Jugendliche sind nach den Befunden der Jugendpsychologie nicht nur in bezug
auf ihre Körperlichkeit verunsichert, sondern auch hinsichtlich ihrer
intellektuellen Verfassung. Kritische Distanz gegenüber neuen Ideen
und Ideologien kann bei Heranwachsenden nicht immer erwartet werden.
4.2. Welche Probleme "gelöst"
werden
Auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit sind Jugendliche
bestrebt, Vorbilder und Leitbilder auszusuchen, aber auch Idealen und Ideologien
nachzuhängen.
Maslow (1954) stellte eine hierarchische Klassifikation von Bedürfnissen
fest, deren Befriedigung im Laufe der Adoleszenz eingefordert wird. Garrison
und Garrison (1975) leiteten, von Maslow ausgehend, folgende Bedürfnisse
für die Adoleszenz ab:
1. Physiologische Bedürfnisse: Es steht das Bedürfnis
nach körperlicher und sexueller Betätigung sowie der Wunsch nach
Anerkennung der eigenen körperlichen Bedürfnisse im Vordergrund.
2. Sicherheitsbedürfnis: Die durch die körperliche
und seelische Reifung bedingten Veränderungen akzentuieren den Wunsch
nach Sicherheit.
3. Unabhängigkeitsbedürfnis: In dieser Altersstufe
setzt ein Unabhängigkeitsdrang ein, der gepaart ist mit Widerstand
gegen alles Herkömmliche, gegen Autoritäten sowie der Tendenz,
Normen, Regeln und Gewohnheiten in Frage zu stellen.
4. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Zugehörigkeit
und Zuneigung, was u.a. ein Ergebnis der verstärkten Fähigkeit
zur Introspektion ist. Das Streben nach Autonomie führt vielfach zu
einer Isolierung des Jugendlichen, was wiederum sein Bedürfnis nach
Liebe und Zuneigung mobilisiert.
5. Ein Leistungsbedürfnis und der Wunsch, gebraucht zu werden,
etwas bewirken zu können, sind entweder offen oder verdeckt ein wesentlicher
Zug des jungen Menschen.
6. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Ich-Entwicklung
in der Adoleszenz ist in allen Kulturen sichtbar.
Typische emotionale Reaktionsmuster in der Adoleszenz sind Impulsivität
und emotionale Instabilität, die bedingt werden durch das Wahrnehmen
neuer Gefühle. Jugendliche und Adoleszente neigen zum Experimentieren,
zum Ausprobieren, sind risikofreudig und wollen Grenz- und Tiefenerfahrungen
erleben.
Diese besonderen Grundbedürfnisse und Erlebnisweisen Heranwachsender
haben zur Folge, daß bestimmte Formen von "Erlebnisreligionen" für
Jugendliche und Adoleszente besonders attraktiv sind. (Klosinski, S. 29f)
Besonders gefährdet und "sekten-anfällig" sind nach den Erkenntnissen
der Jugendpsychologie Jugendliche,
- die Autoritätskonflikte, Arbeitsplatz- und Schulprobleme oder
Partnerschaftsprobleme haben
- die unter Ängsten, Zwängen, Depressionen und psychosomatischen
Erkrankungen leiden
- die von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen betroffen sind,
die sich unter dem Begriff der Luxus- und Mangelverwahrlosung, der Exzentrik
und der Experimentierfreudigkeit des Jugendlichen zusammenfassen lassen.
4.3. Wie kann man betroffenen Jugendlichen
helfen?
Für die betroffenen Jugendlichen ist das Erlebnis des Angenommen-Werdens
am Wichtigsten. Vorwürfe und Kritik sind hingegen fehl am Platz. Vor
allem ein eigenes "Ich" und ein "Wir-Erlebnis" in einer neuen sozialen
Gemeinschaft muß aufgebaut werden, um ein Gemeinschaftsgefühl
außerhalb der Organisation zu ermöglichen.
Die betroffenen Jugendlichen müssen zu einem neuen Lebensstil,
zur Befreiung aus ihrer Abhängigkeit und zu neuer Gemeinschaft ermutigt
werden. Das stellt nicht nur Anforderungen an professionelle Psychologen,
sondern auch an Eltern und Bezugspersonen: Es geht nicht darum, Jugendliche
vor bestimmten ideologischen Richtungen zu bewahren, sondern sie so zu
erziehen, daß sie Ideen und Ideologien selbst hinterfragen können.
Das ist langfristig der beste Schutz gegenüber manipulativen Einflüssen.
4.4. Was tun, wenn andere betroffen
sind?
Wenn man eine betroffene Person kennt, ist es wichtig, folgende Ratschläge
zu beachten:
- Machen Sie sich keine Selbstvorwürfe! Vor allem, wenn
es sich um das eigene Kind oder den Partner handelt, sind Selbstvorwürfe
vorprogrammiert. Experten bezeichnen diese Situation als "Ko-Abhängigkeit".
Die Beziehung zur betroffenen Person ist dadurch auf das Schwerste gefährdet:
Verlust, Trennung oder Scheidung sind die unvermeidbaren Konsequenzen.
- Ihre Zuneigung ist wichtig! Zeigen Sie der Person, daß
Sie nie aufhören werden, ihr Zuneigung zu schenken bzw. sie zu lieben.
Achten Sie darauf, daß der Kontakt nicht abreißt. Wenn die
betroffene Person Ihr Kind und minderjährig ist, sollten Sie rasch
und konsequent von Ihren elterlichen Rechten Gebrauch machen.(Polizei ==>
Anzeige).
- Geben Sie die betroffene Person nie auf!
- Beziehen Sie Position! Im Gespräch mit der betroffenen
Person sollten Sie immer Ihren Standpunkt darlegen. Schwammige Zustimmung
nützt niemandem. Bleiben Sie dialogfähig, und sagen Sie klar
und ehrlich Ihre Meinung. Vermeiden Sie dabei aber Vorwürfe.
- Niemals "umpolen"! Hüten Sie sich vor Maßnahmen,
die die betroffene Person "umpolen" sollen ("Deprogrammierung). Die Person
hat ja nicht gemerkt, wie sie in den Einfluß der betreffenden Gruppe
hineingeraten ist und wie sie ihre eigene Individualität sukzessive
abgelegt hat. Die damit äußerst gefährdete Individualität
der betroffenen Person könnte durch "Deprogrammierung" restlos zerstört
werden. Vermeiden Sie jeglichen Druck, falls ihre Bemühungen nicht
erfolgreich sein sollten: Je stärker der von Ihnen verursachte Druck
ist, desto stärker wird auch die Abwendung der betroffenen Person
von Ihnen sein.
- Vorsicht bei Geschenken! Vermeiden Sie Schenkungen an betroffene
Personen. Derartige Geschenke gelangen fast immer in die Hände der
Gruppe.
- Sammeln Sie Informationen! Bemühen Sie sich, möglichst
viele Informationen über die betreffende Gruppe zu sammeln. Nehmen
Sie unbedingt das Informationsangebot der Beratungsstellen wahr.
- Dokumentieren Sie alles! Dokumentieren Sie alle Ereignisse
und Daten, die in Zusammenhang mit der betroffenen Person und der Gruppe
stehen (erste Kontaktaufnahme, Anwerbung, Umzug etc.) Weiters sind alle
Namen, Adressen und Telefonnummern, die mit den Aktivitäten der betroffenen
Person in der Gruppierung zu tun haben. Dies kann eine wichtige Hilfe für
gerichtliche und behördliche Aktivitäten sein.
5. Dialog mit Jugendlichen, die Sekten-,
Okkult- oder Esoterikerfahrung hatten
Entscheidend ist die Ausgangslage, die der Berater vorfindet: Warum,
wie, wann kommt der Betreffende in die Beratung? Der Berater wird den Jugendlichen
anhören und versuchen, bei ihm Vertrauen zu finden bzw. aufzubauen;
er wird nicht vorschnell werten, sondern sehr genau hinhören, was
der Ratsuchende für ein Anliegen hat, was ihn bewegt, welche Fragen
er mitbringt. In dieser Phase muß der Jugendliche entlastet werden,
indem man ihm erklärt, daß psychische Verwerfungen, Regressionen,
Einbrüche und Verhaftungen im Magisch-Mystischen zum Menschensein
schlicht dazugehören, daß die von der entsprechenden Gruppe
ausgehende Faszination auch damit zu tun hat, daß in ihm, dem Jugendlichen,
irgend etwas aktiviert wurde und sich angezogen fühlt.
Erst zu diesem Zeitpunkt ist das Anführen von Aussteigerbeispielen
aus der entsprechenden Bewegung möglich, wie auch eine eventuelle
Vermittlung zu einem speziellen Experten für die betreffende Sekte
oder Gruppierung.
Nützlich ist auch der Hinweis, daß nach einer Hinwendung
(Konversion) in eine Bewegung folgende drei Wege möglich sind:
1) Eine fanatisch-blinde Entwicklung
2) Eine kritische Stellungnahme innerhalb der Sekte oder des Kults mit
der Unterscheidung zwischen negativen und positiven Entwicklungen.
3) Die Möglichkeit des Ausscheidens, so wie es ja auch Aussteiger
aus der ev./kath. Kirche gibt.
5.1. Empfehlungen bezüglich der
Haltung des Beratenden gegenüber Eltern und Angehörigen
Wichtig ist, zu verstehen, daß Eltern häufig aufgrund einer
Eltern-Kind-Problematik nicht dazu in der Lage sind, mit Argumenten den
Konvertierten davon zu überzeugen, daß er auf einem "Holzweg"
sei. Kämpfende Eltern laufen Gefahr, ihre Kinder immer stärker
in die Abhängigkeit von der betreffenden Sekte zu treiben, vor allem
dann, wenn die Hinwendung zur Sekte psychodynamisch etwas mit einem Autoritätskonflikt
gegenüber den Eltern zu tun hatte. Ein Nachgeben des Jugendlichen
würde dann seine Abhängigkeit von den Eltern noch unterstreichen,
was er schon allein aus diesem Grunde häufig nicht zulassen kann.
Die Eltern sollten nicht verdammen, sondern versuchen, eine "Restkontakt"
und ein Restvertrauen zu halten bzw. aufzubauen, indem sie sich für
die "Sektenkarriere" ihres Familienangehörigen interessieren.
Gewaltsames Entführen der betreffenden Jugendlichen oder ein "Befreiungsgespräch"
ist weder ein adäquater noch ein erfolgversprechender Weg.
Der Jugendliche soll nicht vorschnell "umgekehrt werden", sonder behutsam
und allmählich befähigt werden, selbst relativieren zu können
und nicht verabsolutieren zu müssen.
Eltern und Berater müssen darüber informiert werden, daß
es aufgrund von religiösen Konfessions- oder Sektenübertritten
oder durch Hinwendung zu Psychokulten gelegentlich zu schweren psychischen
Krisen kommen kann, die das ganze Spektrum psychiatrischer Erkrankung aufweisen.
Deshalb sollten sich Jugendliche und ihre Eltern, auch wenn sie oft
große Hemmungen haben, vertrauensvoll an Beratungsstellen wenden.
6. Zusammenfassung und eigene Meinung
Die Frage, die es nun zu beantworten gilt, lautet:
Sind Lehrer in der Schule berechtigt, Schülern zu helfen,
die Mitglied einer Sekte sind.
Meiner Meinung nach kommt es darauf an, ob sich der jeweilige Lehrer
schon mit diesem Thema beschäftigt hat oder nicht. Ist er Laie auf
diesem Gebiet sollte er lieber die Finger davon lassen und nichts unternehmen.
Er sollte sich lediglich mit den Eltern in Verbindung setzen und erkunden,
ob sie wissen, daß ihr Kind Sektenmitglied ist. Alles weitere sollte
er den Eltern überlassen oder er könnte ihnen seine Hilfe anbieten.
Falls der Lehrer bereits Informationen über Sekten gesammelt hat
und sich mit diesem Thema beschäftigt hat, könnte er versuchen,
ein Gespräch mit dem Schüler führen. Dabei sollte er sich
so verhalten, wie es im Kapitel 5.1. beschrieben wurde. Wenn der Schüler
nun zustimmt, kann sich der Lehrer mit den Eltern in Verbindung setzen
und mit ihnen reden, wie es weitergehen soll. Zeigen sich diese auch gesprächsbereit,
so steht einer Beratung bei professionellen Beratungsstellen nichts mehr
im Weg.
Zeigen sich die Eltern nicht bereitwillig etwas dagegen zu tun, sind
meiner Meinung nach die Vollmachten des Lehrers erschöpft, und er
sollte sich aus weiteren Aktionen heraushalten.
Bevor ich mir als Lehrer unsicher wäre, was zu tun ist, halte ich
mich lieber aus diversen Hilfeleistungen heraus, da Konsequenzen nicht
ausgeschlossen werden können.
7. Literaturliste
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: SEKTEN, Wissen
schützt!
Klosinski, Gunther: Psychokulte; Was Sekten für Jugendliche so
attraktiv mach!
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
6) Kognitive Psychologie (Barbara Achammer)
Einleitung - Begriffsbestimmung
Es gibt verschiedene Arten von Lerntheorien, die Verhaltenstheorien,
die kognitiven Lerntheorien und die Handlungstheorien. In dieser Arbeit
möchte ich mich auf die kognitiven Lerntheorien beschränken.
Um diese Lerntheorie besser verstehen zu können, ist es vielleicht
hilfreich den Begriff ´kognitiv´ genauer zu erklären.
Das Duden-Fremdwörterbuch (1990) berichtet folgendes:
kognitiv:(lat.) die Erkenntnis betreffend; erkenntnisgemäß.
kognitive Entwicklung: Entwicklung all der Funktionen beim
Kind, die zum Wahrnehmen eines Gegenstandes od. zum Wissen über ihn
beitragen.(405)
Im Gegensatz zu den behavioristischen Lerntheorien, die sich schwerpunktmäßig
mit den äußeren Bedingungen des Lernens auseinandersetzen, man
denke nur an die Reiz-Stimulus-Theorie, und dem klassischen und operanten
Konditionieren, beschäftigt man sich ab den sechziger Jahren hauptsächlich
mit der inneren Repräsentation der Umwelt.
Unter Kognition versteht man jene Vorgänge, durch die ein Organismus
Kenntnis seiner Umwelt erlangt. Im menschlichen Bereich sind dies besonders:
Wahrnehmung, Vorstellung, Denken, Urteilen, Sprache. Durch Kognition wird
Wissen erworben. Kognitive Prozesse lassen sich von emotionalen und motivationalen
unterscheiden. (Edelmann 1993, 9)
1. Der Gegenstand der zeitgenössischen
kognitiven Psychologie
Das Hauptinteressensgebiet der kognitiven Psychologie sind die höheren
kognitiven Prozesse, wie die Wahrnehmung, das Gedächtnis, Sprache,
Denken, Problemlösen und Entscheidungsprozesse. Alle setzen eine kognitive
Repräsentation oder besser eine Metapher voraus, d.h. der Zustand
wird nicht mehr wörtlich beschrieben, wie bei den Behavioristen, sondern
durch einen Als-ob-Vergleich.
Leider gibt es nur wenige bemerkenswerte Versuche zur Bildung von systematischen
und umfassenden kognitiven Theorien, wenn es auch eine Hand voll wichtiger
und bekannter Ansätze gibt. (Lefrancois, 1994, S. 109)
Das Schwergewicht in den letzten Jahren lag mehr auf intensiver Forschung
in spezifischen Gebieten als auf der Konstruktion eines Systems, das so
allgemeine Gültigkeit hätte, daß es eine Vielzahl von Beobachtungen
umfaßte.
Zu den wichtigsten Beiträgen zur Entwicklung der zeitgenössischen
kognitiven Psychologie gehört der von Jerome Bruner, der in dem folgenden
Kapitel kurz beleuchtet werden wird. Eine große und für den
Unterricht prägende Rolle für die kognitive Psychologie spielte
Jean Piagets Entwicklungspsychologie, auf die in dieser Arbeit aber nicht
eingegangen wird.
2. Bruners Theorie der Kategorisierung
Bruners Lerntheorie ist hauptsächlich von der Auffassung geprägt,
daß der Mensch die Welt hauptsächlich durch Ähnlichkeiten
und Unterschieden von Ereignissen und Objekten interpretiert. Ähnliche
Objekte wirken wie ein Reizinput und werden gleich einer Kategorie zugeteilt,
die alle Objekte umfaßt, die gewisse ähnliche Eigenschaften
(Attribute) aufweisen. Lefrancois erklärt dies mit einem schönen
Beispiel von einem Mann, der einen Kopf mit langen blonden Haaren und einem
hübschen Gesicht sieht, das ihn über ein Meer von Schaum hinweg
aus einer rosaroten Badewanne anlächelt. Nun geht Lefrancois davon
aus, daß sich der Mann gleich schon viel mehr vorstellt. Da er die
Kategorie Mädchen kennt, kann er auch bei dieser Information Schlüsse
ziehen, die den Regeln seiner Kategorie entsprechen. (Mädchen = lange
Haare, schönes Gesicht, Körperteile- obwohl nicht sichtbar, erotische
Gedanken- aus früheren Erfahrungen) Dabei wird natürlich über
die gegebene Information hinausgegangen. Der Mann macht in diesem Beispiel
Vorhersagen auf der Grundlage einer Kategoriezugehörigkeit.
Bei der Wahrnehmung ist es nicht nur wichtig, eine angemessene Kategorie
zu haben, sondern diese muß auch zugänglich sein, d.h. der Betroffene
muß auch bereit sein, die Information aufzunehmen. Andauernd finden
Entscheidungsprozesse statt, die eine Aufnahme der Information entweder
gutheißen oder ablehnen. Die Aufnahmebereitschaft wird sehr stark
von den jeweiligen Bedürfnissen und Erwartungen beeinflußt.
Je zugänglicher eine Kategorie, desto weniger Input ist für die
Wahrnehmung erforderlich. Die Gefahr von zu offenen Kategorien ist aber
die, daß eine Information rasch akzeptiert wird, und Kategorien,
die vielleicht passender wären, von den allgemeineren Kategorie verdeckt
und deshalb schlechter verfügbar werden. Folglich wird die Information
unter einem falschen bzw. zu ungenauen Bezugssystem gespeichert. Die Art
von Kategorisierung spielt auch bei der Informationsverarbeitung und den
Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle.
Da die Bildung von Kodierungssystemen die Entdeckung von Beziehungen
fordert, tritt Bruners stark für entdeckungsorientierte Lernmethoden
ein.
3. Die Rolle des Gedächtnisses beim
Lernen
Um das Gedächtnis beim Lehren und Lernen wirkungsvoll zu nutzen,
wäre es hilfreich das Wesen und die Funktion dieses Mechanismus besser
zu verstehen.
Was das Wesen des Gedächtnisses angeht, so ist den meisten Verfassern
bekannten Definierungsversuchen die Aussage gemeinsam, daß es eine
psychische Fähigkeit ist, vergangene Erfahrungen bei der Verarbeitung
gegenwärtiger Erfahrungen zur Neuordnung vergangener Erfahrung und
beide, vergangene und gegenwärtige Erfahrungen, zur leichteren Verarbeitung
zukünftiger Erfahrungen zu nutzen. In anderen Worten, Gedächtnis
ist im weitesten Sinn die Fähigkeit zu lernen. (Rohrer 1993, 12f.)
Diese Aussage Rohrers mag zwar ziemlich oberflächlich erscheinen,
doch scheint es unmöglich die komplexen Vorgänge, die einmal
als Gedächtnis, dann als Denken oder als Intelligenz oder wiederum
als Lernen bezeichnet werden genauer zu beschreiben.
Wenn wir nun vom Aufbau des Gedächtnisses sprechen, so vom sensorischen
Speicher, dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis,
so muß uns klar sein, daß es sich hier nur um metaphorische
Strukturen handelt, die uns, indem das Gedächtnis in seine verschiedenen
Funktionen, aber auch Prozesse wie Lernen und Erinnern geteilt wird, helfen
sollen, das Phänomen genauer zu erfassen. Das bedeutet, daß
die einzelnen Teile nicht als identifizierbare, neurologische Strukturen
existieren müssen, sondern einfach darstellen, was sein könnte.
Von der Speichertheorie ausgehend, soll nun das Gedächtnis genauer
beschrieben werden. Es fängt damit an, daß Informationen über
alle unsere Empfangskanäle, so den Sehnerven, den Gehörnerven,
den Geruchsnerven, den Geschmacksnerven und den Hautnerven, in den Ultrakurzzeitspeicher
(UKZS), auch sensorischer Speicher genannt, gelangen. Dieser Speicher kann
mit einer Eingangsstelle einer großen Informationszentrale verglichen
werden, die auf unterschiedlichen Kanälen einem unaufhörlichen
Strom von Informationen ausgesetzt ist, von welchen ein großer Teil
unaufgefordert ankommen, wenige aber planmäßig beschafft werden.
Das Phänomen der Aufmerksamkeit spielt dabei eine große Rolle.
Im sensorischen Speicher werden nun diese große Menge an Daten grob
vorsortiert, wobei auf die aktuelle und mögliche Brauchbarkeit geachtet
wird. Alle unbrauchbaren und unabsichtlich empfangenen Informationen, wie
die Gesichtszüge von Straßenpassanten, Vogelgezwitscher, die
Druckempfindung beim Berühren eines Klingelknopfs, aber auch Buchstaben
und Laute eines gelesenen oder gehörten Textes, manche Wörter
oder gar ganze Sätze, die für das Verständnis nicht so wichtig
sind., werden sofort vernichtet und somit gleich vergessen. Der Rest wird
an die entsprechenden Sachgebiete weitergegeben. Die Verbleibdauer im UKZS
ist sehr kurz, sie beträgt ungefähr 200 Millisekunden. Viele
Wissenschaftler glauben, daß das völlige Vergessen dieser unwichtigen
Informationen die Hauptaufgabe des UKZS ist. Somit hat das Gedächtnis
die Möglichkeit sich mit wichtigeren Informationen intensiver zu befassen.
Wichtigere Informationen, wie der fehlende Punkt auf dem i, wenn wir
Korrektur lesen, oder das plötzliche Knistern einer Neonlampe, wenn
wir ein Tonband besprechen, werden nicht sofort ausgesondert, sondern in
den Kurzzeitspeicher (KZS) übergeleitet, der für die Feinsortierung
und der Zuordnung zu gewissen Sachgebieten oder Kategorien zuständig
ist und somit eine große Rolle für die Art der Speicherung,
bzw. Archivierung spielt. Diese Information wird nicht mehr vernichtet,
bleibt aber auch nicht lange im KZS, sondern wird in den Langzeitspeicher
(LZS) weitergeleitet, welcher in zwei Teile gegliedert ist, den aktiven
Speicher, in dem jene Information gespeichert wird, die abrufbar sein muß,
und den inaktiven Speicher, in welchem die Informationen gespeichert werden,
die lediglich wiedererkannt werden sollen. Die Verweildauer von Informationen
im LZS ist eigentlich unbegrenzt. Die Speicherkapazität ist unheimlich
groß und wird nie vollends ausgenützt.
Die Hauptaufgabe des LZS ist es also die Informationen nach möglichst
effektiven, immer wieder überprüften Kriterien zu speichern und
aufzubewahren und die Information immer wieder auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen und notfalls auch zu revidieren. Die Informationen
können zwar nicht verloren gehen, aber sie können sich ändern,
indem sie Bestandteil einer neuen Information werden oder vom aktiven in
den inaktiven Speicher wandern, da sie nicht häufig genug abgerufen
werden .(Rohrer 1990, 12-17)
4. Kognitives Lernen (vor allem im Sprachunterricht)
Bei den kognitiven Lerntheorien wird der Lerner als aktives, informationsverarbeitendes
System gesehen. Dieses System ist mit komplexen Wissenskomponenten ausgestattet,
die durch mentale Operationen gesteuert werden. Neues Wissen entsteht durch
Interaktion zwischen bereits vorhandenem Wissen und neuen Stimuli. Eine
Optimierung des Systems wird dann erreicht, wenn durch andere mentale Operationen
Wissenszuwachs, Reorganisation und Abrufbarkeit des Wissens erreicht wird.
Lernen bedeutet deshalb vor allem den Auf- und Ausbau kognitiver Strukturen.
Durch bewußtes Wahrnehmen und Verstehen der Lerngegenstände
kann der Lernprozeß gefördert werden.
a) Induktives vs. deduktives Lernen
Da es wichtig ist, daß der Schüler die Information versteht,
braucht es ein einsichtiges (sinnvolles) Lernen, einen aktiven Konstruktionsprozeß.
Dies wurde schon von Brunes verlangt, der die Notwendigkeit von selbstentdeckendem
Lernen hervorhob. Dieses Vorgehen kann auch induktives Lernen genannt werden,
das im Gegensatz zum deduktiven Lernen steht. In Bezug auf den Sprachunterricht
sieht dies so aus, daß der Schüler mit einem Text konfrontiert
wird und diesen selbst analysieren, begreifen und üben muß.
Wichtig ist, daß sich der Schüler seine Erkenntnis bewußt
macht, um die neue Information schließlich auch selbst anwenden zu
können, d.h. es ist wesentlich, implizites Wissen in explizites zu
verwandeln. Falls dies nicht gemacht wird, ist die Gefahr groß, viel
Wissen zu verlieren.
b) Implizites vs. explizites Wissen
implizites Wissen x x explizites Wissen
Lerner gebraucht Lerner kann Lerner kann Lerner kann Regeln
Regeln ohne zu beurteilen, ob die Regeln in eigenen in metalinguistischer
reflektieren sprachliche Äußerung Worten darstellen Terminologie
in Übereinstimmung darstellen
mit den Regeln ist
oder nicht
Implizites und explizites Wissen sind nicht trennbar. Für den Lernprozeß
ist sowohl die Bewußtmachung des impliziten Wissens wichtig, d.h.
die Hinüberführung in explizites Wissen, als auch die Automatisierung
des expliziten Wissens. Diese Automatisierung der Prozesse ist deshalb
so wichtig, da die Aufmerksamkeit, die wir für die Wahrnehmung neuer
Information brauchen, in ihrer Kapazität sehr begrenzt ist und nur
wenige kognitive Prozesse zugleich verrichten kann. Automatische Prozesse
brauchen weniger Aufmerksamkeit und bedeuten deshalb eine große Entlastung,
während kontrollierte Prozesse die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
c) Die 3 Typen von Wissen: Deklaratives,
prozedurales Wissen und metakognitives Wissen
Neben der Unterscheidung von impliziten und expliziten Wissen, kann
man auch noch zwischen deklarativen, prozeduralen und metakognitiven Wissen
unterscheiden. Unter deklarativem Wissen versteht man das Was- Wissen,
das mit den vorhandenen Daten in einem Computer verglichen werden kann.
Es geht um Tatsachen und Gegenstände. Dieses deklarative Wissen wird
vom prozeduralen ergänzt, welches sich mit dem wie von Prozessen beschäftigt
und mit einem Verarbeitungsprogramm des Computers verglichen werden kann
und sehr wichtig für das Problemlösen ist. Dazu kommt noch das
metakognitive Wissen, welches ermöglicht über das deklarative
und prozedurale Wissen zu reflektieren.
deklaratives Wissen prozedurales W.
- fremdsprachliches Wissen: Regeln, Lexis - Rezeptionsprozesse
- pragmatisches Wissen: Diskussions- uns Textstrukturen - Produktionsprozesse:
Hypothesen- testen
- soziointeraktives Wissen: Rollen, Institutionen - Lernprozesse
Während wir mit dem deklarativem Wissen schon ziemlich vertraut
sind, ist uns sehr oft die Wichtigkeit des prozeduralen Wissens nicht bewußt,
besonders im Bereich des Problemlösens.
Problemlösen
Problemlösen ist als ein zielgerichtetes Verhalten definiert. Das
Ziel einer Aufgabe wird aber nur schrittweise erreicht, indem die Aufgabe
so lange in Teilaufgaben und Teilzielen zerlegt wird, bis ein Teilziel
direkt erreicht werden kann.
Problemlösen beinhaltet dann, eine Folge von Operationen zu finden,
die den Anfangszustand in den Zielzustand überführen, der als
Lösung erreicht werden soll.
(Anderson 1989, 120)
Ein Problem kann man hauptsächlich durch Einsicht und durch abermalige
Bewußtmachung lösen, d.h. das Lösen von Problemen ist auch
ein eigenes Wissen, das man sich erst aneignen muß.
Das Wissen, das dem Problemlösen zugrunde liegt, kann formal als
Menge von Produktionen beschrieben werden, die Handlungen festlegen, mit
denen die Zielzustände unter den jeweils gegebene Bedingungen erreichbar
sind. (Anderson 1989, 120)
5. Tips für ein erfolgreiches kognitives
Lernen
* Die Elaboration von Informationen bietet zusätzliche Abrufwege
an und trägt zu einem besseren Behalten bei
* Die Absicht zu lernen allein kann die Behaltensleistung nicht sichern.
Wichtig ist die Art der Informationsverarbeitung
* Je genauer der Testkontext dem Lernkontext entspricht, desto höher
ist die Gedächtnisleistung
* Extensives Lernen ist besser als intensives. Durch den zeitlichen
Abstand vergrößern sich die Unterschiede zwischen den Lernkontexten.
* Wichtig ist eine Differenziertheit der Regelformulierung. Dabei sollte
man didaktische Regeln den sprachwissenschaftlichen Regeln vorziehen
* Bei der Bewußtmachung ist es besonders wichtig auf Kontraste
aufmerksam zu machen
* Lerner sollen viele Fragen stellen: Diese deuten lernstrategische
Reaktionen auf kognitive Konflikte an, signalisieren Eigeninitiative und
sind bedürfnisorientiert
* Die Unterrichtende kann bei der Kognitivierung sehr behilflich sein.
Es gibt verschiedene Arten der Kognitivierung: objektsprachliche, visualisierende,
signalgrammatische, verbal-metasprachliche
* inhaltsbezogenes Material benutzen
* Einfluß der Emotionen
Schluß
Abschließend ist es wichtig, hervorzuheben, daß dieses theoretische
Wissen auch direkt im Unterricht, aber auch für sich selbst eingesetzt
werden kann. Es ist entscheidend, sich bewußt zu machen, wie das
Lernen ablaufen kann, um so die eigenen Lernstrategien zu verbessern, aber
auch, um unsere Schüler darauf aufmerksam zu machen. Ein Einblick
in diese Materie erweitert nicht nur unser deklaratives Wissen, sondern
vor allem auch das prozedurale und beansprucht vor allem das metakognitive.
Beilage: Das Lingua Puzzle
Ein theoretisches Beispiel für
kognitives Lernen im Fremdsprachenunterricht
Hier wird versucht eine Passage eines inhaltlich bereits einigermaßen
verstandenen Hörtextes in allen Details, d.h. wortgetreu zu rekonstruieren
und anschließend schriftlich zu fixieren. Die Aufmerksamkeit der
Lernenden wird auf alle Aspekte der Sprache gerichtet, wobei sämtliche
Ebenen des linguistischen Systems des Textes aktiviert werden.
1. Einen Ausschnitt eines Textes, der bereits authentisch gehört
wurde, auswählen. (Dauer ca. 20-30 Sekunden)
2. Die Passage mehrmals (5-10x) mit folgender Anweisung an die Lehrenden
vorspielen: Versuchen Sie so viel wie möglich von dem, was Sie verstehen
bzw. identifizieren können, mitzunotieren.
Nach diesen ersten Hördurchgängen wird das Notizblatt eines
Lernenden einem unvollständigen Puzzle gleichen.
z.B.
...............gestern.........Gerhard gesehen?
Ja.............Kaffee geg...........8 Uhr..........
Wann..........Haus.........gang
3. Informationsaustausch: Vergleichen und vervollständigen der
Notizen
4. Intensives Hören: Die Passage wird wiederum mehrmals angehört
5. Informationsaustausch: wie Punkt 3, aber in neuer personeller Zusammensetzung
6. Intensives Hören
7. Informationsaustausch: wie Punkt 3, aber in neuer personeller, auch
größerer Zusammensetzung
8. Gemeinsames Klären und Aufschreiben: die Ergebnisse werden an
die Tafel diktiert. Alles (auch divergierende Lösungen) wird angeschrieben
und durch nochmaliges genaues Hören geklärt.
Zeit: Insgesamt 30-40 Minuten (Buttaroni
/ Knapp, 1988)
Bibliographie
Anderson, J.R. (1989). Kognitive Psychologie. Eine Einführung
(2.Aufl.). Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft.
Angermeier, W.F.; Bednorz, P.; Schuster, M.(1991). Lernpsychologie
(2.erw. Aufl.). München; Basel: E. Reinhardt
Bausch, Christ, Hüllen, Krumm (1989). Handbuch Fremdsprachenunterricht.
UTB, Große Reihe, Tübingen: Francke Verlag
Buttaroni; Knapp (1988). Fremdsprachenwachstum, Wien
Duden (1990). Das Fremdwörterbuch (5. neu bearb. u. erw.
Aufl.).Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag
Edelmann, Walter (1993). Lernpsychologie (3. neu bearb. Aufl.).
Weinheim: Psychiatrische Verlags Union
Gadenne, Volker(1996). Bewußtsein, Kognition und Gehirn. Einführung
in die Psychologie des Bewußtseins. Bern; Göttingen; Toronto;
Seattle: Hans Huber Verlag
McLaughlin, Barry (1991). Theories of second-language learning.
London; New York; Melbourne: Edward Arnold
Opwiz, Klaus; Plötzner, Rolf (1996). Kognitive Psychologie mit
dem Computer. Ein Einführungskurs zur Simulation geistiger Leistungen
mit Prolog . Heidelberg; Berlin; Oxford: Spektrum, Akad. Verlag
Rohrer, Josef (1990). Zur Rolle des Gedächtnisses beim Fremdsprachenlernen
(3.Aufl.)Bochum: Kamp
Tönshoff, Wolfgang (1992). Kognitivierende Verfahren im Fremdsprachenunterricht.
Formen und Funktion. Hamburg: Verlag Dr. Kovac
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
7) Sprachentwicklung, Sprach- und Sprechstörungen
(Andrea Köck)
1. Einleitung
Das Thema meiner Arbeit lautet Sprachentwicklung und Sprachstörungen.
Im Zuge dieses schriftlichen Berichts werde ich den Spracherwerb beim Kind,
die häufigsten Arten von Sprachstörungen und schließlich
- als Beispiel für eine eher schwere und seltene Sprachstörung
- den elektiven Mutismus behandeln. Ich bin sehr froh, dieses Thema bearbeiten
zu können, weil es in mein Fach, Anglistik und Amerikanistik und Italiensch,
zwei Sprachstudien, sehr gut hineinpaßt. Aus diesem Grund habe ich
in Kapitel 2 auch einen Abschnitt vorgesehen, der auf die Einblicke, die
die Methodik des Fremdsprachenunterrichts von den Ergebnissen der Spracherwerbsforschung
gewonnen hat.
2. Der Spracherwerb
Laut Meyers Taschenlexikon (1995) bezeichnet Spracherwerb die Aneignung
der Fähigkeit, grammatikalisch richtige und semantisch verständliche
Sätze zu bilden, sprachliche Äußerungen zu verstehen und
situationsgerecht anzuwenden. Daß der Spracherwerb sehr systematisch
vor sich geht, obwohl die Nachahmung nur eine begrenzte Rolle spielt, ist
durch zahlreiche Beobachtungen erwiesen. Dieser Erwerb der Sprachregeln
läuft in allen bisher untersuchten Sprachen auf der Welt gleich ab,
und daher kommt man ohne die Annahme angeborener Spracherwerbsmechanismen
nicht mehr aus. Der Linguist Noam Chomsky meint weiters, diese Anlage sei
entscheidend für das Sprechenlernen. Aber welche Sprache gelernt wird,
das hängt von der Umwelt ab. Die Intelligenz spielt beim Spracherwerb
kaum eine Rolle und sogar Gehörlose erreichen einen hohen Grad an
sprachlicher Leistungsfähigkeit. Der Erwerb einer Sprache steht in
enger Wechselbeziehung mit der kognitiven Entwicklung da sich das Denken
in und durch die Sprache vollzieht. Im Folgenden bin ich eher auf die Entwicklung
grammatischer Strukturen als auf das Lernen von Bedeutungsinhalten eingegangen.
Der anatomische Bau unserer Stimmwerkzeuge, also vor allem unser Mund und
seine Organe, ist für die uns möglichen Sprachlaute, für
die universalen, bei allen Menschen vorhandenen Merkmale unserer Sprache
ausschlaggebend. Weiters muß man anmerken, daß sich zwar im
Laufe der allgemeinen Reifung des Gehirns ein Sprachzentum in der dominanten
Großhirnhälfte (meist links) ausbildet, aber zum Sprechen das
Zusammenwirken verschiedener Hirnstrukturen unerläßlich ist.
Wie vollzieht sich nun der systematische Spracherwerb? Prinzipiell lassen
sich folgende Stadien der Sprachentwicklung unterscheiden: Zwischen dem
4. und 5. Lebensmonat eines Kindes beginnt die Lallperiode. Nur bei taubgeborenen
Kindern verliert sich die spontane Lautbildung wieder. Aber hörfähige
Kinder bilden in spielerischen Lallmonologen immer vielfältigere Laute.
Dies tun sie umso mehr, je mehr man mit ihnen spricht. Erwachsene und Geschwister
gehen auf das Lallen ein, indem sie insbesondere solche Laute, die - zuerst
zufällig - richtigen Wörtern ähneln, öfter wiederholen
als sinnfreie Lallwörter. Im 10. Monat etwa wird das erste einfache
Wort, ein Lallwort wie zum Beispiel Mama, genannt. Der Säugling ahmt
die von seinem Zuhörer wiederholten Wörter wieder nach, denn
es ist offenbar für ihn sehr befriedigend, das erfreute Lächeln
im Gesicht über seinem Bett zu sehen. Es ist durchaus möglich,
dieses erste Wortlernen auf Bekräftigung zurückzuführen,
wie es die Behavioristen tun. Sie können damit den Erwerb eines Wortschatzes
ganz gut erklären: Kinder lernen so, Reaktionen (Wörter) mit
bestimmten Reizen (Gegenständen) zu verbinden. In weiteren Stadien
werden Einwortsätze, später Zwei- und Mehrwortsätze gebildet.
Die ersten deutschen Sprachentwicklungsforscher, Clara und William Stern,
haben 1907 die ersten Wörter von Kindern als Sätze aufgefaßt,
als Einwortsätze, die Befehls-, Affekt- und Wunschcharakter haben
können. Solche Sätze sind aber nur aus dem Zusammenhang einer
bestimmten Situation heraus verständlich, nicht für sich allein.
Die späteren Zweiwortsätze von Kindern weisen sogar Merkmale
auf, die die Kinder von ihren erwachsenen Vorbildern nie gehört haben.
Diese Sätze, beziehungsweise diese ersten Wortkombinationen haben
eine eigene Grammatik, die sogenannte Angelpunkt-Grammatik. Man sagt, die
Kinder sagen prinzipiell das Wichtigere zuerst. Meist handelt es sich jeweils
um eine Kombination aus einem Funktionswort, auch Operator oder Pivotwort
genannt, und einem sogenannten Inhaltswort. Die Funktionswörter gehören
der geschlossenen Wortklasse wie Artikel, Präposition oder Hilfsverb
an, während die individuell sehr variierten Inhaltswörter der
offenen Wortklasse angehören (Nomen, Adjektiv, Verb,...). Beispiele
für solche Zweiwortsätze aus englischen Studien von Miller und
Ervin (1964) und Braine (1963) wären z.B.: more car, more sing; boot
off, water off1.
Die Inhalte, die die Kinder mit diesen Wortkombinationen ausdrücken
wollen, wurden von Bloom (1970) wie folgt definiert: 1. Vorhandensein:
Die Kinder reden darüber, ob Objekte oder Personen vorhanden sind
(there doggie, that car). 2. Nicht-Vorhandensein und Verschwinden: In Situationen,
in denen gewöhnlich ein bestimmtes Objekt da, aber ein anderes Mal
nicht da ist, sagen die Kinder so etwas wie no baby, no milk, no bus. 3.
Wieder-Vorhandensein: Wenn ein Gegenstand verschwindet und dann wieder
zum Vorschein kommt, oder ein ähnlicher Gegenstand auftaucht, dann
kommentiert das Kind etwa so: more rabbit, another bubble2.
Weiters gibt es auch Zweiwortäußerungen, in denen sich nur
Wörter der offenen Wortklasse kombinieren. Die Erwerbsreihenfolge
grammatischer Strukturen ist bei allen Kindern recht ähnlich, bei
der Schnelligkeit des Erwerbs dieser Strukturen zeigen sich jedoch beträchtliche
Unterschiede. Kinder haben unterschiedliche Sprachentwicklungsraten. Beim
Gebrauch von Verben sprechen Kinder zunächst über Handlungen,
die Veränderungen und Bewegung im Raum involvieren, erst später
über statische Zustände. Zur sprachlichen Flexion kommt es im
Alter von etwa zweieinhalb Jahren. Über den Grammatikerwerb des Deutschen
sind folgende Punkte festzuhalten3:
Zweiwortäußerungen:
1. Im Deutschen sind die gleichen semantischen Funktionen wie auch in
anderen Sprachen vorhanden. 2. Die Endstellung des Verbs dominiert. 3.
Einzelne Flexionsmorpheme sind vorhanden.
Drei- und Mehrwortäußerungen:
4. Das grammatische Geschlecht der Substantive wird schnell und fast
fehlerlos erworben. 5. Der Erwerb der Kasusmarkierung verläuft langsam
und mit vielen Fehlern. Nominativ und Akkusativ werden am häufigsten
übergeneralisiert. 6. Der Erwerb der Verbkonjugationen verläuft
sehr schnell. 7. Vergangenheits- und Zukunftsformen werden erworben. 8.
Plural- und Vergangenheitsformen werden übergeneralisiert. 9. Die
wesentliche Verbstellungsregeln des Deutschen werden erworben. 10. Verneinung
und Frage werden formal korrekt markiert.
Komplexe Strukturen:
11. Satzgefüge mit verschiedenen Arten von Nebensätzen und
das Passiv treten auf. Altersmäßig kann man sagen, daß
Kindern zwischen 3 und 4 Jahren die wichtigsten syntaktischen Regeln geläufig
sind. Was den Erwerb des Wortschatzes betrifft, verfügen Dreijährige
bereits über ein Vokabular von 1000 Wörtern und mehr.
Wie schon erwähnt, spielt die Bezugsperson des Kindes, das die
Sprache erwirbt, eine entscheidende Rolle. Wenn Kinder ihre Muttersprache
erwerben, werden sie stets von ihrer Umwelt gelobt und motiviert. Eltern
bessern nicht jeden Fehler aus. Worauf es ihnen ankommt ist, daß
man ihr Kind versteht, das heißt, daß ihr Kind wahre Bedeutungsinhalte
vermittelt. Man verbessert das Kind zunächst nur dann, wenn es Äußerungen
macht, die nicht der Realität oder der Wahrheit entsprechen. Nach
fehlerhaften Äußerungen produzieren Erwachsene häufiger
Wiederholungen, die die korrekte grammatische Form geben, oder stellen
klärende Nachfragen. Die Kinder imitieren daraufhin die korrigierenden
Reformulierungen und es ist anzunehmen, daß Kinder korrigierende
Reformulierungen zu Spracherwerbszwecken nutzen. Bei den Bezugspersonen
unterscheidet man zwischen aufdringlichem und akzeptierendem maternalen
Interaktionsstil4. Der akzeptierende Stil enthält viele Fragen, folgt
dem Thema des Kindes und ist auf die Sache bezogen. Er ist - gekoppelt
mit echtem Interesse an der Kommunikation mit dem Kind - stark förderlich
für einen schnellen Fortschritt in der Sprachentwicklung und für
die gesamte kognitive Entwicklung des Kindes. Im Gegensatz dazu ist der
sogenannte aufdringliche maternale Interaktionsstil, der viele Direktiven
gibt und das Verhalten des Kindes kommentiert, kontraproduktiv. Für
ein kleines Kind ist das sogenannte emotionale Lernen von großer
Bedeutung. Durch seinen stark emotionalisierten Zugang zur Muttersprache
ist die konnotative Bedeutung eines Wortes oft viel wichtiger, als sie
uns Erwachsenen zu sein scheint. Der Umwelteinfluß spielt etwa ab
1 1/2 Jahren eine Hauptrolle beim Spracherwerb. Besonders bis zum Alter
von 5 Jahren werden die Weichen dafür gestellt, wie geschickt ein
Kind oder ein Jugendlicher später einmal im Umgang mit der Sprache
sein wird.
Die Erforschung des Erwerbs der Muttersprache hat entscheidend zur Entwicklung
neuer Methoden im Fremdsprachenunterricht beigetragen. Unter einer Vielzahl
an Methoden eine Fremdsprache zu unterrichten findet man auch den Ansatz
des Zweit- oder Fremdsprachenerwerbs (Second Language Acquisition). Bei
dieser Methode versucht man den Fremdsprachenunterricht nach den Regeln
des Spracherwerbs durchzuführen. Die Schüler müssen der
zu erlernenden Sprache so viel wie möglich ausgesetzt werden, damit
sie die Sprache auch unbewußt "aufschnappen" können. Die Schüler
sollten das Recht haben, im Anfangsunterricht
einige Wochen lang nur zuzuhören und erst später mit dem Sprechen
beginnen zu dürfen. Der Input des Lehrers muß absolut verständliche
Bedeutungsinhalte enthalten, denn man lernt nur Dinge, die man versteht.
Und wie ich schon oben anmerkte, sollte man als Lehrer darauf verzichten,
jeden grammatikalischen Fehler sofort auszubessern, solange der Schüler
verständliche Bedeutungsinhalte vermitteln kann. Das Ziel im Spracherwerb
ist es, sich richtig aber vor allem verständlich ausdrücken zu
können. Deshalb sollte man auch im Fremdsprachenunterricht auf eine
klare Aussprache achten.
3. Sprachstörungen
Sprachstörungen werden in Meyers Taschenlexikon (1995) als Abweichungen
von den (alterstypischen) Normen der Sprache bzw. des Sprechens definiert.
Gelegentlich werden Sprachfehler als Normvarianten ohne wesentliche Einschränkung
der Mitteilungsfähigkeit der gravierenderen, langfristig behandlungsbedürftigen
Sprachbehinderung gegenübergestellt. Die häufigsten Sprachstörungen
sind Stammeln, bzw. Paralalie, Agrammatismus, Näseln (Rhinolalie),
Stottern und Poltern:
Stammeln: Fehlerhafte Artikulation, bei der bestimmte Laute oder Lautverbindungen
falsch gebildet (Dyslalie), durch andere ersetzt (Paralalie) oder ausgelassen
werden (Mogilalie).
Häufigste Form des Stammelns ist die fehlerhafte Bildung des S-Lauts
(Lispeln oder Sigmatismus), daneben auch des R-Lauts (Rhotazismus; vor
allem Ersetzung durch /l, x, h/), des K- Lauts (Kappazismus; statt /k/
oder /g/ meist /t/ oder /d/) oder des L-Lauts (Lambdazismus; statt /l/
meist /r, j, n/). Ursachen sind anatomische Abweichungen der Sprechorgane,
Schwerhörigkeit, psychische Störungen, geistige Behinderung,
schlechte Sprachvorbilder. Als entwicklungsbedingtes Stadium tritt Stammeln
im Kleinkindalter auf.
Agrammatismus: Unvermögen, beim Sprechen Wörter grammatikalisch
richtig aneinanderzureihen. Krankhaft bei Hörstummheit, Schwachsinn
oder Aphasie.
Rhinolalie: Näseln, Sprachstörung infolge funktioneller oder
organischer Veränderungen im Bereich von Nase und Rachen.
Stottern: (Dysphemie). Mehrfache Unterbrechung des Redeflusses durch
unkoordinierte Bewegungen der Atmungs-, Stimm-, und Artikulationsmuskulatur.
Stottern ist die häufigste Sprachstörung im Kindesalter, etwa
1% der Kinder stottern. Gehäuft tritt Stottern im 3. und 4. Lebensjahr
auf, wenn die Denkgeschwindigkeit schneller ist als die Entwicklung der
Sprechfähigkeit. Nicht selten tritt Stottern verstärkt bei Anwesenheit
bestimmter Personen oder unter Streß auf. Bei länger anhaltendem
Stottern ist eine psychologische und logopädische Beratung bzw. Behandlung
angebracht. Auf Grund der unterschiedlichen Lokalisation im Gehirn können
Sprachverständnis und Sprechmotorik gesondert gestört sein, wie
es beispielsweise bei der Aphasie der Fall ist: Hierbei handelt es sich
um eine Sprechstörung infolge Schädigung des Großhirns
im Bereich der dominanten Großhirnhälfte bei gleichzeitiger
Unversehrtheit von Sprechorganen und Gehör.
Sprachstörungen lassen sich einteilen in Stimmstörungen (z.B.
Heiserkeit bei Kehlkopferkrankungen), Sprechrhythmusstörungen, wo
die Atmung wie beim Stottern unkoordiniert ist, und Artikulationsstörungen
wie z.B. beim Stammeln. Die Ursachen von Sprechstörungen sind sehr
verschiedener Art: Sie können auf neurologischen Schädigungen
beruhen (Dysarthrie), auf Mißbildungen der Sprachwerkzeuge (Stammeln),
Hörstörungen (z.B. Taubstummheit), frühkindlicher Gehirnschädigung,
schwerem Schwachsinn oder schwerer sozialer Deprivation. Zu den Sprachstörungen
zählen weiters die verzögerte Sprachentwicklung, die aber oftmals
aufholbar ist und bedingt sein kann durch frühkindlichen Autismus
oder Mutismus und schließlich Sprachstörungen bei seelischen
Krankheiten (z.B. Sprechangst). Eine Reihe von Sprachbesonderheiten (z.B.
Stammeln oder Schwierigkeiten beim Bilden grammatikalisch richtiger Sätze)
treten auch beim normalen Spracherwerb auf und sind nur dann als abnorm
zu werten, wenn sie über die übliche Altersstufen hinaus fortbestehen.
Frühe Erkennung und sprachpädagogische, logopädische, medizinische
oder psychotherapeutische Behandlung können häufig Spätschäden
vermeiden bzw. mindern.
4. Beispiel elektiver Mutismus
Abgesehen von einer genetisch bedingten Mutismusform ("Neurotransmitter-Theorie"),
ist Mutismus zunächst Stummheit bei vorhandener Sprechfähigkeit,
als vollständige (zuweilen monate- oder jahrelange) Unterbrechung
des Sprachkontakts, was man als totalen Mutismus bezeichnet. Beim elektiven
Mutismus handelt es sich um eine Sprechverweigerung in bestimmten Situationen.
Mutismus tritt bei psychischen Erkrankungen (Depressionen, Schizophrenie,
Hysterie) und neurotischer Fehlentwicklung des Kindes auf. Das Hauptmerkmal
des elektiven Mutismus ist eine ständige Weigerung in nahezu allen
sozialen Situationen zu sprechen, auch in der Schule, trotz der Fähigkeit,
Gesprochenes zu verstehen und zu sprechen. Diese Kinder können sich
durch Gesten mitteilen, indem sie nicken, den Kopf schütteln oder
in anderen Fällen, durch einsilbige oder kurze monotone Äußerungen.
Kinder mit dieser Störung haben im Allgemeinen normale sprachliche
Fähigkeiten, obgleich bei einigen eine verzögerte Sprachentwicklung
und Artikulationsanomalien vorliegen. Die Weigerung zu sprechen ist jedoch
nicht auf Sprachinsuffizienz oder eine andere psychische Störung zurückzuführen.
Der elektive Mutismus wird oft von Auffälligkeiten wie Konzentrations-
und Leistungsstörungen, Trotzverhalten, Daumenlutschen, Nägelkauen
und Ähnlichem begleitet. In manchen Fällen wird auch der Verdacht
einer frühkindlichen Hirnschädigung aufrecht erhalten. Außerdem
ist die durch den Abbruch verbalen Kontakts bedingte, sich immer mehr verstärkende
soziale Behinderung (Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen) zu
beobachten5.
Beim Syndrom elektiver Mutismus unterscheidet man zwischen Mutismus
bei Psychosen, Mutismus bei hirnorganisch bedingten Störungen des
Sprechantriebs und psychogenem Mutismus. Im Folgenden werde ich mich hauptsächlich
auf die zuletzt genannte Art beziehen.
Psychogener Mutismus ist eine Störung, die psychologisch auflösbar
und aus charakterologisch oder erlebnismäßig gegebenen Ursachen
herzuleiten ist. Einerseits tritt dieser Mutismus wiederum elektiv auf,
d.h. er wirkt sich nur einem bestimmten Personenkreis gegenüber aus
oder er ist total und hat konsequentes Nichtsprechen gegenüber allen
Personen zur Folge. Was sind nun die Charakteristika elektiv mutistischer
Kinder? Bereits vor Manifestation der Störung werden die Kinder als
kontaktempfindlich, scheu, ängstlich, eigensinnig und tyrannisch geschildert.
KOLVIN & FUNDUDIS (1981) geben folgende Charakteristika an: Entwicklungsverzögerung,
prämorbide Persönlichkeitszüge (Schüchternheit, soziales
Rückzugsverhalten), eine höhere Quote von Verhaltensauffälligkeiten,
niedrige Intelligenz und psychiatrische Auffälligkeiten in der Familie.
Häufigkeit, Geschlechterverteilung, Alter, Verlauf:
Der elektive Mutismus ist eine sehr seltene Störung und tritt im
Allgemeinen bei Mädchen häufiger auf, was dem sonst im Kindesalter
gültigen Verbreitungsmuster psychischer Störungen widerspricht.
Am häufigsten zeigt sich ein Auftreten von elektivem Mutismus, wenn
die Kinder die gewohnte häusliche Umgebung verlassen, das heißt,
Kindergarten- oder Schuleintritt. Deshalb fallen die meisten Störungen
in den Zeitraum zwischen 3. und 5. Lebensjahr. Nach dem 9. Lebensjahr ist
ein Auftreten dieser Störung äußerst selten. Je nach Dauer
der Störung unterscheidet man zwischen zwei Formen des elektiven Mutismus.
Die erste Form ist der sogenannte vorübergehende Mutismus (transient),
der speziell dann auftritt, wenn die Kinder das erste Mal zur Schule kommen.
Dauert die Störung länger als sechs Monate, so spricht man von
einer chronifizierter Störung, die sehr hartnäckig und deren
Behandlung äußerst schwierig ist. Die Erfolgsquoten sind abhängig
von den unterschiedlichen Mutismusformen äußerst different.
Im Allgemeinen kann jedoch behauptet werden, daß die Prognose relativ
gut ist. Lediglich bei Kindern, die bis zum 5. Lebensjahr noch keine Sprache
entwickeln konnten, zeigen sich ungünstigere Prognosen. Oft beginnen
ehemals mutistische Kinder in der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter wieder
zu sprechen.
Die Familien elektiv mutistischer Kinder sind meist in einem Punkt auffällig,
dies kann sich sowohl in sprachlichen, psychischen oder Interaktionsproblemen
manifestieren. Die Familiensituation gilt als wesentlicher Faktor für
das Auftreten des Syndroms. Elternteile zeigen ernsthafte Aggression, Schüchternheit,
haben Depressionen oder Neurosen. Weiters treten oft schwere eheliche Disharmonie
oder bzw. und Persönlichkeitsprobleme auf. Väter und Mütter
elektiv mutistischer Kinder befinden sich auch häufig in psychiatrischer
Behandlung. Die Familien fallen durch abnorme Interaktionssysteme auf und
meistens zeigt sich eine abnorme Mutter-Kind-Beziehung. Auf Grund von Überbehütung
wird dem Kind wiederholt gesagt, daß es sich unter keinen Umständen
mit fremden Erwachsenen unterhalten darf, was natürlich symptomverstärkend
wirkt. Besonders negativ wirken sich auch Trennungserlebnisse vor dem 3.
Lebensjahr aus. Besonders kraß ist die Situation bei Einwandererfamilien
. Hier wird die für Mutisten typische Symbiose Mutter und Kind aufgrund
mangelnden Beherrschens der Fremdsprache und dem Gefühl der Fremdheit
noch verstärkt. Sprache: Oft hängt elektiver Mutismus mit verzögerter
Sprachentwicklung zusammen. Die Hauptursache dieser verzögerten Sprachentwicklung
wird aber hier keinesfalls im organischen Bereich vermutet, sondern vielmehr
aufgrund einer Deprivation im sprachlichen Bereich. Defizite oder Fehlen
sprachlicher Anregungen durch die unmittelbare Umgebung in einem bestimmten
Entwicklungsabschnitt können zu gravierenden und teilweise irreversiblen
Störungen der sprachlichen Fähigkeiten führen. Verzögerte
Sprachentwicklung findet man vor allem bei Kindern aus entlegenen Gegenden
mit wenig Zuwendung und sprachlicher Anregung. Eine Untersuchung (RÖSLER
1981) zeigt, daß 93% der elektiv mutistischen Kinder aus ländlichen
Gegenden stammen sollen, in denen noch dazu starker Dialekt gesprochen
wurde. Therapie: Heilpädagogisch empfiehlt man die Ausschaltung schädigender
Umwelteinflüsse, eine langsame Gewöhnung an jedes ungewohnte
Milieu und die Förderung des aktiven Sichdurchsetztens, sowie eine
Nichtbeachtung der Sprechstörung.
Die therapeutische Einwirkung muß unbedingt auf mehreren Ebenen
passieren. Es ist sowohl eine individuelle Therapie des Kindes als auch
gezielte Einbeziehung von Eltern und Umwelt notwendig. Das Therapieangebot
umfaßt neben Hypnose, Milieuveränderung, Sprachtherapie die
am häufigsten angewandten Methoden der Psychotherapie, Verhaltenstherapie
und Familientherapie.
5. Zusammenfassung und persönliche Stellungnahme
Der Spracherwerb beim Kind ist ein sehr vielschichtiger und schwieriger
Prozeß. Das Baby ist der Muttersprache lange Zeit "nur" ausgesetzt,
bevor es bereit ist, die ersten eigenen Wörter zu artikulieren. Auch
die Erforschung des Spracherwerbs hat wieder einmal bewiesen, daß
ein guter Kontakt zu mindestens einer Bezugsperson lebenswichtig für
die Entwicklung, hier im Speziellen für eine normal verlaufende Sprachentwicklung,
ist.
Eine Reihe von Sprachstörungen kann im Verlauf der Sprachentwicklung
auftreten, mit irgendeiner vorübergehenden Sprachstörung, einer
fehlerhaften Artikulation bestimmter Laute etwa, werden die meisten Kleinkinder
und Eltern zu kämpfen haben. Nur wenn eine Sprachstörung über
die jeweilige Entwicklungsstufe hinaus erhalten bleibt, oder überhaupt
erst später auftritt, dann erst wird eine Sprachstörung zu einem
ernstzunehmenden Problem. Sollte ein Schüler, der die AHS oder BHS
besucht, beispielsweise stottern, ist es wichtig, daß man ihm Zeit
gibt, sich langsam aber sicher auszudrücken. Der Lehrer sollte ihn
nie drängen, denn wenn der "Stotterer" erst einmal unter Streß
steht, wird es ganz sicher nicht zu einer klaren Äußerung kommen
können. Ich denke, daß man ansonsten Sprachstörungen bei
Schülern nicht weiter beachten sollte, soferne der betreffende Schüler
mit dieser sprachlichen Behinderung zurechtkommt. Falls nötig, sollte
man die Mitschüler darauf aufmerksam machen, das ein Nicht-Beachten
der Sprachstörung kombiniert mit ein wenig Geduld der betreffenden
Person gegenüber wahrscheinlich der beste Weg ist, das Problem zu
mindern. Sollte man als Lehrer jedoch bemerken, daß eine Sprachstörung
einem bestimmten Schüler schwer zu schaffen macht, ist es sicher ratsam,
vielleicht nach Absprache mit Kollegen und Eltern, bzw. dem Schularzt,
den Schüler zu einer Therapie zu bewegen.
Allgemein gesprochen sind Sprachstörungen nur ein Bruchteil von
der Menge an Problemen, mit denen man im Schulalltag konfrontiert wird.
Das Seminar hat sicher zu einer Bewußtwerdung der einzelnen Problemgebiete
geführt. Es war sehr hilfreich über die verschiedensten Problematiken
genaueres zu erfahren und Schule einmal mehr als Lebensraum als als bloße
Bildungsstätte zu betrachten.
Anmerkungen:
1 Vgl. Szagun, G. (1996) S. 14
2 Vgl. Szagun, G. (1996) S. 18-19
3 Ebenda S. 41
4 Vgl. Szagun, G. (1996) S. 240
5 Vgl. Damisch, B. (1988) S. 82
6. Bibliographie
Damisch, B., Marothy, T. et al (1988). Elektiver Mutismus. In: P. Innerhofer,
G. Weber et al. (Hrsg.), Psychische Auffälligkeiten und Probleme im
Schulalter (S.80-94). Wien: Wiener Universitätsverlag.
Meyers Großes Taschen Lexikon. (1995). (5. Überarbeitete
Aufl.). Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: BI-Taschenbuchverlag.
Popp, M. (1995). Einführung in die Grundbegriffe der Allgemeinen
Psychologie (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
Szagun, G. (1996). Sprachentwicklung beim Kind (6. Überarbeitete
Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Wagner, I. (1983). Psychologie: Eine Einführung. Gütersloh:
Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH/ Lexikothek Verlag GmbH.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
8) Motivationspsychologie (Birgit Wolf)
I. Einleitung
Motiv und motivieren sind zwei Ausdrücke, die in
unserer alltäglichen Sprache oft vorkommen. Motiv ist uns bekannt
als dargestellter Gegenstand etwa auf einem Foto oder einem Bild, als kurze
melodische Einheit in der Musik, oder auch als Grund für eine Handlung
(vor allem im kriminellen Sinn). Demzufolge kann man eine Handlung motivieren,
d.h. sie begründen, rechtfertigen. Im "herkömmlichen Sinn" verwendet
man motivieren aber vor allem in der Bedeutung, jemanden aus seiner
Lustlosigkeit zu reißen und ihn für etwas zu gewinnen, zu begeistern.
In der so "motivierten" Person wirkt dann "Motivation", die sie vorantreibt
und anspornt.
In einem allgemeinen Lexikon findet man unter Motiv im psychologischen
Sinn die Erklärung "svw. Bestimmungsgrund des menschl. (und tier.)
Verhaltens" und unter Motivation die Definition "die Summe jener
Beweggründe, die bestimmten Verhaltensweisen oder Handlungen vorausgehen
und sie leitend beeinflussen" (Brockhaus 1995, S 512).
Laut Heckhausen wird Motivation verwendet als "Sammelbezeichnung
für Erklärungen von Wenn-Dann-Beziehungen, die vorauslaufende
Bedingungen der Situation mit nachfolgendem Handeln verbinden". Motive
sind hypothetische Konstrukte zur Erklärung individueller Unterschiede
hinsichtlich Zielgerichtetheit, Intensität und Ausdauer des Handelns
unter sonst gleichen Bedingungen. (vgl. Heckhausen 1980, 30)
So lautet also eine psychologisch-wissenschaftliche Definition von Motiv
und Motivation, die, wenn auch gewisse Gemeinsamkeiten bestehen,
vom alltäglichen Verständnis der Begriffe noch weiter wegführt
als die allgemein-wissenschaftliche Definition. Doch sie ist auch nur eine
von vielen möglichen Definitionen, da es in der Motivationspsychologie
die verschiedensten Theorien gab und noch immer gibt. Im folgenden möchte
ich einen kurzen Überblick über die wichtigsten dieser Theorien
geben, die sich alle zum Ziel gesetzt haben, die Beweggründe menschlichen
Verhaltens zu ergründen. Dabei werde ich eine Einteilung in Triebreduktionstheorien,
Erwartungs-Wert-Theorien sowie kognitive Attributionstheorie vornehmen
und im wesentlichen den Ausführungen Weiners folgen (Weiner 1976 und
1984). Abschließend möchte ich kurz die Motivationsförderung
im Unterricht anschneiden.
II. Triebreduktionstheorien
2.1. Die psychoanalytische Theorie Freuds
Zwei Grundprinzipien der Freudschen Theorien sind Homöostase
und Hedonismus. "Unter Homöostase versteht man die
Tendenz zur Erhaltung eines relativ stabilen inneren Milieus; d.h. der
Organismus ist bestrebt, in einem inneren Gleichgewicht zu verbleiben."
(Weiner 1984, 17) "Der Hedonismus [...] behauptet, daß Lustgewinn
und Glück die Hauptziele im Leben seien." (ebda. 19) Laut Freud sind
im Menschen Triebe vorhanden, deren Intensität zunächst
abnimmt, wenn sie befriedigt werden, dann aber wieder ansteigt. Im Unterschied
zum Instinkt als "nichtgelerntes, fixes, stereotypes Verhaltensmuster"
(ebda. 30) sind Triebe "Handlungspotentiale und werden als nichtgelernte
'Bedürfnisse' oder 'Impulse' betrachtet, die in die Struktur des Organismus
eingebaut sind" (ebda. 31). Welches nun die Grundtriebe im Menschen sind,
darüber war sich Freud selber nicht immer ganz schlüssig. Zunächst
meinte er, es gäbe zwei Grundtriebe, nämlich den der Selbsterhaltung
(Hunger) und den des Lustgewinns (Sexualität), später plädierte
er dafür, daß es nur einen für die Selbst- und Arterhaltung
zuständigen Grundtrieb gibt, und schließlich führte er
als die zwei Haupttriebe den Lebens- und den Todestrieb an.
Der Mensch strebt danach, seine Triebe zu erfüllen bzw. sein Es,
das Reservoir der gesamten psychischen Energie, strebt danach, unmittelbare
Lust zu erreichen durch homöostatische Prozesse und Spannungsreduktion.
Dafür gibt es laut Freud vier Motivationsmodelle, je nachdem, ob das
kontrollierende Ich zwischen Triebreiz und Verhalten geschaltet
wird (Sekundärmodell) oder nicht (Primärmodell), oder ob die
Erfüllung des Triebs durch eine Handlung (primäres und sekundäres
Handlungsmodell) oder durch einen gedanklichen Vorgang (primäres und
sekundäres Denkmodell) erfolgt:
|
Handlung |
Denken |
| Primärmodell |
Es - Handlung - Befriedigung
"Reflexbogen" |
Es - Objekt abwesend - Halluzination - Befriedigung
Phantasietätigkeit als Wunscherfüllung |
| Sekundärmodell |
Es - Ich - Umweghandlung -
Befriedigung
Ich verhindert unmittelbare
Triebbefriedigung |
Es - Ich - Pläne - Befriedigung
Kognitionen helfen bei der Zielerreichung |
Freuds Modelle der Motivation (Weiner 1984, 25)
Anhand dieses einen grundlegenden Handlungsprinzip, das mit der Befriedigung
sexueller und aggressiver Triebe zu tun hat, versucht Freud, eine Vielfalt
von Verhaltensweisen und Phänomenen zu erklären.
2.2. Die Hull'sche Triebtheorie
Im Gegensatz dazu versucht Hull, "die wesentlichen Handlungsdeterminanten
motivierten Verhaltens zu identifizieren und die mathematischen Beziehungen
zwischen den motivationalen Faktoren zu spezifizieren" (Weiner 1984, 73)).
In seinem rein mechanistischen Verhaltensmodell, das jeden Einfluß
des Denkens auf das Handeln ablehnt, geht Hull davon aus, daß durch
eine bestimmte Operation, etwa Entzug, im Menschen ein Bedürfnis oder
starke interne Reize entstehen, die eine allgemein den Organismus energetisierenden
Trieb erzeugen. Multiplikativ verbunden mit einer richtungsgebenden,
erlernten Reiz-Reaktions-Verbindung, dem Habit, und einem entsprechenden
Anreizwert kommt es zu einer bestimmten Handlung. Das läßt
sich in der folgenden Formel darstellen:
Verhalten = Trieb x Habit x Anreiz
Anders gesagt, ein erlerntes Reiz-Reaktions-Schema (z.B. in Tierexperimenten
das Drücken einer Taste zwecks Futterzufuhr) wird nur aktiviert, wenn
auch der entsprechende Trieb vorhanden ist (die Tiere hungrig sind) und
tatsächlich eine entsprechende Belohnung in Aussicht ist (genug Futter,
das den Tieren auch schmeckt).
III. Erwartungs-Wert-Theorien
3.1. Kurt Lewins Feldtheorie
Lewins ahistorische Feldtheorie enthält noch viele der von
Freud und Hull vertretenen Ideen der Spannungsreduktion. Doch diese Spannungsreduktion
geht nicht "automatisch" vor sich, sondern es spielen auch kognitive Prozesse
eine Rolle. Lewin geht davon aus, daß das Verhalten einer Person
von dessen Feld abhängt, d.h. von einer bestimmten zu einem gegebenen
Zeitpunkt wirkenden Beziehung oder Konstellation zwischen Person und (psychischer)
Umwelt. (V = f (P,U))
In diesem Konzept ist der Mensch ein Punkt oder ein Bereich, der aus
verschiedenen Bereichen besteht, die durch mehr oder weniger durchlässige
Grenzwände getrennt sind, wobei benachbarte Bereiche ähnliche
Bedürfnispotentiale darstellen. Entsteht in einem bestimmten Bereich
eine Spannung, so kann, wenn sie nicht durch Erreichen des Ziels gleich
wieder abgebaut wird, auch ein Teil der Spannung in benachbarte Bereiche
fließen und so auch dort zu einem Bedürfnis führen, bzw.
eine Befriedigung der Bedürfnisse in diesem Bereich auch die Spannung
im ursprünglichen Bereich abbauen. Auch die Umwelt ist in Bereiche
aufgegliedert, die in diesem Fall jedoch instrumentellen Handlungen entsprechen,
die eine Person durchführen muß, um an ihr Ziel zu gelangen.
Die Anzahl der für die Person zugänglichen Räume hängt
von externen Verboten und persönlichen Grenzen (z.B. Fähigkeiten)
ab.
Wie groß die Kraft ist, die eine Person zur Erreichung eines Zieles
drängt, hängt von der Valenz des Zielobjekts (Va(Z)) ab,
die eine Funktion der Spannung in der Person (s) und der Beschaffenheit
des Zielobjekts (Z) darstellt, und von der relativen wahrgenommenen (psychologischen)
Entfernung der Person vom Ziel (e):
Kraft [k] = f [Va(Z) / e] = (s, Z) / e
Erreicht die Person ihr Ziel, wird die Spannung in ihr abgebaut, das
Zielobjekt verliert seine Valenz, die Handlung wird eingestellt. Ist eine
Person in dem Konflikt, mehrere verschiedene Ziele vor sich zu haben, so
entscheidet sie sich für das, von dem die größere positive
Kraft ausgeht bzw. die kleinste negative Kraft.
3.2. Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation
Als wichtige Vorläufer der Theorie der Leistungsmotivation sind
zu nennen Henry Murray und David McClelland. Henry Murray hat in seiner
Taxonomie zwanzig menschlicher Bedürfnisse auch das der Leistung behandelt
und einen bis heute bedeutenden Persönlichkeitstest zur Messung von
Bedürfniszuständen entwickelt (TAT = Thematische Apperzeptions-Test),
in dem die Versuchspersonen zu ihnen vorgelegten Bildern die darauf dargestellte
Handlung, die Gedanken der Personen, die Vorgeschichte und die mögliche
Fortsetzung nennen müssen. David McClelland hat mit seinen Mitarbeitern
die Leistungsmotivation systematisch weitererforscht anhand einer verbesserten
Version des TAT.
1957 veröffentliche John Atkinson erstmals seine Theorie der Leistungsmotivation,
die die Leistungsmotivationsforschung der nächsten zehn Jahre bestimmte.
Atkinson meint, die Tendenz, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen (Erfolg
anzustreben (Te) bzw. Mißerfolg zu meiden (Tm)),
sei abhängig von einem relativ stabilen Persönlichkeitsmerkmal,
dem Motiv (Motiv, Erfolg anzustreben (Me) bzw. Motiv,
Mißerfolg zu meiden (Mm)), das anhand des TAT bzw. des
TAQ (Test Anxiety Questionnaire), eines Angstfragebogens, festgestellt
wird, von der Erwartung bestimmter Verhaltenskonsequenzen (subjektive Erfolgs-
(We) bzw. Mißerfolgswahrscheinlichkeit (Wm))
und dem Anreizwert dieser Konsequenzen (Anreiz des Erfolgs (Ae)
- Stolz - bzw. negativer Anreiz des Mißerfolgs (Am) -
Scham). Die drei bestimmenden Komponenten werden dabei multiplikativ miteinander
verknüpft:
Te = Me x We x Ae bzw. Tm
= Mm x Wm x Am
Der Anreizwert des Erfolgs steigt mit sinkender Erfolgswahrscheinlichkeit
(über die erfolgreiche Durchführung einer schwierigen Aufgabe
wird mehr Stolz empfunden).
Ob eine Person sich nun einer Leistungsaufgabe zuwendet oder sie meidet
(resultierende Tendenz (Tr)), hängt nun einerseits davon
ab, ob die Summe von Te und Tm negativ oder positiv
ist (Tr = Te + Tm), und außerdem
von der Stärke sogenannter extrinsischer, von außen wirkender
Motive (z.B. Belohnungen durch die Eltern, Wunsch nach guten Noten, Streben
nach sozialem Anschluß,...):
Leistungsverhalten = Tr + extrinsische Motivation (Tex)
Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation hat viele Erweiterungen und
Revisionen erfahren, vor allem aber eine intensive Forschungsrichtung vorangetrieben,
die als "kognitive Wende" bezeichnet wird.
3.3. Rotters Theorie des sozialen Lernens
Die sozialen Lerntheoretiker gehen davon aus, daß die wesentlichen
Determinanten des Verhaltens erlernt sind und daß eine der wichtigsten
Lernformen das Beobachtungslernen (an "Live-Modellen" oder symbolischen
Modellen (Medien)) ist. Dabei reagieren Menschen aber nicht automatisch
oder reflexhaft, durch pure Nachahmung, sondern sehr situationsspezifisch.
Rotters Theorie baut auf vier grundlegende Begriffe auf: Das Verhaltenspotential
(VP) ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein gegebenes Verhalten in einer
bestimmten Situation auftreten wird (ein Mann will auf einer Party eine
Frau kennenlernen: spricht er sie direkt an? wartet er auf eine passende
Gelegenheit? nimmt er an einem Gesellschaftsspiel teil, bei dem sie auch
mitmacht?...); die Erwartung (E) wird definiert als "die vom Individuum
vermutete Wahrscheinlichkeit, daß ein bestimmtes Verhalten
in einer bestimmten Situation zu einer bestimmten Verstärkung
führen wird" (der Mann glaubt, wenn er sich selbst vorstellt, empfindet
die Frau das als unhöflich und weist ihn ab); die generalisierte
Erwartung (GE) wird bestimmt durch Erfahrungen in einer ähnlichen
Situation (der Mann erwartet, die Frau kennenlernen zu können, wenn
er so handelt, wie er schon in anderen Situationen erfolgreich Bekanntschaften
geschlossen hat); die Verstärkungserwartung in einer bestimmten Situation
ist dann eine Funktion von E und GE (je neuartiger die Situation ist, umso
wichtiger ist GE; hat der Mann schon viel Erfahrung in dieser spezifischen
Situation (eine Frau auf einer Party kennenlernen), so wird GE das Verhalten
nur wenig beeinflussen; der Verstärkungswert (VW) bezeichnet
den subjektiven Wert, den eine Person einem Verstärker, gemäß
ihren aktuellen Bedürfnissen, beimißt.
Daraus leitet sich folgende Formel ab:
VPx,s1,va = f (Ex,vas1 & VWa,s1)
"Das Potential eines Verhaltens x, das sich auf Verstärkung a bezieht,
in Situation 1 aufzutreten, ist eine Funktion der Erwartung, daß
die Verstärkung a dem Verhalten x in Situation 1 auch wirklich folgt,
und eine Funktion des Wertes, den die Verstärkung a in der Situation
1 hat."
Erwartung und Wert werden dabei als voneinander unabhängig angesehen.
Ihr jeweiliges Verhältnis zueinander ist jedoch von großer Bedeutung.
So kann etwa eine niedrige Zielerwartung bei gleichzeitig hoher Bewertung
des Ziels zu persönlichen Problemen und Verhaltensstörungen führen.
Aus Rotters Theorie haben sich mehrere Forschungsansätze entwickelt,
die sich vor allem damit beschäftigen, welche Auswirkungen es auf
den Menschen, seine Motivation, seine Erwartungsänderung hat, ob er
Erfolg bzw. Mißerfolg als von seinem Handeln, seiner Kontrolle abhängig
empfindet (internal kontrolliert) oder als zufallsabhängig bzw. von
anderen abhängig (external kontrolliert), und mit der Wechselwirkung
zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
IV. Eine kognitive Theorie - die Attributionstheorie
Attributionstheoretiker beschäftigen sich mit den wahrgenommenen
Ursachen für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses (die Betonung
liegt auf wahrgenommen, im Gegensatz zu Lewins Ausgangspunkt von
tatsächlichen Ursachen). Der Begründer der Attributionstheorie,
Fritz Heider (Weiner hat dessen Theorie dann weiterentwickelt), geht davon
aus, daß jedes Handlungsergebnis eine Funktion von (wahrgenommenen)
Personenfaktoren ("Bemühen", multiplikativ verknüpft mit "Macht")
und Umweltfaktoren (Umweltkraft) ist (Handlungsergebnis = f (Bemühen,
Macht, wirksame Umweltkraft)). Laut Kelley, der eine Systematisierung von
Faktoren vorgenommen hat danach, ob sie zu einer Kausalattribution auf
Faktoren der Person oder Faktoren der Umwelt führen, ist zu dem Ergebnis
gekommen, daß eher eine externale Attribution vorgenommen wird, wenn
die Distinktheit einer Reaktion (in verschiedenen Situationen verschiedene
Reaktionen), ihre Konsistenz (in dieser bestimmten Situation sind die Reaktionen
der meisten Menschen so) und Konsequenz (in ein und derselben Situation
reagiert eine Person immer gleich) gegeben sind.
Laut kognitivem Theorieansatz ist das Verhalten eine Funktion der Zielerwartung
und der emotionalen Konsequenz der Zielerreichung. Es spielt
nun eine große Rolle für die Bewertung eines Handlungsergebnisses
und für zukünftige Erwartungen und Anreize (die zukünftige
Handlungen bestimmen), auf welche Faktoren ein Mensch das Handlungsergebnis
zurückführt. Vereinfacht dargestellt entscheiden (vor allem in
einer Leistungssituation) vier Komponenten über Erfolg oder Mißerfolg.
Diese lassen sich einerseits danach aufteilen, ob sie personenabhängig
(internal) oder umweltbezogen (external) sind bzw. danach,
ob sie mehr oder weniger stabil oder variabel sind:
|
Personabhängigkeit |
| Stabilität |
internal |
external |
| stabil |
Begabung, Fähigkeit |
Beschaffenheit der Aufgabe |
| variabel |
Anstrengung, Stimmung, Müdigkeit, Krankheit,... |
Glück, Einfluß anderer Personen,... |
nach Weiner 1984, 270
Generell ist die Einschätzung der Begabung einer Person bedingt
durch die Anzahl, den Prozentsatz und die Reihenfolge von Erfolgserfahrungen
bei vorangegangenen Leistungen, unter Berücksichtigung der erlebten
Schwierigkeit der versuchten Aufgaben. Die Aufgabenschwierigkeit ergibt
sich entweder durch den sozialen Vergleich (subjektive Schwierigkeit) oder
durch eine objektive Bewertung der Aufgabe. Der Hinweis auf die Glücksattribution
liegt meist in der Aufgabe oder Situation selbst (Glücksspiel; zufälliges
Ereignis). Auf Anstrengung läßt sich schließen durch das
Leistungsergebnis oder wahrgenommene Körpersignale (Schweiß,...).
Doch im Leistungskontext lassen sich individuelle Unterschiede bei der
Kausalattribuierung feststellen, bedingt durch die unterschiedliche Größe
des Leistungsmotivs. Je nachdem, ob "Mißerfolgsängstliche" (niedrig
Leistungsmotivierte) oder "Erfolgsorientierte" (hoch Leistungsmotivierte)
ihre Leistungen einschätzen, nehmen sie unterschiedliche Attribuierungen
vor. Die wichtigsten Tendenzen sind folgende:
Hoch Leistungsmotivierte schreiben Erfolge eher internalen Faktoren
zu (was ihnen ein Gefühl des Stolzes, der Kompetenz und der Zuversicht
gibt), Mißerfolge hingegen eher externalen Faktoren (wodurch wiederum
die Hoffnung auf Erfolg und damit die Leistungsmotivation, intensives und
ausdauerndes Leistungsverhalten andauert). Für sie stellt die Anstrengung
eine wichtige Determinante des Leistungsergebnisses dar, weshalb sie sich
auch anstrengen. Außerdem sind für sie Aufgaben mittlerer (subjektiver)
Schwierigkeit am meisten motivationsfördernd, da gerade dort entsprechende
Anstrengung nötig und zielführend ist (bei zu leichten oder zu
schwierigen Aufgaben ist die Aufwendung von Anstrengung Verschwendung).
Niedrig Leistungsmotivierte hingegen empfinden Erfolg als vom Glück
bedingt (weshalb sich die positiven Affekte des hoch Leistungsmotivierten
kaum einstellen) und Mißerfolg als von mangelnder Fähigkeit
bedingt (was zu Unzufriedenheit, Scham,.. führt). Sie glauben nicht
an die Effektivität von Anstrengung, was dazu führen kann, daß
sie in Zukunft ein wenig intensives Leistungsverhalten zeigen und Anstrengung
überhaupt vermeiden.
V. Motivationsfördernder Unterricht
Wie man sieht, befinden sich solche Mißerfolgsorientierte in einem
Teufelskreis, der es ihnen fast unmöglich macht, ihre Leistungen zu
verbessern. Um ihnen zu helfen, muß man sie dazu bringen, ihr Leistungsmotiv
zu verändern. Das Leistungsmotiv hängt jedoch nicht nur zusammen
mit der Ursachenerklärung für Erfolg und Mißerfolg (Attribution),
sondern auch mit individuellen Zielsetzungen (Anspruchsniveau) und dem
Bewertungsmaßstab der eigenen Leistung (soziale - d.h. an der Leistung
der anderen gemessene - vs. individuelle - an der eigenen Leistungsentwicklung
gemessene - Bezugsnorm-Orientierung) (vlg. Weßling-Lünnemann
1985, 8).
Motivänderungsprogramme für Schüler zielen daher darauf
ab, daß die Schüler lernen, sich selbst realistische Ziele zu
setzen, Erfolg oder Mißerfolg nicht an der Leistung der anderen messen,
sondern an ihrem eigenen Fortschritt, und daß sie eine angemessene
Attribuierung vornehmen. Dazu müssen natürlich auch die Lehrer
ihren Teil beitragen und ihre Wertungen und ihr Verhalten umstellen. Sie
sollten etwa eine individuelle Bezugsnormorientierung verwirklichen, differenzierte
Aufgabenstellungen geben, die Schüler selbst entsprechende Aufgabenschwierigkeiten
wählen lassen, (Miß-)Erfolge der Schüler auf (mangelnde)
Anstrengung attribuieren,... Im Anhang befinden sich Tabellen mit konkreteren
Angaben zu sozialer vs. individueller Bezugsnormorientierung und zu motivationsförderndem
vs. motivationshemmendem Lehrerverhalten.
VI. Zusammenfassung
Die Motivationspsychologie ist ein sehr weites und vielfältiges
Feld, das sich keinesfalls auf so engem Raum zufriedenstellend darstellen
läßt. So war auch in dieser Arbeit nur eine sehr grobe und übersichtsmäßige
Darstellung der wichtigsten Theorien in der Entwicklung der Motivationspsychologie
möglich.
Die psychoanalytische Theorie von Freud und die Hullsche Triebtheorie,
die lange Zeit eine dominierende Stellung in der Motivationsforschung eingenommen
haben, sind zwar sehr verschieden, gehen aber beide von Spannungs- oder
Bedürfnisreduktion als grundlegendem Handlungsprinzip aus.
Unter den sogenannten Erwartungs-Wert-Theorien, die einen Übergang
zwischen mechanistischer und kognitiver Theorie darstellen, sind vor allem
die Feldtheorie Lewins, Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation und Rotters
Theorie des sozialen Lernens zu nennen. In ihnen ist Verhalten eine Funktion
der Zielerwartung und des Anreizwerts des Zieles.
Gemeinsamkeiten zwischen der Hull'schen Theorie und der Theorie Lewins
sind, daß jeweils ein motivationaler Zustand der Person (Trieb/Spannung),
der Anreizwert des Ziels (Anreiz/ Attraktivität des Zielobjekts),
und eine Richtungs- bzw. Steuervariable (Habit/psychologische Distanz)
bestimmend für das Verhalten sind.
Bei der Leistungsmotivation bestimmen Erfolgserwartung und Anreizwert
des Erfolgs, für welche von mehreren leistungsbezogenen Tätigkeiten
sich eine Person entscheidet und wie sehr sie sich bei der Leistungsaufgabe
anstrengt.
Die Attributionstheorie als kognitive Theorie interessieren vorwiegend
die wahrgenommenen Ursachen von Ergebnissen menschlichen Handelns, vor
allem in leistungsbezogenen Kontexten. Kausalattribution beeinflußt
Emotion und Erwartung und trägt daher wesentlich zur Aufgabenwahl
und der Intensität und Dauer des Leistungsverhaltens bei.
Angemessene Attribuierung, realistische Zielsetzung und individuelle
Bezugsnormorientierung sind die wesentlichen Faktoren für Leistungsmotivation.
Im Schulbetrieb liegt es nun ganz wesentlich am Lehrer, die Schüler
durch entsprechende Gestaltung des Unterrichts, Äußerungen,
Benotung, etc. zu einer positiven Leistungsmotivation und bestmöglichen
Leistungen zu führen. Und das ist sicherlich eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe, zu der nicht nur das theoretische Wissen um motivationsfördernde
oder -hemmende Faktoren gehört, sondern viel guter Wille, Optimismus
und die Bereitschaft, auf die Schüler einzugehen sowie seine eigenen
Bewertungen immer wieder neu zu hinterfragen.
VII. Bibliographie
F.A. Brockhaus (Hrsg.). (1995). Der Brockhaus in drei Bänden.
(Bd. 2). Leipzig-Mannheim: Brockhaus.
Heckhausen, Heinz. (1980). Motivation und Handeln. Lehrbuch der Motivationspsychologie.
Berlin, Heidelberg, New York: Springer
Rheinberg, Falko, und Siegbert Krug. (1993). Motivationsförderung
im Schulalltag. Göttingen: Verlag für Psychologie.
Rotter, J.B., Chance, J.E., & Phares, E.J.. An introduction to social
learning theory. In: J.B. Rotter, JE. Chance, & E.J. Phares (Eds.).
(1972). Applications of a social learning theory of personality.
New York: Halt, Rinehart, & Winston. [zitiert nach Weiner 1984]
Rotter, J.B. (1954). Social learning and clinical psychology.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [zitiert nach Weiner, 1984]
Weiner, Bernard. (1976). Theorien der Motivation. Stuttgart:
Klett.
Weiner, Bernard. (1984). Motivationspsychologie. Weinheim und
Basel: Beltz.
Weßling-Lünnemann, Gerburgis. (1985). Motivationsförderung
im Unterricht. Göttingen: Verlag für Psychologie.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
9) Kreativität (Elisabeth Breier)
Was ist Kreativität?
"Kreativ sein" ist heute ein sehr häufig gebrauchtes Schlagwort.
Man richtet die Wohnung kreativ ein, man gestaltet das Blumenbeet kreativ,
man führt ein kreatives Gespräch, man macht einen Kreativurlaub
usw. Jeder will kreativ sein, aber was heißt das eigentlich: "kreativ
sein"?
Im Duden für sinn- und sachverwandte Wörter findet man:
unter "kreativ" den Verweis zu "schöpferisch", und unter "schöpferisch":
kreativ, gestalterisch, künstlerisch, einfallsreich, phantasievoll,
originell, produktiv, bahnbrechend, kunstvoll, richtungsweisend, selbständig,
schöpferisch sein = die ausgetretenen Pfade verlassen, - Außenseiter,
Genie.
Im Grimmschen Wörterbuch findet man:
unter "schöpferisch": einem Schöpfer gemäß,
fähig zu schaffen. Schöpferischer Geist und ähnl. schöpferische
Kraft, Trieb u. ähnl.
Im Duden für Zitate und Aussprüche findet man:
unter "Kreativität": "Wer zu spät an die Kosten denkt,
ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die Kosten denkt,
tötet die Kreativität." von Philip Rosenthal (*1916) dt. Politiker
und Industrieller.
und: "Ganz neue Zusammenhänge entdeckt nicht das Auge, das über
ein Werkstück gebeugt ist, sondern das Auge, das in Muße den
Horizont absucht." Carl Friedrich von Weizsäcker, Geschichte.
(Carl Friedrich Freiherr von, * Kiel 28. Juni 1912, Physiker und Philosoph)
Stellen wir uns eine Person vor, die erst mit 4 Jahren sprechen gelernt
hat, mit 7 Jahren noch nicht lesen konnte, im Gymnasium Probleme hatte,
die Aufnahmeprüfung für die UNI beim ersten Versuch nicht schaffte,
nach Beendigung des Studiums auf der UNI keinen Job bekommen hat, dann
nach längerem Suchen eine Beamtenstelle annehmen mußte.
Würde man diese Person für kreativ halten? Wahrscheinlich
nicht. Es handelt sich aber um eine der schöpferischten Personen,
die unserer Gesellschaft bekannt ist, nämlich um Albert Einstein.
Es stellt sich somit die Frage, welche Eigenschaften, Merkmale, Fähigkeiten
braucht ein Mensch, um kreativ sein zu können? Woran kann man erkennen,
daß es sich um einen kreativen Menschen handelt? Psychologen haben
Testverfahren entwickelt, um Kreativität - so wie Intelligenz - zu
untersuchen und zu messen, und sie zur Intelligenz in Verbindung zu setzen.
Was sagt uns die Psychologie zur Kreativität?
Die üblichste Definition von Kreativität lautet, sie sei das
Auftreten ungewöhnlicher oder ungebräuchlicher, aber angemessener
Reaktionen. Diese Annahme liegt den meisten Tests zugrunde, die zur Erfassung
der Kreativität entwickelt wurden. Es gilt als selbstverständlich,
daß Originalität ein Hauptfaktor der Kreativität ist. Hingegen
wird die Bedeutung der Angemessenheit des Handelns nicht immer erkannt.
Die Angemessenheit liefert jedoch das Kriterium, das zwischen kreativen
und unsinnigen Handlungen unterscheidet.
Die Psychologie hat Merkmale beschrieben, die bei Kreativität -
als kreativen Prozeß gesehen- auftreten:
- eine gesteigerte Sensibilität für Gegebenheiten, die andere
Menschen gewöhnlich nicht bemerken,
- die Fähigkeit, Verbindungen zu knüpfen, die Beobachtungen
oder Vorstellungen auf neue Weise zusammenbringen,
- die Fähigkeit, nonverbale Bilder räumlicher oder visueller
Art zu erstellen.
Wenn Psychologen die Kreativität des "Durchschnittsmenschen" messen,
besteht ihr Ziel darin, zu bestimmen, wie kreativ ein Einzelner im Vergleich
zu einer Normpopulation ähnlicher Menschen ist.
Die Tests sind so aufgebaut, daß die Fähigkeit, ungewöhnliche,
aber angemessene Antworten auf Standardfragen zu finden, untersucht wird.
(Z. B. Wieviele Verwendungsmöglichkeiten fallen Ihnen für eine
Zeitung ein?")
Natürlich ist es sehr schwierig, Kreativität zu bewerten und
auch, sie in einen Zusammenhang mit Intelligenz zu setzen. Wie wird das
versucht?
Die meisten Intelligenztests sind so aufgebaut, daß es für
die Frage eine klar umrissene, allgemein akzeptierte Antwort gibt.
Psychologen haben festgestellt:
Kreativität und Intelligenz stehen in einem nicht ganz einfachen
Zusammenhang. Bis zu einem gewissen Intelligenzniveau (IQ von ungefähr
110) ist die Korrelation zwischen Intelligenz und Kreativität hoch,
auf höherem Intelligenzniveau gibt es eine geringe oder gar keine
Korrelation. Ein Mensch mit äußerst hoher Intelligenz (sagen
wir 140) ist oft nicht sehr kreativ, jemand mit niedrigerer Intelligenz
(etwa 115) kann dagegen sehr kreativ sein. Ein bestimmtes Ausmaß
an Intelligenz ist also notwendig, damit jemand sehr kreativ ist, aber
hohe Intelligenz garantiert keine Kreativität.
Intelligenz garantiert nicht Kreativität!
Man glaubt, daß man auch Umgebungsfaktoren wie die soziale oder
physikalische Umgebung untersuchen müßte, da man annimmt, kreative
Menschen brauchen eine spezielle Umgebung, um kreativ sein zu können.
Auch die genaue Untersuchung der Persönlichkeitsfaktoren - denn kreative
Personen haben wahrscheinlich einzigartige Persönlichkeitscharakteristika
- wird aufschlußreich sein. Psychologen fangen gerade erst an, den
Beitrag dieser Faktoren auf den Kreativitätsprozeß zu untersuchen.
Kann man Kreativität lernen?
An einigen Universitäten der USA werden spezielle Seminare angeboten,
in denen Problemlösefähigkeit und auch Kreativität erhöht
werden soll. Es wurden Techniken ausgearbeitet, die natürlich eine
gewisse Hilfe bei der Suche nach Problemlösungen bieten können.
Zum Beispiel:
...sollten Sie über die vermeintlichen Grenzen hinausschauen- fragen
Sie sich, welche Beschränkungen Sie dem Problem auferlegen und sehen
Sie, ob manche dieser Beschränkungen beseitigt werden können.
...sollten Sie Ihren Sichtwinkel der Aufgabe verändern. Versuchen
Sie, Elemente in verschiedenen Beziehungen zueinander zu sehen.
...wenn das Denken in Worten nicht hilft, versuchen Sie es mit Bildern
oder Skizzen des Problems.
...sollten Sie versuchen, durch Analogien auf eine Lösung zu kommen.
Denken Sie darüber nach, wie etwas in einem Ihnen gut bekannten Gebiet
funktioniert, und halten Sie nach Parallelen zu Ihrem Problem Ausschau.
...sollten Sie gut Buch führen. Schreiben Sie auf, was Sie getan
haben und wie Sie es getan haben. Benutzen Sie Papier und Bleistift, um
Ihr Gedächtnis zu unterstützen und zu verhindern, daß Ihr
Informationsverarbeitungssystem überlastet wird.
...sollten Sie sich nicht an einer Strategie festbeißen. Wenn
eine Strategie erfolglos bleibt, suchen Sie nach Alternativen.
...sollten Sie sich nicht vor alternativen und ungewöhnlichen Möglichkeiten
bei schwierigen Problemen verschließen.
...sollten Sie sich versichern, daß Sie richtig vorbereitet sind,
holen Sie alle Informationen ein, die Sie benötigen.
...sollten Sie für einige Zeit unterbrechen, wenn sonst gar nichts
hilft (Inkubationsphase).
Dahinter steht die Idee, daß Problemlösen durch gewohnheits-
und routinemäßige Verhaltensweisen gekennzeichnet ist, die in
der Vergangenheit erfolgreich waren. Um etwas zu erreichen, das wirklich
originell oder kreativ ist, muß man über Gewohnheit und Routine
hinausblicken und neue Denkansätze zulassen. Die meisten der obigen
Vorschläge sind dafür gedacht, diese neuartigen Denkweisen zu
wecken.
Eine bekannte Technik, Hindernisse zu beheben, ist das Brainstorming.
Dabei werden die Personen einer Gruppe aufgefordert, alle ihre Ideen zur
Lösung eines Problems zu nennen, ohne sich über die Brauchbarkeit
der Idee Gedanken zu machen. Jedes Individuum in der Gruppe stimuliert
die anderen und stößt dabei manchmal auf eine wirklich kreative
Idee. Damit das Brainstorming auch klappt, müssen die Gruppenmitglieder
gewillt sein, sehr ausgefallene Ideen zu äußern und zu hören.
Kreativität in der Praxis
Dazu das Beispiel SANTA FE INSTITUTE:
Santa Fe ist eine kleine Stadt mit zirka 50 000 Einwohner im Staate
New Mexiko im Süden der USA. Sie ist rund 80 km von Los Alamos, dem
wissenschaftlichen Zentrum, an dem die Atombombe entwickelt wurde, entfernt.
Los Alamos ist jetzt ein riesiges Forschungszentrum, das viele verschiedene
Bereiche erfaßt.
Kreativität in der Wissenschaft:
Das Santa Fe Institut befindet sich in einer der schönsten Gegenden
der USA. Es wurde aus privaten Mitteln gegründet, um die Theorie und
Anwendung komplexer Systeme in allen Bereichen der Wissenschaft
zu erforschen. Die Gründung des Instituts erfolgte durch einen amerik.
Ölmilliardär. Jetzt wird es von verschiedenen Geldgebern für
Forschungsprojekte zusätzlich unterstützt.
Komplexe Systeme: Das Studium komplexer Systeme wurde initiiert
von Forschern des nationalen meteorologischen Instituts der USA, die aufgrund
von Modellen zur Wettervorhersage auf die prinzipielle Nichtvorhersagbarkeit
des Wetters über längere Zeiträume stießen. Das war
die Geburt des Studiums komplexer Systeme und damit untrennbar mit der
Chaostheorie verbunden. Die zugrundeliegenden mathematischen Formeln treten
im Wettergeschehen genauso auf wie bei Schwankungen der Hormonkonzentrationen
im Blut, in ökologischen Modellen sowie im Aussterben alter Kulturen.
Komplexe Systeme sind gekennzeichnet durch einen "Selbstverstärkereffekt".
So kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien das Wetter
2 Monate nachher in Wien beeinflussen, - "Butterflyeffekt".
Ziel war, den Wissenschaftlern eine "kreative Spielwiese" zur Verfügung
zu stellen, so daß stressfrei und interdisziplinär neue Lösungsansätze
gefunden werden können. Das Institut beherbergt etwa 10 Wissenschaftler,
die fix angestellt sind. Zu dieser Grundmannschaft kommen etwa 40-60 meist
junge Wissenschaftler von so divergierenden Disziplinen wie Medizin, Geschichte,
Physik, Literaturwissenschaft, Computerwissenschaften, Jus, Chemie, Ökonomie,
Biologie, Mathematik, Philosophie, Psychologie u.a. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer dieser Forscher beträgt etwa 2-3 Jahre. In dieser
Zeit erhalten sie ein sehr gutes Gehalt und haben völlige Forschungsfreiheit.
Die Resultate dieser Forschungsaufenthalte in dieser stimulierenden Atmosphäre
sind sehr gut. Zusätzlich zu den vorher Genannten kommen immer wieder
für einige Monate eine ausgesuchte Schar an führenden Wissenschaftlern
ihres Fachgebietes, darunter viele Nobelpreisträger (z.B. Murray Gelman
- Physik: Entdecker der Quarks, Manfred Eigen - Chemie). Die sehr entspannte
Atmosphäre - so werden alle "Bewohner" ausschließlich mit dem
Vornamen angesprochen, die Kleidung ist leger - ermöglicht die intensive
Zusammenarbeit zwischen Etablierten und Jungen, sowie zw. den unterschiedlichsten
Wissensbereichen. Zusätzlich finden täglich Gastvorträge
von speziell dazu eingeladenen Wissenschaftlern statt. Dadurch kommt es
zur Ausbildung von immer neuen Arbeitsgruppen und zu einem interdisziplinären
Arbeitsstil.
Konkreter Ablauf eines kreativen Prozesses: Bei den täglichen
Vorträgen ist es dem Vortragenden völlig frei gestellt, was er
dem Publikum, das sich aus den verschiedensten Disziplinen zusammensetzt,
erzählt, - eben das, was er für interessant hält. Mag es
auch für manche im ersten Moment sehr eigenartig erscheinen. Das Besondere
daran ist, daß alle Zuhörer bereit sind, es anzuhören,
sich dafür zu interessieren, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen,
- und es eben nicht vorschnell abzulehnen. Anschließend findet eine
Diskussion statt. Jeder bringt seinen Beitrag ein, auch wenn es zuerst
als Nonsens erscheint, - aus seiner eigenen Sicht. Jeder Beitrag wird ernst
genommen, egal ob er von einem Dissertanten oder von einem Nobelpreisträger
kommt. Man geht miteinander essen oder spazieren, redet, und es ergibt
sich häufig, daß dann Forschungsprojekte gestartet werden. Es
finden sich neue interdisziplinäre Forschungsgruppen zusammen. Wenn
jeder wieder in seinem Land ist, läuft die Kommunikation über
die modernsten technischen Kommunikationsmittel wie das Internet ab.
Wie kann ein kreativer Prozeß begünstigt
werden?
Der Psychologe Heinz Heckhausen (Direktor des Max Planck Institutes
f. Psychologische Forschung in München) hat vier goldene Regeln aufgestellt,
die geeignet sind, kreative Prozesse zu begünstigen:
1. Regel: Ist Dir das Umfeld des Problems noch nicht voll vertraut,
sauge Dich voll damit, bis es wie ein Stück von Dir selbst ist.
2. Regel: Streichle Dein Problem von Zeit zu Zeit; laß es groß,
schön und wichtig werden, damit Dir an seiner Lösung, so lange
sie sich auch hinausziehen mag, viel gelegen ist.
3. Regel: Gib Dich Tätigkeiten hin, die aus lockerer Gespanntheit
bestehen, aber die Abwesenheit Deines Geistes vertragen. In diesem Zustand
laß das Problem in Dir weiter arbeiten.
4. Regel: Nimm alles, was Dir einfällt oder auffällt, gastfreundlich
auf; sei neugierig darauf, was es auf den Plan ruft und womit es sich verbindet.
Ergebnisse in der Kreativitätsforschung
Der Literaturwissenschaftler Siegfried J. Schmidt faßt die Ergebnisse
der Kreativitätsforschung, die am Konzept der Kreativität bislang
Produkte, Prozesse und Komponenten zu unterscheiden und zu kennzeichnen
versucht hat, wie folgt zusammen:
Die wichtigsten Hypothesen:
Kreative Personen müssen intelligent sein, damit sich Kreativität
entfalten kann. Sie verfügen über produktives (und zwar konvergentes
wie divergentes) Denken. Man schreibt ihnen Flexibilität, Originalität
und Flüssigkeit zu. Sie sind fähig, Rudimentäres bzw. Fragmentarisches
zu vervollständigen, Einheiten zu redefinieren, Strukturgleichheiten
in verschiedenen Bereichen zu erkennen. Kreative Personen können feldunabhängig
denken, sie beherrschen Perspektivenwechsel und sind problemsensibel, sie
besitzen Antizipationsvermögen und verstehen sich auf die Kunst, etwas
zu finden, was sie nicht gesucht haben (sog. Serendipidität). Die
Fähigkeit zu Irrtumsintegration, Hochschätzung von Komplexität,
Erfahrungsbereitschaft, selbst mit mystischen Erfahrungsformen, sowie hypothetisches
Bewußtsein zeichnen sie nach kreativitätstheoretischer Ansicht
ebenso aus wie Kritikfähigkeit, Konstruktivität, Reflexivität
und ein entwickeltes Assoziations- bzw. Bisoziationsvermögen (i. S.
von A. Koestler, 1981, 135).
Im Emotions- und Motivationsbereich bescheinigen Kreativitätstheoretiker
kreativen Personen ein hohes Aktivitätsniveau, Neugier, Aufgabenorientiertheit
und Erfolgsmotiviertheit, die gepaart ist mit Gelassenheit, Geduld, Gleichgültigkeit,
hoher Frustrationstoleranz, Elastizität und einem klaren Selbstkonzept.
Ich-Stärke und Angst sind in kreativen Persönlichkeiten produktiv
miteinander verbunden. Kreative können Erfahrungen assimilieren; sie
stellen Regression in den Dienst des Ich und sind in der Lage, die Prinzipien
kreativen Denkens auf dieses Selbst anzuwenden. In der neueren Kreativitätsforschung
dominiert die Auffassung, daß " ...im emotionalen Bereich nicht einzelne
Merkmale entscheidend sind, sondern eine kreativitätsspezifische Spannung
durch konträre Merkmalskombinationen sowie eine Polarität der
Motivationsstruktur" (Wermke, 1986, 75).
Kreative Personen gelten als nonkonformistische Außenseiter, die
ein hohes Maß an sozialer Unabhängigkeit und zugleich ein hohes
Verantwortungsgefühl realisieren; sie sind zugleich egozentrisch und
altruistisch, schwer sozialisierbar und ethisch. Wie Wermke (im Rückgriff
auf N. Groeben) betont, besteht der kreativitätsspezifische Aspekt
von Konstruktion in ihrer Potentialität, " ...also darin, daß
ihre eigene Überholbarkeit unter veränderten Bedingungen, unter
Einbeziehung neuer Erkenntnisse für sie konstitutiv ist" (a.a.O.,
88)
Wermke weist zu Recht darauf hin, daß Kreativität nicht lehrbar,
wohl aber lernbar ist. In diesem Zusammenhang spielt die soziale Umwelt
eine besondere Rolle. In ihr entscheidet sich jeweils, ob kreatives Verhalten
zugelassen, belohnt oder unterdrückt wird: ...
Rahmenbedingungen einer kreativitätsbegünstigenden Umwelt
sind nach Wermke u.a.:
- eine nicht zu starke emotionale Bindung an die Eltern
- eine nicht zu weitgehende Identifikation mit Erziehern
- im kognitiven Bereich ein differenziertes "Nicht-Geben", das zwischen
Verweigern, Offenhalten und Ermöglichen das jeweils günstigste
Maß findet
- eine Atmosphäre, die Freiheit und Sicherheit miteinander verbindet
- Toleranz und Offenheit für divergente Problemlösungen
- Ermöglichen selbsttätigen und selbstinitiierten Lernens
- eine spannungsreiche Umwelt, in der die Befähigung zur Selbstförderung
ausgebildet wird
- Anleitung zur Reflexion auf das eigene Verhalten.
Neue Wege in der Erforschung kreativer
Prozesse
Der amerikanische Psychologe Howard Gardner, Autor des Buches "So
genial wie Einstein. Schlüssel zum kreativen Denken" schreibt
im Vorwort, daß er mit dem Buch neue Wege in der Erforschung kreativer
Prozesse einschlägt.
Howard Gardner entdeckte in seiner Collegezeit Arbeiten des Schweizer
Psychologen Jean Piaget und wandte sich der Entwicklungspsychologie in
einem Zweitstudium zu.
25 Jahre lang hat H. Gardner im Rahmen von Project Zero an der Harvard-Universität
die geistige Entwicklung normal - und hochbegabter Kinder sowie den Zusammenbruch
von Fähigkeiten und Talenten als Folge von Gehirnverletzungen untersucht.
Konkret gesagt, wurde untersucht, wie aus Kindern Musiker, Dichter oder
Maler werden und warum die meisten es nicht werden und wie die künstlerischen
Fähigkeiten zur Reife kommen.
Da in unserer Gesellschaft die Begriffe Kunst und Kreativität eng
miteinander verknüpft sind, kann man diese jahrzehntelange Tätigkeit
Gardners als "Kreativitätsforschung" angesehen. Obwohl diese Assoziation
unbegründet ist - wie Gardner schreibt -, da man in jedem Lebensbereich
kreativ arbeiten kann.
Die Beschäftigung mit Kindern und hirngeschädigten Erwachsenen
hatte H. Gardner davon überzeugt, daß das menschliche Erkenntnisvermögen
vielfältig angelegt ist und sich am besten als Ensemble relativ autonomer
Fähigkeiten beschreiben läßt, die H. Gardner als unterschiedliche
"menschliche Intelligenzen" bezeichnet hat. Die Darstellung dieser
Theorie wurde 1983 mit dem Buch "Frames of Mind" (dt. Abschied vom IQ)
veröffentlicht. Der Schluß daraus war für Gardner: wenn
Intelligenz mehrfach zu deuten war, galt das umso mehr für die Kreativität.
Ziel der Untersuchungen war, die schöpferische Arbeit des Menschen
zu verstehen.
Untersucht wurden 7 außergewöhnliche Menschen von unterschiedlichen
Intelligenzen. Jede dieser Persönlichkeiten hat einen oder mehrere
kulturelle Bereiche bleibend geprägt:
- Sigmund Freud, linguistische, personale und logische Intelligenz,
- Pablo Picasso, räumliche, personale und körperliche Intelligenz,
- Albert Einstein, logisch-räumliche Intelligenz,
- Igor Strawinsky, musikalische Intelligenz,
- T.S. Eliot, sprachliche, wissenschaftliche Intelligenz,
- Martha Graham, körperliche und sprachliche Intelligenz,
- Mahatma Gandhi, personale und sprachliche Intelligenz
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand, zu einem Begriff von Kreativität
zu kommen. Der systematische Ansatz war entwicklungsgeschichtlich, so wurde
das Verhältnis Kindheit-Reifezeit untersucht, die Entwicklungsphasen
des gesamten Lebensablaufs sowie die einzelnen Etappen, die einen Durchbruch
kennzeichnen. Gardner geht von einer andauernden dialektischen Beziehung
zwischen der begabten Persönlichkeit, der Domäne seines Faches
und dem Feld, das die Urteilsinstanzen stellt, aus.
Es wurde bei den 7 Personen nach allgemeinen Kriterien gesucht, die
auf alle (oder die meisten) anwendbar waren.
H. Gardner ist verblüfft über das Maß der Gemeinsamkeiten
bei so verschiedenen Personen und Domänen.
H. Gardner hat ein hypothetisches Portrait eines kreativen Menschen,
der auf den Spitznamen E.C. (=Exemplary Creator) getauft wurde, entworfen:
E.C. stammt aus einer Region, die von den kulturellen und politischen
Machtzentren ihrer Gesellschaft zwar entfernt ist, doch nicht so weit,
daß sie und ihre Familie jede Kenntnis des aktuellen Geschehens entbehren
müßten. Die Familie ist weder vermögend, noch nagt sie
am Hungertuch, und in materieller Hinsicht lebt die junge E.C. ziemlich
komfortabel. Die häusliche Atmosphäre ist stärker von Korrektheit
als von Wärme geprägt, so daß sie sich ihrer Familie häufig
entfremdet fühlt; enge Bindungen an den Vater oder die Mutter sind
nicht ohne starke Ambivalenz. Intimere Beziehungen kennt sie im Verhältnis
zu einer Kinderfrau, einem Kindermädchen oder einem entfernten Familienmitglied.
E.C.s Familie zählt nicht zur höchsten Bildungsschicht, doch
werden Bildung und Wissen geschätzt und mit hohen Erwartungen belegt.
Es handelt sich, kurz gesagt, um die prototypische bürgerliche Familie
mit dem Sinn für die Ambitionen, die Respektabilität und die
Hochschätzung harter Arbeit, die diese Klasse vornehmlich im späten
neunzehnten Jahrhundert auszeichnete. E.C.s besondere Stärken zeigen
sich bereits in jungen Jahren, und ihre Eltern unterstützen diese
Interessen, obgleich sie einer Karriere abseits der bürgerlichen Berufswelt
reserviert gegenüberstehen. Die Moral, wenn nicht Religion, wird hochgehalten,
und E.C.s. Gewissen entwickelt sich zu einer ausgeprägten Kontrollinstanz,
die sich gegen sie selbst, aber auch gegen andere richten kann, deren Verhalten
den von ihr gesetzten Maßstäben nicht entspricht. Möglicherweise
durchlebt sie eine Phase der Religiosität, die sich in späteren
Jahren wiederholen kann, aber nicht muß.
Es kommt eine Zeit, in der die junge Frau der heimischen Umgebung entwachsen
scheint. E.C. hat bereits ein Jahrzehnt in die Erlernung ihres Metiers
investiert und ist auf dem Weg zur Spitze; von ihrer Familie und von den
Experten im lokalen Umkreis kann sie nichts Wesentliches mehr lernen, und
ihr Bedürfnis wächst, sich mit gleichaltrigen Talenten in ihrem
Fach zu messen. Als junge Erwachsene also bricht E.C. in die Großstadt
auf, in der alle derzeit maßgeblichen Aktivitäten auf ihrem
Gebiet zusammenlaufen. Erstaunlich schnell findet E.C. in dieser Großstadt
Anschluß an Gleichaltrige, die ihre Interessen teilen; man experimentiert
im gemeinsamen Tätigkeitsbereich, lotet neue Möglichkeiten aus,
gründet auch Institutionen, gibt Manifeste heraus und stimuliert einander
zu neuen Höhenflügen. Es kommt vor, daß E.C. sich von Anfang
an für die Arbeit auf einem bestimmten Gebiet entscheidet, sie kann
indes auch mit einer Reihe möglicher Laufbahnen liebäugeln, bevor
ein 'Kristallisations-Punkt erreicht wird und ihre beruflichen Vorstellungen
definitive Form annehmen.
Die Erfahrungen in den verschiedenen Domänen differieren, und es
wäre wenig sinnvoll, hier eine simplifizierende Zusammenfassung zu
versuchen. In jedem Fall aber entdeckt E.C. früher oder später
einen Problembereich oder ein Segment von besonderem Interesse, das verspricht,
die Domäne in unbekannte Gewässer zu steuern. Der Augenblick
ist kritisch. E.C. entfremdet sich ihrer Gruppe und bleibt in ihrer Arbeit
größtenteils auf sich gestellt. Sie ahnt, daß sie vor
einem Durchbruch in neue Bereiche steht, die allgemein und selbst für
sie noch weitgehend Neuland sind. Erstaunlicherweise ist für E.C.
in diesem Moment ein kognitiver und affektiver Beistand unentbehrlich,
soll sie nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Ohne diese Hilfe wäre
ein Zusammenbruch nicht ausgeschlossen.
Unter den glücklichen Umständen, über die wir berichten
konnten, gelingt E.C. zumindest ein großer Erfolg, dessen Bedeutung
das Feld relativ schnell anerkennt. So sehr ist sich E.C. ihrer Auszeichnung
bewußt, daß sie bereit scheint, besondere Vorkehrungen zu treffen
- einen faustischen Handel einzugehen, um sich das euphorisierende flow-Gefühl
zu erhalten, das wirksame, innovative Arbeit mit sich bringt. Für
E.C. ist dieser Pakt mit Masochismus, einem unerfreulichen Sozialverhalten
und gelegentlich auch mit dem Gefühl verbunden, eine Abmachung mit
Gott selbst eingegangen zu sein. E.C. ist von ihrer Arbeit besessen und
verlangt von sich und anderen hohe und höchste Einsatzbereitschaft.
Dem Diktum von William Butler Yeats entsprechend hat sie gewählt und
das vollkommene Werk über das vollkommene Leben gestellt. Sie ist
selbstsicher, von Fehlstarts nicht unterzukriegen, stolz, halsstarrig und
nur ungern bereit, Fehler zuzugeben.
E.C.s immense Energie und Einsatzbereitschaft ermöglichen ihr etwa
ein Jahrzehnt nach dem ersten Erfolg einen zweiten Durchbruch. Er ist weniger
radikal, doch umfassender und enger mit E.C.s früherer Arbeit verknüpft.
Von der Art ihres Metiers hängt ab, ob sich E.C. eine Gelegenheit
für weitere Durchbrüche bietet. (In den Künsten ist eine
langanhaltende Kreativität selbstverständlicher als in der Wissenschaft.)
E.C. tut alles, um kreativ zu bleiben; sie sucht einen Marginalstatus zu
erreichen oder setzt erhöhte Asynchronie ein, um ihre Spannkraft zu
erhalten und sich die Befriedigung der flow-Erfahrung zu verschaffen, die
große Herausforderungen und aufregende Entdeckungen begleitet. Unter
den Werken einer intensiven Schaffensphase werden einige sowohl von E.C.
als auch von den Mitgliedern des Feldes als Schlüsselwerke betrachtet.
Das zunehmende Alter setzt E.C.s schöpferischer Kraft die unvermeidlichen
Grenzen. Sie kann Menschen im Alter ihrer Kinder oder Enkel als Jungbrunnen
mißbrauchen. Da es schwieriger wird, originär Neues zu schaffen,
wird E.C. zur geschätzten Kritikerin oder Kommentatorin. Einige Genies
sterben jung, unsere E.C. indessen erreicht ein ehrwürdiges Alter,
sammelt Schüler und Anhänger um sich und leistet Bedeutendes
bis zu ihrem Tod.
Schlußwort: Persönliche Stellungnahme
Wie kann man nun diese Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen
auf die Praxis umlegen? Wie kann man als Pädagoge mit diesen Erkenntnissen
umgehen, wie kann man sie verwerten?
Man könnte zum Beispiel kreativitätsfördernde Umweltbedingungen
in der Schule schaffen. Eine Atmosphäre, die Freiheit und Sicherheit
bietet, Toleranz und Offenheit zeigt. Eine Atmosphäre, die selbsttätiges
Lernen fördert. (!) "Selbsttätiges Lernen" sagt sich leicht,
aber dahinter steht eine große Problematik. Ist unser Schulsystem
nicht so aufgebaut, daß die Kinder schon von klein auf darauf gedrillt
werden, das nachzusagen, was der Lehrer vorsagt? Noch dazu wird mit Zwang
und Kontrolle dieses System überprüft. Es herrscht sozusagen
immer ein Antrieb von außen vor. Der Schüler muß dabei
das Gefühl bekommen, daß er für die Schule bzw. für
den Lehrer lernt. Kennen wir nicht alle die Frage "Wozu brauch' ich das?".
Selten wird sie noch gestellt, weil die Antworten unbefriedigend ausfallen,
aber in den Köpfen ist sie immer vorhanden. "Selbsttätiges Lernen"
würde doch beinhalten, daß es eine Neugier gibt, daß der
Schüler einen Antrieb in sich selbst hat, Antworten auf Fragen zu
finden.
Natürlich geht es nicht so einfach, indem man sagt, nehmen wir
den Antrieb von außen weg, wird der innere Antrieb schon kommen.
Leider. Meiner Meinung nach ist es Aufgabe des geschulten Pädagogen,
das richtige Mittelmaß zu finden. Ich glaube, daß man schon
einen Schritt vorher ansetzen müßte, nämlich bei der Neugier.
Ich denke, daß zum "selbsttätigen Lernen" auch eine große
Portion Neugier gehört, daher sollte man auch dieses Neugierverhalten
fördern. Wie wir oben gehört haben, ist die Neugier auch ein
Charakterzug des kreativen Menschen.
Ist es nicht so, daß den Kindern in der Schule sofort einmal ihre
Phantasie und Kreativität ausgetrieben wird? Schreibt ein Zehnjähriger
einen phantasiereichen Aufsatz, wird er vom Lehrer zurechtgewiesen, daß
es "so etwas" in der Realität, im wirklichen Leben, nicht gibt. Er
solle nicht so viel "erfinden".
Wir haben gehört, daß eine wesentliche Technik bei der Suche
nach Problemlösungen "das Hinausschauen über vermeintliche
Grenzen" ist. Ist nicht ein starkes Element in unserem Unterrichtssystem
eben das Grenzen setzen? Wird nicht ein Denken nach übernommenen Normen
gelehrt? Wo lernt man in der Schule einen Perspektivenwechsel? Es wird
doch immer nur eine - die für richtig gehaltene - Sicht der Dinge
vermittelt. Wo wird dem Schüler Mut gemacht, zu ungewöhnlichen
Methoden zu greifen?
Aus den oben zitierten Untersuchungen ist auch die "Originalitat"
als ein Hauptfaktor der Kreativität hervorgegangen. Fragen wir
uns einmal wie unsere Gesellschaft zu Originalität steht? Fragen wir
uns, wie in der Schule mit Originalität umgegangen wird? Wird denn
das Finden einer originellen Lösung für die Mathematik-Aufgabe
wirklich gefördert? Und wie steht es mit der Originalitat im Fach
Deutsch? Der Lehrer bewertet, was richtig und falsch ist, und diese Bewertung
fußt auf seiner eigenen Vorstellung davon, was ein guter Aufsatz
sein soll. Muß uns das nicht bei genauerer Betrachtung absurd erscheinen,
daß ein origineller Gedankengang, weil dem Lehrer nicht zugänglich,
durchaus als "falsch" bewertet wird? Insofern ist es sicher von Wichtigkeit,
daß einem kreativen Menschen hohe Frustrationstoleranz und Beharrungsvermögen
zugeschrieben wird.
Betrachten wir ein weiteres Merkmal von Kreativität: Die Fähigkeit,
Verbindungen zu knüpfen, Beobachtung und Vorstellungen auf neue Weise
zusammenzubringen. Werden nicht auch hierbei ständig Grenzen gesetzt
mit dem Argument "das gehört nicht hierher, nicht zum Thema"?
Wäre es nicht für unseren Blickwinkel "Entwicklungspsychologie
und Schule" sinnvoll, einmal zu hinterfragen, wie weit unser Schul-
und Unterrichtssystem förderlich ist für die Entwicklung kreativer
Eigenschaften? Wäre es nicht unsere Pflicht, die Erkenntnisse aus
der Kreativitätsforschung auf den Unterricht umzulegen und in der
Schule eine Atmosphäre zu schaffen, die mehr zur Entfaltung von bestimmten
Eigenschaften führt, als sich nur auf die reine Wissensvermittlung
zu verlegen?
Voraussetzung dafür wäre natürlich, die Kreativität
als Wert für eine Gesellschaft anzuerkennen.
Bibliographie
Bourne, L. E. & Ekstrand, B. R. (1992). Einführung in die
Psychologie. Frankfurt am Main: Klotz.
Drosdowski, G. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg). (1993).
Duden. Zitate und Aussprüche. (Bd. 12). Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich: Dudenverlag.
Gardner, H. (1996). So genial wie Einstein. Schlüssel zum kreativen
Denken. Stuttgart: Klett-Cotta.
Grimm, J. & W. (1984). Deutsches Wörterbuch. (Bd. 15).
München: DTV.
Heckhausen, H. (1988). "Kreativität" - ein verbrauchter Begriff?.
In H-U Gumbrecht (Hrsg.), Kreativität - Ein verbrauchter Begriff?
(S. 21-33). München: Wilhelm Fink Verlag.
Müller, W. (Hrsg.). (1986). Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter.
(2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.) (Bd.8). Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich:
Dudenverlag.
Schmidt, S. J. (1988). Kreativität aus der Beobachterperspektive.
In H-U Gumbrecht (Hrsg.), Kreativität - Ein verbrauchter Begriff?
(S. 33-53). München: Wilhelm Fink Verlag.
Zimbardo, P. G. (1995). Psychologie (6., neu bearbeitete und
erweiterte Aufl.) Berlin: Springer.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
10) Hochbegabung (Manuela Slany)
DAS MARBURGER HOCHBEGABTEN PROJEKT
Ausgangslage
Das Projekt "Lebensumweltanalyse besonders begabter Grundschulkinder"
wurde von März 1987 bis Ende 1991 von Bundesministerium für Bildung
und Wissenschaft finanziell unterstützt. Das Projekt lief in folgenden
Phasen ab:
-
Test in den Schulen
-
Erhebungen in den Familien und Befragung der Lehrkräfte
-
Auswertungsarbeit am Computer
-
Ergebnisdokumentation
Allgemeine Zielsetzung
Folgende Fragen wurden gestellt:
-
Wie ist der Entwicklungsstand des hochbegabten Grundschulkindes in physischer,
emotionaler und psychosozialer Hinsicht ?
-
Wie nehmen die Interaktionspartner hochbegabte Kinder war ?
-
Welche Anforderungen und Wünsche stellen sie an besonders begabte
Kinder ?
-
Wie bewerten Eltern und Lehrer die häufig in der einschlägigen
Literatur genannten Fördermaßnahmen für Hochbegabte ?
-
Wie gut können Lehrer und Klassenkameraden hochintelligente Kinder
identifizieren ?
Hauptgesichtspunkte:
-
Rückgriff auf eine unausgelesene Grundgesamtheit
-
Einschränkung der Altersvarianz
-
Keine Vorauswahl durch Lehrer und Eltern
-
Einbeziehung einer echten Vergleichsgruppe durchschnittlich begabter Kinder
-
Betonung der allgemeinen Intelligenz "g" (Spearmanscher Generalfaktor)
-
Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen
-
Verwendung multipler Indikatoren (Fragebogen, Interview,...)
-
Verzicht auf postalische Befragungen
Das Verständnis von "besonderer Begabung"
Hier wird unter besonderer Begabung, dasselbe wie Hochbegabung verstanden.
Hochbegabung = sehr hohe einzigartige Ausprägung der allgemeinen
Intelligenz
Mittels differentieller Intelligenztests kann man die unterschiedlichen
Intelligenzfaktoren für "g" testen. Typische Indikatoren:
-
Sprachverständnis
-
verbal reasoning
-
non verbal reasoning
Auffällig war, daß mathematisch hochbegabte Kinder einen durchschnittlichen
IQ von 144 hatten. Dies läßt vermuten, daß für eine
mathematische Hochbegabung auch eine große allgemeine Intelligenz
nötig ist. In diesem Intelligenzverständnis ist Kreativität
nicht eingeschlossen.
Untersuchungsphase I
Von November 1987 bis August 1988 wurden 7289 Kinder aus 206 verschiedenen
Schulen untersucht.
3 Tests:
CFT 20: erfaßt die grundlegende Denkkapazität
und mißt die Fähigkeit zur Problemerfassung und Problemlösung
in neuartigen Situationen
ZVT (Zahlenverbindungstest): Verfahren zur Messung der
kognitiven Leistungsgeschwindigkeit
ANA (sprachliche Analogien)
Fragen:
"Mit wem spielst Du gerne in den Schulpausen ?"
"Mit wem spielst Du nicht gerne in den Schulpausen ?"
"Wer in der Klasse lernt besonders schnell und weiß mehr als die
anderen?"
Die Lehrer:
-
Schätzskalen für jeden Schüler
-
Nominierungsfragen für die Besten bestimmter Fähigkeitsbereiche
Auswahl der Zielgruppe (151 Kinder) + der Vergleichsgruppe (136 Kinder),
sowie eine Berufskategorisierung der Eltern
Untersuchungsphase II
Kontaktaufnahme mit den Eltern und den Lehrkräften, sowie Erhebung
folgender Variablen:
Datenquelle "Kind"
-
Persönlichkeitsfagebogen
-
ZVT
-
ATTK (Attributionskiste): Anstrengungsbereitschaft
-
Fragebogen zur Erfassung schulspezifischer Kompetenz-, Ursachen- und Kontrollerwartung
der Kinder
-
Selbstkommunikationskiste zur Erfassung der Reaktionsbereitschaft
-
Sozialfragebogen
-
Selbstkonzept-Skala
-
Familienbeziehungstest
-
Matching-Familiar-Figures-Test
-
Freundschaftsfragebogen
-
Bildmalen
-
Differentieller Intelligenztest für Kinder
Datenquelle "Eltern"
-
Elterninterview
-
Erziehungsfragebogen
-
Persönlichkeitbeurteilung des Kindes durch die Eltern
-
Elternfragebogen
-
Temperamentsfragebogen für die mittlere Kindheit
-
Familienstrukturfragebogen
-
Selbstkonzeptfragebogen
-
Fragebogen zu Akzeptanz von Fördermaßnahmen für besonders
begabte Kinder
-
Verfahren zu Messung des für Bildungsverhalten relevanten sozialen
Status
Datenquelle "Lehrer"
-
Lehrerinterview
-
Persönlichkeitsbeurteilung des Kindes durch die Lehrkraft
-
Temperamentsfragebogen für Lehrer
-
Fragebogen zur Akzeptanz von Fördermaßnahmen
-
Schulleistungen und sportliche Leistungen

FAMILIEN MIT HOCHBEGABTEN KINDERN
Bemerkungen zur Familientheorie und Familiendiagnostik
Familien (psychologischer Fachbegriff)= soziale Beziehungssysteme,
die gegenüber anderen sozialen Systemen, wie etwa einer Schulklasse
oder einer Arbeitsgruppe durch die Kriterien "Abgrenzung", "Privatheit",
"Dauerhaftigkeit" und "Nähe" gekennzeichnet sind.
Systemische Familienbegriff: wichtigstes Kennzeichen:
Ganzheitlichkeit; Prozesse sind zirkuläre Abläufe
Zusammenhang von familiärer Umwelt
und kognitiven Fähigkeit des Kindes
Das ein starker Zusammenhang besteht ist unbestritten, doch in welchem
Ausmaß sollte hier untersucht werden.
Fest steht: Je größer die Familie ist, desto
niedriger ist das kognitive Entwicklungsniveau der Kinder.
Beispiel: Breland(1074) untersuchte über 800 000 Stipendienanwärter
und zeigte, daß Erstgeborene aus kleinen Familie die höchsten
Werte und Letztgeborene aus großen Familie die schlechtesten Werte
aufwiesen.
Gegenbeispiel: Hayes & Brunzaft (1979) fand bei einer Vereinigung
von überdurchschnittlich akademisch Leistungsfähigen, keine bevorzugte
Familiengröße oder Geburtsposition.
Unklar ist: Besteht ein Zusammenhang zwischen der Geburtsposition
und der Persönlichkeit ?
Confluence Theory (70er Jahre; Zajonc & Markus)
=Erklärungsmodell für den Zusammenhang zwischen Familiengröße,
Geburtsposition und Altersabstand zwischen den Geschwistern:
-
große Familien haben weniger intelligenter Kinder
-
später geborene Kinder sind weniger intelligenter als ihre älteren
Geschwister
-
je geringer der Altersabstand zwischen den Geschwistern ist, desto geringer
ist die kognitive Leistungsfähigkeit des jüngeren Geschwisters
Einzelkinder und Letztgeborene haben den Nachteil, daß sie von jüngeren
Geschwistern nichts lernen können, und sie nehmen daher eine Sonderstellung
ein.
Die wichtigsten Ergebnissen dieser Untersuchung:
a)Sozioökonomischer Hintergrund
Hochbegabte Kinder kommen überdurchschnittlich häufig aus
Familien die einen hohen Bildungs- und Sozialstatus.
b) Erziehungsstile
Eltern die ihren Kindern ihre Interessen nicht vorschrieben, sondern
sie gegebenen Falls unterstützten hatten weitaus leistungsfähigere
Kinder als andere Familien.
-
Familiäre Beziehungen
Hochbegabte Kinder haben eine negativere Beziehung zu ihren Geschwistern
sowie zu ihrer Mutter
d) Effekte des Etiketts "hochbegabt"
Eltern haben eine weitaus größere Erwartungshaltung und sind
sehr stark leistungsorientiert.
-
Familiensystem
Familien mit hochbegabten Kindern sind kommunikationsfähiger, emotional
reagibler und verhaltenskontrollierter.
Fragestellung und Variablen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Begabung eines Kindes und der
vom Kind wahrgenommenen Beziehung zu seinen Familienmitgliedern?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Begabung eines Kindes und familiären
Systemvariablen?
Versuchsbeschreibung:
Das Kind wählt aus Pappfiguren zwei aus die den Eltern am ähnlichsten
sind und einen Herrn Niemand. Danach ordnet das Kind den Figuren 44 Karten
zu die nach der Richtung der Gefühle und der Qualität der Gefühle
unterschieden werden.
Ergebnisse
Schulbildung der Eltern:
Bei den Müttern konnte kein signifikanter Unterschied zwischen
Müttern von hochintelligenten Kindern und denen von durchschnittlich
begabten Kindern festgestellt werden. Bei den Vätern war der Unterschied
jedoch zu1% signifikant.
Alter der Eltern bei der Geburt des Kindes:
Vater und Mutter besonders begabter Kinder sind im Durchschnitt älter
als die Eltern der Vergleichsgruppe.
Familienstatus:
Die Eltern von hochbegabten Kindern sind viel häufiger geschieden
oder leben getrennt.
Beziehungssystem:
Negative Kärtchen die den Geschwistern zugeordnet wurden, ordneten
Einzelkinder dem Herrn Niemand zu. Mädchen erleben die Beziehung zu
ihrer Mutter signifikant positiver als Jungen. 42% der Kinder meinen, daß
ihr Vater zu wenig Zeit für sie hat und 39% der Kinder erleben ihn
als manchmal schlecht gelaunt.
Familiensystem:
Die Einschätzung des Familiensystems hängt nicht von der Begabung
des Kindes ab. Desto höher der Bildungsstatus, desto mehr wird ein
demokratischer Stil erlebt.
Zusammenfassung
Kein Unterschied bestand bezüglich:
Familiengröße
Geschwisterposition
Unterschiede wurden nachgewiesen bezüglich:
Bildungsabschluß der Väter
Familienstatus
Alter der Eltern bei der Geburt des Kindes
FÖRDERMASSNAHMEN FÜR HOCHBEGABTE
GRUNDSCHUL -KINDER
Fördermaßnahmen
1981:Christophorus-Schule in Braunschweig - erste Versuchsklasse für
hochbegabte Kinder
Feger (1988): Übersicht über verschiedene Maßnahmen
zur Hochbegabtenförderung:
-
Individualisierung und Differenzierung innerhalb der Klasse
-
außerunterrichtliche Maßnahmen wie Arbeitsgemeinschaften, Projekte,...
-
Vorzeitige Einschulung, Klassenüberspringung,...
-
Beratungslehrer
-
Sommerkurse
-
teilweise getrennter Unterricht
-
Sonderklassen
-
Hochbegabtenschulen
-
Fernunterricht
Zusammenfassung
Desto größer der Unterschied zu einer Normalen Schulbildung
finden, desto eher treffen die Vorschläge auf Abneigung bei den Eltern.
Lehrer sprechen sich zu 2/3 gegen ein überspringen von Klassen aus.
Als unumstritten und sehr wünschenswert und auch relativ leicht
realisierbar werden von Eltern und Lehrern diejenigen Vorschläge eingeschätzt,
die die Eigenverantwortlichkeit der Eltern für die Förderung
ihrer besonders begabten Kinder betonen und von ihnen persönliches
Engagement und Unterstützung verlangen. Gerne angenommen wird auch
der Vorschlag der inneren Differenzierung des Unterrichts, wogegen fast
alle Maßnahmen der äußeren Differenzierung auf Ablehnung
treffen. Alle Maßnahmen sind für Jungen und Mädchen sind
gleich wünschenswert.
EIGENE MEINUNG
Da ich selbst immer sehr gut in der Schule war, interessiert mich dieses
Thema auch aus persönlichen Gründen. In Österreich gibt
es "Olympiaden" in den verschiedenen Fächern. Die Idee finde ich wirklich
sehr gut, aber noch viel zu wenig verbreitet. Ich hätte an der Mathematik
oder Physikolympiade teilnehmen können. Der Aufwand dafür ist
allerdings unglaublich. Man muß an eine andere Schule fahren um dort
vorher einen Vorbereitungskurs zu besuchen. Läßt sich dies z.B.
mit dem Nachmittagsunterricht nicht vereinbaren, so gibt es keine Möglichkeit
daran teilzunehmen.
Wenn mein Kind hochbegabt wäre, würde ich es selbst so weit
als möglich fördern und darauf achten, daß es nicht zum
Versuchskaninchen der Nation wird. Es soll auf jeden Fall "normal" aufwachsen.
Natürlich soll eine besondere Begabung gefördert werden, aber
nicht auf Kosten der Kindheit. Wenn ein Kind am Nachmittag in der Bibliothek
sitzen muß so nimmt man im gegen seinen Willen seine Freiheiten.
Will es jedoch aus eigenem Interesse etwas wissen, oder etwas lernen, so
empfiehlt es sich dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu
fördern.
LITERATURANGABE
Knapp, A. &Rost, D.H. (Hrsg.) (1993). Lebensumweltanalyse hochbegabter
Kiner. Das Marburger Hochbegabten Projekt. Göttingen: Hogrefe
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
11) Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische
Störungen im Jugendalter (Veronika Markl)
1. EINLEITUNG:
In der vorliegenden Arbeit mit dem Thema "Verhaltensauffälligkeiten
und psychosomatische Störungen im Jugendalter" sollen verschiedene
Betrachtungsweisen des Phänomens kurz beschrieben werden. Nachdem
die Forschung in den letzten Jahren immer mehr zu dem Ergebnis gekommen
ist daß auffälliges Verhalten nur zu einem geringen Teil auf
organische Schäden zurückzuführen ist, werde ich diese nur
ergänzend und sehr kurz anführen.
Viel wichtiger im Zusammenhang mit dem vorliegenden Themen sind Störungen
in der psychischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Der wichtigste Teil der Arbeit ist die zusammenfassende Anführung
von Vorschlägen zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und
psychosomatischen Störungen in der Praxis. Als angehender Lehrer ist
es "lebensnotwendig" auf auffälliges Verhalten richtig und angemessen
zu reagieren. Ignoranz gegenüber auftretenden Problemen wäre
genauso falsch wie eine Überreaktion, die ein vorliegendes Problem
schlimmer macht als es tatsächlich ist.
Eine der wichtigen Aussagen, die ich im Lauf der Erarbeitung des Themas
in der Literatur herausgelesen habe ist, daß der neue Ansatz im Umgang
mit auffälligem Verhalten auf ein gemeinschaftliches Lösen von
auftretenden Problemen aufbaut. Dadurch soll verhindert werden, daß
einem einzelnen die alleinige Schuld an Problemen zugeschrieben wird, wie
zum Beispiel dem "schlechten Lehrer", was für mich eine große
Erleichterung bedeutet.
Als Lehrer ist es sicher wichtig, sich der möglichen Probleme und
deren Ursachen bewußt zu sein. Dennoch sollte man sich als Lehrer
nicht überfordern, und nur soweit eingreifen, als dies im eigenen
Bereich liegt. Es ist daher hilfreich und notwendig, die eigenen Grenzen
zu erkennen und alles, was über die Kompetenz der Lehrers hinausgeht,
an die entsprechenden zuständigen Personen ruhigen Gewissens zu delegieren.
Abschließend möchte ich sagen, daß dieses Seminar mir
sehr geholfen hat, einerseits die Anforderungen, die in psychologischer
und menschlicher Hinsicht an Lehrpersonen gestellt werden und andererseits
die dazugehörigen Grenzen zu erkennen, was ich persönlich für
wichtig halte um den Lehrberuf erfolgreich ausüben zu können.
2. Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Störungen
in Jugendalter:
2.1. Begriffserklärung und unterschiedliche Betrachtungsweisen
des Phänomens der Verhaltensauffälligkeit:
Im Lauf meiner Literatursuche sind mir große Unterschiede in der
Behandlung des Themas aufgefallen. Die für die Arbeit verwendete Literatur
setzt sich aus sehr unterschiedlichen Quellen zusammen, die die verschiedenen
Perspektiven widerspiegeln und mir so einen relativ umfassenden Einblick
in das Thema gegeben haben. Vorausschickend ist zu sagen, daß es
keine einheitliche Definition des Begriffes Verhaltensauffälligkeit
gibt. Es wird darunter ein von der Norm abweichendes Verhalten verstanden,
was natürlich von den jeweiligen Normen der betreffenden Gesellschaft
abhängig ist. Daher ist der Begriff ein relativer:
Sowohl Normalität als auch Auffälligkeit sind immer nur als
rationale Bestimmungen in einem je spezifischen historisch - gesellschaftlichen
Lebensraum möglich, der durch die dort gültigen Normalitätsnormen
definiert ist. Wenn also die Verhaltensweisen eines Kindes als auffällig
bezeichnet werden, so ist es notwendig, die normativen Bezugskriterien
anzugeben, die dieser Bewertung zugrunde liegen. (Werning, S. 10)
In der Praxis bedeutet das, daß für einen Lehrer vielleicht
noch im Bereich des akzeptablen liegt, was ein anderer schon als "verhaltensauffällig"
empfindet.
Auch über die Häufigkeit des Phänomens ist daher keine
genaue Angabe zu machen. Um das Thema näher zu umreißen möchte
ich 2 Betrachtungsweisen, die sich im Lauf der Zeit entwickelt haben beschreiben:
1.1. DER INDIVIDUALISIERENDE ANSATZ:
Hier werden die Ursachen von Störungen in der betroffenen Person
selbst gesucht. Nämlich krankhafte Strukturen, die eventuell vor,
während oder nach der Geburt hervorgerufen worden sein könnten.
Die Verhaltensauffälligkeit wird als Fehlleistung des Kindes gesehen
und der Blick auf seine Person gerichtet:
Das sozial auffällige Verhalten wird als Zeichen einer intrapersonalen
Störung oder Fehlanpassung interpretiert. Institutionelle und normative
Bedingungen, die Vernetzung des Individuums mit der sozialen Umwelt, gesellschaftliche
Problemlagen, die historische Gewordenheit, die aktuellen Lebensbedingungen
und -möglichkeiten des Kindes/Jugendlichen werden dabei ausgeblendet."
(Werning, S. 17)
Dieser Ansatz, der nach organischen Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten
sucht, verliert langsam an Einfluß und muß einem neueren, den
ich nachfolgend beschreiben werde, weichen:
1.2. DER VERSTEHENDE ANSATZ:
Dieser gewinnt in letzter Zeit an Einfluß und sieht die Verhaltensauffälligkeit
als Ausdruck einer Störung in der Beziehung zwischen im Kind und seiner
Umwelt, d.h., in der Familie, in der Schule, in der sozialen Gruppe, der
der Schüler angehört:
Der einzelne ist in seinem Verhalten auf die Umwelt angewiesen, diese
ermöglicht, verhindert, fördert, schränkt ein Sie hat einen
modifizierenden Anteil an allem, was der Einzelne tut oder läßt.
Insofern ist jede Aussage über ein verhaltensauffälliges Individuum
auch eine Aussage über das System, in dem diese Auffälligkeiten
sich konstellieren, ermöglicht, vielleicht sogar gefördert wurden.
(Sedlak, S. 58)
Beim verstehenden Ansatz wird dieses Phänomen nicht als Krankheit,
sondern als sinnvolles Signalverhalten gesehen, das zu einer Behebung der
Beziehungsstörung auffordern soll.
2. Mögliche Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten und
psychosomatischen Störungen:
Auf dem verstehenden Ansatz aufbauend lassen sich nun folgende mögliche
Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten feststellen:
Sind organische Schäden, die im Vergleich zu sozial bedingten Ursachen
relativ selten sind, auszuschließen, so ergibt sich folgendes:
Den Lehrern bzw. der Schule als gesellschaftliche Institution werden
bestimmte Norm-, Wert- und Zielvorstellungen zugeschrieben, die sie an
die Schüler weitergeben. Nimmt der Schüler die Werte nicht an,
oder erreicht er die vorgegebenen Ziele nicht, wird das als Störung
gesehen. Das heißt, bei diesem Schüler
-
klappt die Erziehung zu einem funktionierenden Staatsbürger nicht
-
Normen und Werte, die er aus seiner Familie kennt, stimmen mit denen der
Schule nicht überein.
-
es regt sich Widerstand gegen Leistungsdruck beim Schüler
-
der Schüler leidet unter Über- oder Unterforderung
Allgemein kann man sagen, daß der Großteil der auftretenden
Verhaltensstörungen durch Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen
entsteht.
Das Kind, als Teil von sozialen Gruppen: Familie, Schule, Gesellschaft,
braucht die Möglichkeit und Unterstützung, sich als Individuum
zu entwickeln und soll gleichzeitig innerhalb der Normen bleiben. Eine
vertrauensvolle Beziehung zu den Familienmitgliedern, ansprechende Gestaltung
des Schulgebäudes und des Unterrichts sind Voraussetzung dafür.
Um dem "auffälligen" Verhalten eines Schülers auf den Grund
zu gehen, muß man seine verschiedenen "Lebensweltbereiche" betrachten
um die Störung lokalisieren zu können:
Im Bereich der Familie können konfliktreiche Beziehungen zu den
bzw. zwischen den Eltern die Entwicklung des Kindes stören. Wichtig
ist genügend Zuwendung auf der einen und ausreichend Raum für
Selbständigkeit auf der anderen Seite:
Nehmen wir nur die Auflösung der Familie für eine Person,
deren zentraler Lebenssinn die Familie gewesen ist, ... oder das Schulversagen
von Kindern, die davon überzeugt sind, daß die Wertschätzung
ihrer Person in der Familie überwiegend von ihrem schulischen Erfolg
abhängt. Wenn spezifische Lebensweltkonstruktionen durch solche belastenden
Lebensereignisse an bedeutsamen Punkten zusammenbrechen und die Person
bzw. das soziale System nicht über ausreichend personale und/oder
soziale Ressourcen verfügt, neue, den veränderten Lebensweltbedingungen
angepaßte handlungsleitende Orientierungen zu entwickeln, ist es
wahrscheinlich, daß eine Person Signalverhaltensweisen produziert,
die von der sozialen Umwelt als auffällig bzw. gestört etikettiert
werden. (Werning, S. 108)
Im Bereich der Schule wirkt sich ein angenehmes Klima zwischen Schülern
und Lehrern sicher förderlich aus. Aus einer meiner Quellen habe ich
sehr praktische Ansätze und Tips zur Lösung und zum Umgang mit
auftretenden
Problemen gefunden, die ebenfalls vom verstehenden Ansatz ausgehen,
und auf die ich später näher eingehen werde.
3. Häufige Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische
Störungen:
Um einen kurzen Überblick zu geben, möchte ich einige der
bisher von mir eher allgemein behandelten Verhaltensauffälligkeiten
konkret beim Namen nennen und anschließend auf den Umgang mit ihnen
eingehen:
3.1. Die HYPERAKTIVITÄT:
Sie wird auch als "Hyperkinetisches Syndrom" bezeichnet, die teilweise
auf Schädigungen des Gehirns, die sogenannte "MINIMALE CEREBRALE DYSFUNKTION"
zurückzuführen ist. In diesem Fall ist sie sehr gut mit Medikamenten
zu behandeln. Andere Theorien, die ebenfalls organische Ursachen hinter
der Hyperaktivität sehen, beschreiben sie als allergische Reaktion
auf bestimmte chemische Stoffe. Wenn organische Ursachen ausgeschlossen
werden können, so leiden die betroffenen Kinder an einer starken psychischen
Spannung. Diese kann mit entsprechenden Konzentrations-, Entspannungs-
und Aufmerksamkeitstrainings gemindert werden:
Zu Beginn der Achtziger Jahre fand eine ganzheitlich sozioökologische
Sichtweise der Störung ihren Eingang in die Forschung (HENKER &
WHALEN 1980). Die Abhängigkeit der Verhaltensauffälligkeiten
hyperaktiver Kinder von situativen Komponenten und Wechselwirkungen zwischen
Verhalten und sozialer Umwelt wurde zum Thema zahlreicher Forschungsarbeiten
(EISERT 1981, HENKER & WHALEN 1980). Beeinflussung der situativen Komponenten
durch Strukturieren des Unterrichts, der Klassenräume; Elterntrainings,
Selbstkontrolltrainings und andere pädagogisch- psychotherapeutische
Verfahren führten zu einer teilweisen Abkehr von der rein medikamentösen
Therapie, häufig aber zu ihrer Ergänzung. (Innerhofer, S. 190)
Die Symptome bei Hyperaktivität sind: Konzentrationsschwierigkeiten
und allgemeine Unruhe.
3.2. Die LESE- UND RECHTSCHREIBSCHWÄCHE, auch LEGASTHENIE:
Auch hier findet man teils organische, teils pädagogisch- psychologische
Ursachen für die Störung. Im Lauf der Zeit hat sich die Definition
dieser Störung immer wieder verändert:
Bei den Definitionen der Legasthenie gibt es kein einheitliches Bild
und die Abweichungen ergeben sich zum Teil aus den völlig voneinander
abweichenden Deskriptions- und Diagnosemethoden, den verschiedenen Standpunkten
und Bewertungsmaßstäben der Fehler. Eine der gebräuchlichsten
Definitionen ist diejenige von SCHUBENZ (1964) `Wir verstehen unter Legasthenie
das Phänomen der bedeutsamen Inkongruenz (Nichtübereinstimmung)
von (relativ guter) allgemeiner Begabungshöhe und der (relativ geringen)
Fähigkeit, das Lesen und orthographisch richtige Schreiben in der
von der Schule dafür eingeräumten Zeit und mit dem vorgesehenen
Maß an Training zu erlernen. (Innerhofer, S. 220)
Sind organische Schäden, wie zum Beispiel, eine Störung in
der visuellen Wahrnehmung auszuschließen, so können Überforderung,
weil die nötige Schulreife noch nicht vorhanden ist, oder Nervosität
mögliche Ursachen sein.
Diese Form der Störung hat jedoch nichts mit dem Intelligenzquotienten
des Kindes zu tun.
Als Behandlung werden Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Sprache trainiert.
3.3. RECHENSTÖRUNGEN bei normaler Intelligenz:
Wenn Schüler auch nach mehrmaliger Erklärung des Rechenbeispiels
anscheinend dieses noch immer nicht verstehen "wollen", wäre es ein
schwerwiegender Fehler sie als "zu dumm" für diese Aufgabe abzustempeln.
Gerade in dieser Situation braucht der Schüler die volle Unterstützung
des Lehrers und das Gefühl, seine Schwierigkeiten überwinden
zu können:
Die wesentlichen Erkenntnisse zur Fehlerkunde aus der klinischen Erforschung
von Einzelfällen lassen sich in 3 Punkten zusammenfassen: 1. Schülerfehler
beruhen meistens auf systematischen Regeln bzw. Fehlerstrategien, ... 2.
Die Mathematik, insbesondere die Arithmetik, wird von sehr vielen Kindern
als eine Art Zufallsspiel mit künstlicher Regelhaftigkeit und ohne
direkten bzw. notwendigen Bezug zur Realität angesehen. 3. Fehler
Schwierigkeiten ... stehen nur selten in einem engen Zusammenhang mit den
Leistungen im sogenannten mündlichen Rechnen. (Innerhofer, S. 238)
Als Ursachen für Rechenschwierigkeiten haben sich oft unpassendes
Lerntempo, also Über- oder Unterforderung oder Denkfehler herausgestellt.
Mit Hilfe von sogenannten "logischen Spielen" können diese bekämpft
und das logische Denken geschult werden.
3.4. HAUSAUFGABENPROBLEME:
Mögliche Ursachen für das standhafte "vergessen" der Hausübung
können sowohl im Bereich des Lehrenden, als auch in der Familie liegen:
" Primär muß geklärt werden, ob es sich bei Hausaufgaben
Problemen um ein Symptom für eine dahinter liegende Störung (zum
Beispiel ein Teilleistungsstörung) handelt, ob das Kind durch den
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe über- beziehungsweise unterfordert
wird, oder ob die Umweltbedingungen ... zu den Schwierigkeiten führen."
(Innerhofer, S. 251).
Als Lehrer sollte man folgendes beachten: Der Schüler braucht Freude
an der Hausübung, das heißt er braucht solche, die ihn zwar
fordern, aber gleichzeitig nicht zu schwierig sind um sie selbständig
zu erledigen. Weiters ist es sehr wichtig dem Schüler entsprechendes
Feedback, besonders Belohnung für gelungene Arbeiten zukommen zu lassen.
Voraussetzung für das Erledigen der Hausübung ist aber vor
allem ein Platz im Haus, wo der Schüler ungestört und konzentriert
lernen kann.
3.5. Die LERNBEHINDERUNG:
Bei diesem Phänomen hat der Schüler in allen Gegenständen
Probleme und scheint den Anforderungen in der Schule im Allgemeinen nicht
gewachsen. Hier müssen zuerst die tieferen Ursachen, die in einem
der "Lebensweltbereiche" des Schülers zu lokalisieren sind erst gefunden
werden.
Danach kann mit einer entsprechenden Lösung des Problems begonnen
werden:
Um aber eine Entstehung der Lernbehinderung verhindern zu können,
müssen Aktionen gesetzt werden," die über den engeren schulischen
Rahmen hinausgehen... Denn ist es erst einmal zu einer Umschulung in die
Lernbehindertenschule gekommen, so ist ein Rückführung in die
Regelschule beinahe ausgeschlossen. (Innerhofer, S. 185)
3.6. SCHULVANDALISMUS:
Laut Definition versteht man unter Vandalismus die absichtliche Verunstaltung,
Verschmutzung und Zerstörung öffentlichen oder privaten Eigentums.
Hier sind einige Bedingungen, die dieses Phänomen fördern:
-
Große Schulen, in denen die Schüler eher anonym sind
-
Frustration, wobei der Vandalismus als Ventil für den Frust über
die erzwungene Anpassung an gesellschaftliche Normen dient.
-
je schwächer die Bindung an die Gesellschaft ist, desto eher kommt
es zu Schulvandalismus
Was könnte man dagegen tun?: "Da zerstörerisches Verhalten durch
mehrere verzichtende Faktoren bedingt ist, erscheint es zweckmäßig
ein mehrgleisiges Vorgehen anzuwenden. Ein absolut sicher wirkendes Allheilmittel
wird es kaum jemals geben" (Innerhofer, S. 262).
Als Vorschläge gibt die von mir verwendete Literatur Gespräche
und Diskussionen mit der Klasse an. Ein weiterer, der mir persönlich
sehr gut gefällt, weil ich ihn für sinnvoll und effizient halte,
ist der Tip, den Lebensraum Schule für die Schüler - unter deren
Mithilfe! - so ansprechend wie möglich zu gestalten.
4. Fallbeispiel:
Nach dieser kurzen Vorstellung einiger häufiger Verhaltensauffälligkeiten
möchte ich ein Fallbeispiel eines betroffenen Kindes bringen:
Es handelt sich um den 8-jährigen Ingo.
Der Bub litt unter Konzentrationsschwierigkeiten, er verhielt sich teilweise
aggressiv gegenüber seinen Mitschülern und war zeitweise bei
übermäßig guter Laune. Dazu hatte er große Rechtschreibschwierigkeiten.
Weiters litt er unter Heuschnupfen, Ekzemen und Atembeschwerden.
Ingos Eltern lebten zusammen und waren um seine Gesundheit sehr besorgt,
weiters hatte Ingo eine 3 Jahre ältere Schwester.
Bei den Gesprächen mit dem Therapeuten konnte dieser folgendes
diagnostizieren:
-
Im HAWIK-Intelligenztest lag Ingo leicht unter dem Durchschnitt.
-
Bei den Persönlichkeits- und Wahrnehmungstests zeigten sich verschiedene
Störungen.
Der Baumtest: Auffällig war hierbei, daß die Äste
bei Ingos Baum sehr spitz waren, und daß er weder auf festem Boden
stand, noch Wurzeln hatte.
Der Menschtest: Ingo zeichnete nur einen Kopf ohne Rumpf
und Gliedmassen, was auf das gestörte Verhältnis zu seinem eigenen
Körper hindeutete.
Als allgemeine Folgerung kam der Therapeut zu dem Ergebnis, daß
Ingo sich mehr Zuwendung vom Vater wünschte und dem geschwisterlichen
Konkurrenzkampf nicht gewachsen war. Er mußte seine Wahrnehmung schulen
und ein besseres Verhältnis zu seinem Körper und damit ein größeres
Selbstwertgefühl bekommen.
Ingo hatte Schwierigkeiten, beim Wahrnehmungstest die
Bilder in einer für sein Alter adäquaten Zeitspanne in der richtigen
Reihenfolge zu ordnen. Beim Test " Bilder ergänzen" stellte sich heraus,
daß er eine zuwenig differenzierte Wahrnehmung hatte.
Nach 2-jähriger Therapie konnte Ingo jedoch beträchtliche
Erfolge verzeichnen, was sicherlich auch auf die rege Beteiligung seiner
Eltern an der Therapie zurückzuführen ist. Seine körperlichen
Beschwerden gingen stark zurück: Die Atembeschwerden und die Ekzeme
verschwanden völlig, der Heuschnupfen besserte sich. Auf dem Gebiet
der psychischen Störungen hatte Ingo große Fortschritte gemacht:
Er hatte nach seiner Therapie ein wesentlich besseres Selbstwertgefühl,
konnte daher den geschwisterlichen Konkurrenzkampf sehr gut aushalten und
hatte gelernt seine Aggressionen besser zu beherrschen.
Für mich zeigt dieses Beispiel sehr gut den Zusammenhang zwischen
Körper und Psyche, weil bei Ingo die körperlichen Beschwerden
eindeutig mit seiner psychischen Spannung zu tun hatten, und wie wichtig
es ist, daß man gemeinsam - in diesem Fall die Eltern und das Kind
- das vorliegende Beziehungsproblem beseitigt.
5. Vorschläge zum Umgang mit auffälligem Verhalten und
psychosomatischen Störungen:
Um Verhaltensauffälligkeiten wirklich beikommen zu können,
muß man sie an der Wurzel packen. Es genügt nicht, nur die Symptome
zu behandeln. Da es sich in den meisten Fällen nicht um organische
Schäden handelt, die mit Medikamenten bekämpft werde können,
müssen pädagogisch - psychologische Methoden angewendet werden.
Grundsätzlich wäre es für Lehrpersonen günstig,
auch psychologische und therapeutische Kenntnisse zu haben. Meine persönliche
Meinung dazu habe ich bereits in der Einleitung erklärt. Obwohl es
auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, schwierige Probleme an zuständige
Personen zu delegieren, muß der Lehrer im Unterricht dennoch oft
mit den Problemen kämpfen, die die Schüler aus anderen Lebensweltbereichen
(zum Beispiel der Familie) mit sich "schleppen", und deren Auswirkungen
sich in der Schule zeigen. Leidvolle Beziehungen und Störfaktoren
in der Entwicklung sollen bzw. können mit Hilfe des sogenannten "SOLIDARISCHEN
MODELLS" (Sedlak, S. 28ff.) in der Schule durch positive Beziehungen
überwunden werden. In Zusammenarbeit mit allen Beteiligten kann ein
gesundes Klima und " balancierte Beziehungen" zwischen Lehrern und
Schülern hergestellt werden, was die Veraussetzung für ein gesunde
Entwicklung der Jugendlichen ist.
Was versteht man konkret unter "balancierten Beziehungen":
Sie sind gekennzeichnet durch:
-
respektvollen Umgang zwischen Lehrer und Schülern, d.h. der Lehrer
sollte keinen zynischen oder Befehlston verwenden.
-
Transparenz der Normen, Ziele und Bewertungsgrundlagen im Unterricht
-
Genügend Raum für Aktivitäten der Schüler im Unterricht
zulassen
-
Auffälligkeiten als Signal sehen, um GEMEINSAM dieses soziale Problem
zu lösen
Diese Idee der "balancierten Beziehungen" klingt sehr unrealistische und
ist auch oft in der Praxis nicht so durchführbar. Wie bzw. unter welchen
Bedingungen dann diese Idee funktionieren?
-
um balancierte Beziehungen herzustellen, muß der Lehrer selbst innere
Balance haben
-
Kinder brauchen eine Familie in der Balance herrscht, das heißt,
gute zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Familie
-
auch in der Klassengemeinschaft, unter den Schülern müssen gute
Beziehungen herrschen
Diese Bedingungen, die die beste Voraussetzung für die Vermeidung
von sozial bedingten Verhaltensstörungen sind, lassen sich mit gutem
Willen und etwas Know-how herstellen. Sie sind zumindest praxisnahe Tips
und umsetzbare Vorschläge, die nicht in grauer Theorie enden.
6. ZUSAMMENFASSUNG:
Aus all diesen Forschungsergebnissen geht sehr deutlich hervor, daß
eine Lehrperson viel mehr ist als ein Wissensvermittler. Neben dieser Eigenschaft
muß diese sich durch überaus große soziale Fähigkeiten
auszeichnen. Sensibilität, Einfühlungsvermögen und allgemeines
Interesse an menschlichen Problemen sind mindestens ebenso wichtig wie
das Beherrschen des Unterrichtsfaches. Da die Schüler einen Großteil
ihrer Zeit in der Schule verbringen ist sie ein Teil ihres Alltagslebens
- ob das nun für sie angenehm ist oder nicht. Das sollte allen Beteiligten
klar sein und daher sollte der Lebensraum Schule so ansprechend und sinnvoll
wie möglich gestaltet werden . Die Schule als Ort der Begegnung zwischen
Menschen sollte für alle eine Bereicherung darstellen. Um diesem Ziel
möglichst nahe zu kommen sind die in der von mir verwendeten Literatur
angegebenen Vorschläge sehr nützlich und von großer Bedeutung.
Sie sollen vor allem zur Schaffung eines Problembewußtseins beitragen
indem sie erklären, daß die auftretenden Verhaltensauffälligkeiten
zum größten Teil aus Störungen in den sozialen Beziehungen
entstehen. Das "solidarische Modell" ist ein Ansatz, die gestörten
Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, so daß eine ungestörte
Entwicklung des einzelnen möglich ist.
BIBLIOGRAPHIE:
Innerhofer, P., Weber, G., Klicpera, C. & Rotering-Steinberg, S.
(Hrsg.). (1988). Psychische Auffälligkeiten und Probleme im Schulalter.
Wien: Universitätsverlag.
Rothleitner, S. (1991). Bedingungen und Lösungsmöglichkeiten
schulischer Verhaltensstörungen. Dipl.Arbeit, Universität,
Wien.
Sedlak F. (Hrsg.). (1992). Verhaltensauffällig - Was nun?
Wien: Pädagogischer Verlag.
Werning, R. (1996). Das sozial auffällige Kind. Münster;
New York: Waxmann
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
12) Drogen (Michael Tichacek)
Drogen sind nach einer Definition der WHO (World Health Organisation)
Substanzen, die innerhalb des lebendigen Organismus eine oder mehrere Funktionen
zu verändern vermögen, insbesondere solche Substanzen, die eine
zentral - nervöse Wirkung besitzen.
Drogenabhängigkeit ist ein Zustand, der sich aus der wiederholten
Einnahme einer Droge ergibt, wobei die Einnahme periodisch oder kontinuierlich
erfolgen kann. Es werden eine psychische und eine körperliche Abhängigkeit
unterschieden. Die psychische Abhängigkeit äußert
sich in einem wiederkehrenden Wunsch nach bestimmten Erlebnissen und Gefühlen
durch die Einnahme einer Droge, die körperliche Abhängigkeit
läßt sich durch objektiv faßbare körperliche Störungen
definieren.
Drogen- und Rauschmittelkonsumverhalten Jugendlicher in Österreich
Jugend und Drogen in Österreich
In Österreich liegt die häufigste Abhängigkeit in allen
Altersgruppen im Alkohol und Nikotin, gefolgt von Medikamenten.
Seit 1928 gibt es in Österreich ein Giftgesetz, das sich
eng an internationale Protokolle und Konventionen anlehnte. 1948 und 1951
entstand durch Novellen ein neues Suchtgesetz. Durch die steigende Drogenproblematik
kam es 1960 zu einer Neuformulierung, 1971 wurde der Drogenmißbrauch
nicht nur als Kriminalsdelikt betrachtet, sondern sein Krankheitscharakter
miteinbezogen. Beim Ertappen eines Erstbesitzers mit maximal einer Wochenration
wurde der Täter mit einer Strafe auf Probezeit belegt. Nach einer
weiteren 1980 formulierten Suchtgiftnovelle soll Suchtkranken in erster
Linie Hilfe geleistet werden, natürlich bleibt der Besitz von Drogen
strafbar. Seit 1985 erfolgt eine Differenzierung in den organisierten
Drogenhandel und jenen Straffälligen, die oft selbst Opfer
ihrer Abhängigkeit sind. Die maximale Freiheitsstrafe beträgt
20 Jahre.
Jugend und Alkohol
Allgemein spricht man in Österreich von 650.000 Alkoholgefährdeten
(mehr als 3 Flaschen Bier pro Tag). Der Volkswirtschaftliche Schaden durch
Heilungskosten und Arbeitsausfall beläuft sich bei 30 Milliarden
Schilling. Laut Jugendbericht 1987 konsumieren in Österreich 14%
aller 16- bis 19jährigen Alkohol, 50 % rund zweimal wöchentlich.
70% der trinkenden Jugendlichen haben Rauscherfahrungen, 5% berauschen
sich mehrmals in der Woche!
Alkohol und Drogenerfahrungen
Bei nicht trinkenden (abstinenten) Jugendlichen werden nur in Ausnahmefällen
Erfahrungen mit Drogen wahrgenommen. Bei Alkoholtrinkern waren es 9%. Es
konnte allgemein ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Alkoholkonsum
und dem Gebrauch von illegalen Drogen, Nikotin und Psychopharmaka festgestellt
werden: 45% jener, die täglich trinken, haben illegale Drogen probiert.
Alkoholkonsumbedingungen
Alkohol wird hauptsächlich in der arbeitsfreien Zeit, bei familiären
Anlässen und im Freundeskreis getrunken. Jugendliche trinken häufiger
im außerfamiliären Bereich wie Gaststätten, Parties, mit
Freunden und Arbeitskollegen und meistens nur am Wochenende - im Gegensatz
zu Erwachsenen. Jugendliche verwenden Alkohol seltener als Problem- und
Sorgenlöser, Entspannungs-, Beruhigungs- oder Schlafmittel. Der Einstieg
in den Alkoholkonsum beginnt meist in der Familie zu bestimmten Anlässen.
Eltern und Freunde
Nach einer Schülerbefragung erhielten 50% der 15- bis 17jährigen
Wiener Jugendlichen ihr erstes Glas von den Eltern. Später verlagert
sich der Konsum außerhalb des Elternhauses. Nach diversen Studien
wird das elterliche Konsumverhalten doch weiter von den Jugendlichen übernommen,
allerdings steigt der Einfluß durch den Freundeskreis mit der Ablöse
vom Elternhaus. Interessant ist die Tatsache, daß Jugendliche mit
einem engen, langjährigen Freundeskreis weniger trinken als jene,
welche in verschiedenen Freundeskreisen verkehren.
Alkoholkonsum
Ein Vergleich der Jahre 1986, 1988 und 1990 soll das Konsumverhalten
von 11- bis 15jährigen erläutern. 11jährige konsumieren
so wenig Alkohol, als daß statistisch auswertbare Daten erhaltbar
wären. Bei den 13jährigen deutet sich ein Rückgang im Konsum
von alkohol zwischen 1986 und 1988 an, welcher sich in den folgenden Jahren
nicht weiter fortsetzt. Bei den 15jährigen ist die Entwicklung einerseits
vom Geschlecht, andererseits vom Schultyp abhängig. Insgesamt konnten
keine konkreten Tendenzen aus den Daten abgelesen werden.
Jugend und Rauchen
Das Rauchen ist im Gegensatz zum Trinken früher erlaubt. Der Tabakkonsum
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist zurückgegangen. Der Einstieg
in den Tabakkonsum erfolgt in vielen Fällen bereits vor dem 15. Lebensjahr,
allerdings bleibt es oft nur bei einem Versuch. Eine gesamtösterreichische
Erhebung im Jahr 1983 ergab, daß über zwei Drittel aller 15jährigen
Schüler bereits eine Zigarette probiert hatten, bei den 13jährigen
waren es etwas mehr als die Hälfte und bei den 11jährigen rund
ein Drittel. Die erste Zigarette erhalten die Jugendlichen im Gegensatz
zum Alkohol nicht von den Eltern, sondern von Gleichaltrigen oder sie besorgen
sie sich selber.
Medikamente
Allgemein zeichnet sich in Österreich eine zunehmende Tendenz zur
Medikamentenabhängigkeit ab, auffällig ist auch der steigende
Mißbrauch durch Kinder und Jugendliche. Bei den Medikamenten handelt
es sich um eine "geheimgehaltene Alltagsdroge, weil der Konsum großteils
legal ist. Es erfolgen keine Anzeigen bzw. sehr wenige. 1987 hat es z.
B. 219 Anzeigen gegeben, 1992 wurden 157 Personen wegen Medikamentenmißbrauch
registriert. Aus diesen geringen Daten können keine Rückschlüsse
auf Medikamentenabhängigkeit in Österreich gezogen werden.
Jugend und Medikamente
Es steht von vornherein das Problem, daß es keine Abtrennung zwischen
medizinischem Gebrauch und Mißbrauch von Medikamenten gibt, weil
der Erwerb meistens legal erfolgt. Natürlich können Medikamente
auch illegal beschaffen werden. Weibliche Personen neigen stärker
zum Gebrauch von Psychopharmaka als männliche, außerdem steigt
der Medikamentenmißbrauch mit höherem Alter.
Jugend und illegale Drogen
Die Suchtgiftkriminalität in Österreich wird nach den erfolgten
Anzeigen beurteilt. Es handelt sich um eine Aufklärungsstatistik des
Bundesministeriums für Inneres. Dabei werden lediglich bekanntgewordene
Straftaten registriert. Diese einseitige Kriminalstatistik sagt also nicht
Konkretes über die tatsächliche, realistische Situation in Österreich
aus. Über die Dunkelziffern der unbekannten Straftaten wird dadurch
wenig bekannt. Allerdings lassen sich gewissen Trends abzeichnen, die sicher
mit den Dunkelziffern parallel laufen.
Suchtgiftkriminalität in Österreich
Die Suchtgiftkriminalität ist laut Statistik ("Zuwiderhandeln gegen
die Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes") stark im Zunehmen. So gab es vom
Har 1991 zum Jahr 1992 einen Zuwachs um 45%. In den letzten zwei Jahren
ist die Zahl der Drogentoten leicht rückläufig. Allerdings gab
es verstärkten Mißbrauch von "harmloseren" Drogen wie Ecstasy.
Die Statistik unterscheidet zwischen Vergehens-Tatbeständen und Verbrechens-Tatbeständen.
Unter ersterem versteht man den reinen Suchtgiftmißbrauch, unter
zweiterem schwere Suchtgiftdelinquenz, verbrechensqualifizierende Suchtgiftmengen,
Dealen usw. Bei beidem ist es zu einem starken Zuwachs gekommen.
Einstiegs- und Konsummotive
Nach verschiedenen Untersuchungen gibt es keine konkreten Gründe,
die zum Drogenmißbrauch führen. Es sind vielmehr eine Vielzahl
von Faktoren, die zusammen einen Menschen zum Mißbrauch veranlassen.
Nachgewiesen ist auch, daß Cannabis nicht die klassischen Einstiegsdroge
ist. Der Einstieg erfolgt immer mit den legalen Drogen Alkohol und Nikotin.
Heroin-, Kokain-, Stimulantien- und Beruhigungsmitteluser wählten
zu 50% andere verbotene Einstiegsdrogen, vor allen Dingen Stimulantien
und Beruhigungsmittel.
Drogen und Schule
Drogenabhängigkeit ist nicht ein plötzlich auftretendes Phänomen,
sondern es entwickelt sich. Unsere moderne Gesellschaft hat sich Regeln
und Normen aufgestellt, deren Bewältigung uns nicht selten zum Verhängnis
wird. In den Lehrplänen des österreichischen Schulwesens werden
sogenannte "Unterrichtsprinzipien" angeführt. Das Unterrichtsprinzip
"Gesundheitserziehung" betrifft in erster Linie auch das Verständnis
und die Ganzheit der Person, die physischen und psychischen Fragen der
Gesundheit des Menschen und der Gesellschaft. Die Gesundheitserziehung
soll fächerübergreifend erfolgen.
Ecstasy
Historischer Abriß
Der Stoff Ecstasy wurde 1912 das erste Mal von der Firma Merck
synthetisiert. Es herrscht Unklarheit über den damaligen Verwendungszweck,
da keine Aufzeichnungen im Archiv der Firma dokumentiert sind. Ecstasy
wurde damals zwar patentiert, aber niemals vermarktet, so daß der
Name bald an Bekanntheit verlor. In den 50er Jahren gab es erste toxikologische
Untersuchungen dieses Mittels an Tieren, in den 60er Jahren verwendeten
Psychotherapeuten Ecstasy in psycholytischen Therapien. Der chemische Name
von Ecstasy ist 3,4 -Methylen-dioxy-methamphetamin, kurz MDMA genannt.
MDMA verbessert den Zugang zu eigenen Gefühlen und inneren Konflikten.
Angstbesetzte Inhalte werden leichter zugänglich gemacht. 1985 wurde
MDMA in den USA in die Liste nicht verkehrsfähiger Mittel aufgenommen.
Der erste Konsum von Ecstasy erfolgte in kleinen Zentren der USA in den
60er Jahren. Im Zeitraum von 1975 bis 1985 kam es zu einer Ausweitung des
Bekanntheitskreises über die Ballungszentren. MDMA wurde flächendeckend
konsumiert. Am 11. Februar 1986 nahm die UNO den Stoff in die Liste der
psychotropen Stoffe auf. Als Begründung wurden seine neurotoxische
Wirkung, seine Strukturanalogie zu bereits bekannten Amphetaminderivaten
und schließlich das Fehlen notwendiger klinischer Daten angeführt.
Am 1. August 1986 nimmt Deutschland MDMA in die Liste der Halluzinogene
auf, wodurch dieser Stoff offiziell verboten wurde. Die Psychopharmazie
reagierte darauf durch die Synthese eines Ersatzstoffes, nämlich MDE
(EVE), welcher die chemische Bezeichnung 3,4-Methylen-dioxy-ethamphetamin
trägt. Sie wollte damit das Gesetz umgehen. Am 28. Jänner 1991
wurde dieser Stoff in Deutschland ebenfalls verboten. Durch die sich immer
mehr durchsetzende Techno-Musik kam es zu einer Verbindung von Ecstasy
und Rave-Parties.
Biologische und toxikologische Befunde
In erster Linie greift MDMA ins Neurotransmittersystem des Zentralnervensystems
ein. Zwischen zwei Nervenzellen gibt es eine Verbindungsstelle, den synaptischen
Spalt. Ein elektrochemisches Signal läuft an das eine Ende der Nervenzelle
ein (Präsynapse). In diesem Ende sind Vesikel, kleine Kammern, welche
einen Neurotransmitter zum Inhalt haben. Die Vesikel werden durch das Signal
veranlaßt, zur Membran der Präsynapse zu wandern, mit dieser
zu verschmelzen und ihre Inhalte in den synaptischen Spalt zu gießen.
Die Neurotransmittermoleküle wandern zur Membran der nächsten
Nervenzelle (Postsynapse). An dieser befinden sich Rezeptormoleküle,
welche mit dem Neurotransmitter eine Verbindung eingehen und ein Folgesignal
in dieser auslösen.
Die Hauptwirkung von MDMA besteht in einer Interaktion mit dem serotonergen
System und dem dopaminergen System des Nervensystems. Beides sind Transmittersyteme.
MDMA bewirkt eine Erhöhung der Serotoninkonzentration im synaptischen
Spalt. Dies geschieht so, daß es das Serotonin-Vesikel zur Wanderung
an die Membran und zur Abgabe seines Inhaltes veranlaßt. Weiters
kann Ecstasy die postsynaptischen Erkennungszellen der Membran blockieren.
Rauschwirkungen
Die Rauschwirkung von MDMA besteht, wie oben bereits erwähnt, in
einer psychischen Befreiung. Personen unter Ecstasy-Wirkung werden allgemein
sprechfreudiger. Gundsätzlich verstärkt es jedoch, wie jede andere
Droge auch, die momentane Gefühlsstimmung. Ein schlechtes Gefühl
wird also nicht aufgehoben, sondern sogar verstärkt. Die wichtigere
Rauschwirkung ist ein Verschwindenlassen der natürlichen Leistungsgrenzen,
ein wesentlicher Grund für den Einsatz auf Rave-Parties, wo manchmal
tagelang durchgetanzt wird. Da wichtige körperliche Bedürfnisse
wie Durst und Erholung ausgeschaltet werden, entsteht eine große
physiologische Gefahr. Der Mensch muß seine Körpertemperatur
konstant halten. Bei Überhitzung gibt es diverse Kühlsysteme
im Körper. Eine Kühlmethode ist die Sekretion von Schweiß,
also von Körperflüssigkeit. Da durch MDMA das Durstgefühl
ausgeschaltet wird, verfügt der Körper über zu wenig "Kühlflüssigkeit",
eine Folgeerscheinung ist der Tod. MDMA-Konsumenten sollten daher bewußt
regelmäßig Flüssigkeit zu sich nehmen.
Erfahrungen aus der Praxis:
Walter geht mit seiner Freundin auf eine Rave-Party. Obwohl
es sich herumgesprochen hat, Ecstasy nicht zusammen mit Alkohol einzunehmen,
konsumiert er alkoholische Getränke. Er nimmt auch die Ecstasy-Tablette,
die er um 250.- auf dem Wiener Karlsplatz erstanden hat. Walter und seine
Freundin haben viel Spaß beim Tanzen. Nach etwa zwei Stunden ist
die Wirkung der Tablette abgeklungen. Sie fahren zu ihm in die Wohnung.
Aus ihm unerklärbaren Gründen verliert er die Kontrolle über
sich. Er gerät in Raserei und demoliert seine Wohnung.
Monika bekommt zu ihrem Geburtstag eine LSD-Tablette.
Sie ist begeisterte Schifahrerin und nimmt an einem Schitag die Tablette.
Diese steigert die gute Stimmung, die sie ohnehin hatte, ins Unendliche.
Die Landschaft zieht in berauschender Weise bei der Abfahrt an ihr vorbei.
Nach ihren Schilderungen konnte sie jeden einzelnen Schneekristall deutlich
erkennen. Nach zwei Stunden ist die Wirkung vorbei. Es war für sie
ein tolles Erlebnis. Seit damals hat sie LSD nie wieder genommen. Sie hat
erfahren, daß es bei Einnahme dieser Droge zu sogenannten Flash-Backs
kommen kann, das sind spontane psychische Erlebnisse mit beängstigenden
Inhalten, die ohne Einnahme der Droge und ohne jede Vorwarnung auftreten
können. Sie weiß heute auch, daß diese Erlebnisse auch
bei anderen Drogen auftreten können.
Thomas hat einmal Drogen genommen. Er leidet unter Flash-back-Phänomene.
Unlängst ist er über einen Platz gegangen, als plötzlich
ein Dämon aus dem Kanalgitter gesprungen ist und er zurückschreckte.
Für vorübergehende Personen war seine Abwehrreaktion mit den
Händen merkwürdig anzusehen. Für ihn selbst ist es ein großes
Problem.
DISKUSSION:
Sollen Drogen legalisiert werden ?
LITERATURANGABE:
RABES, W., HARM, W. (1997): XTC und XXL - Wirkungen, Risiken, Vorbeugungsmöglichkeiten
und Jugendkultur.- 254 Seiten, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
ANDREAS-SILLER, P. (1991): Kinder und Alltagsdrogen - Suchtprävention
und Kindergarten und Schule.-151 S., Peter Hammer Verlag, Wuppertal
HACKER, P., DAVID, A. (1997): Wiener Drogenbericht 1996.- 192 S., Magistrat
der Stadt Wien, Wien
zurück zur Homepage
von Harald Werneck
![]()